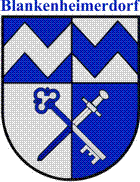|
Waachhecke
Der Eifeler Name für den Gemeinen Wacholder. Das stachelige Immergrün wird bis zu fünf Meter hoch und war in 2002 Baum des Jahres. Auf den Kalkmagerböden der Flurbereiche Katzekuhl und Bierth bei Blankenheimerdorf gab es noch nach dem Krieg größere Wacholderbestände. Hier holten sich die Bauern bündelweise Waachhecke als Würzzusatz beim Räuchern nach der Hausschlachtung. Tatsächlich verleiht der Wacholder beispielsweise dem Eifeler Räucherschinken eine köstliche Duft- und Geschmacksnote. Der Wacholder ist heute naturgeschützt, nur noch die Beeren dürfen eingesammelt werden. Mit ihrem Wacholderschutzgebiet „Lampertstal“ besitzt die Gemeinde Blankenheim das größte zusammenhängende Schutzgebiet dieser Art in NRW und das Drittgrößte in der Bundesrepublik Deutschland. Ein paar vertrocknete Waachheckeässjer (Wacholderzweiglein) verwahrte Jött das ganze Jahr über im Köcheschaaf (Schrank), wir Kinder durften sie nicht berühren, weil sonst die verdorrten braunen Nadeln abfielen. Beim schlimmen Gewitter verbrannte Jött ein paar der Zweige im Herd und betete dabei irgendeinen Gewittersegen oder ähnliches. Generell durfte beim Gewitter kein Feuer unterhalten werden, weil nach dem Volksglauben Qualem dr Bletz aanzöch (Rauch den Blitz anzieht).
Waasem
Der Waasem ist in erster Linie eine Sode, ein „ausgestochenes Rasenstück,“ wie die Suchfrage im Kreuzworträtsel lautet. Das Wort kann aber auch allgemein auf eine Gras- oder Wiesenfläche angewandt werden, beispielsweise brachte Mam daheim die Wäsche für ze blejche op dr Waasem (zum Bleichen auf den Rasen). Üblich war auch die Redewendung Rouh hammer iësch, wemmer önner dem Waasem leije (Ruhe finden wir erst im Grab). Bei der „Schiffelwirtschaft“ wurde auf dem Ödland dr Waasem jeschällt (die Grasnarbe abgeschält) und nach dem Trocknen zusammen mit Gestrüpp und Ginster verbrannt. Beim Ausheben von Drainagegräben wurde die Grasnarbe in dicken rechteckigen Soden abgehoben, die Wääsem (Mehrzahl von Waasem) wurden nach dem Verlegen der Rohe wieder fürs Abdecken der Gräben verwendet. Das Werkzeug für diese Grabenarbeit war das Wessebejel (Wiesenbeil), eine Doppelhacke mit einer senkrechten Klinge zum Schneiden und einer flachen Haue zum Abheben der Soden. Wääsem brauchten unter anderem auch die Köhler zum Abdichten ihrer Meiler. Das Segelflugplatzgelände in Wershofen (Kreis Ahrweiler) trägt die Bezeichnung Om jrööne Waasem (Auf der grünen Wiese).
Wähßelfuhr
Ein Begriff aus der Landwirtschaft, der beim Jrompere setze (Kartoffeln pflanzen) zur Anwendung kam: Die „Wechselfurche.“ Je nach Anzahl der Pflanzhelfer, wurde die Arbeitsfläche in Abschnitte aufgeteilt: Hälften, Drittel oder sogar Viertel der Furchenlänge. Die Wähßelfuhr war ein einfacher Schuhabdruck auf der frisch gepflügten Furche und markierte den Anfang des jeweiligen Pflanzabschnitts. Der Abdruck wurde bei jeder neuen Furche wiederholt, sodass sich zum Schluss die schmale Trittspur quer über den gesamten Acker erstreckte. Wähßelfuhr, Wechselfurche, der Name bezeichnet die Funktion: Eine Markierung für den wechselweisen Arbeitseinsatz der Pflanzer. Manchmal diente auch ein am Feldrand in die Erde gerammter Stock als Markierung. Dabei mussten unterdessen die Pflanzer bei größer werdendem Abstand ein passables Ouremooß (Augenmaß) besitzen, damit sie nicht aus der Richtung gerieten. Die Anzahl der Setzer (Pflanzer) bestimmte den Arbeitsfortgang, manchmal ließ der Pflugführer sein Gespann am Ende der Furche puëse (pausieren), griff sich den Kartoffelkorb und pflanzte selber der nächsten Wähßelfuhr entgegen. Bei uns daheim waren in der Regel drei Erwachsene und wir Kinder im Einsatz, - abends spürte man jedes Knöchlein im Leib. Jrompere setze war damals Knochenarbeit, wie jede bäuerliche Tätigkeit.
Waisch
Regional die Bezeichnung von Lager- oder Stapelraum für Getreide in der Scheune. Im Regelfall war die Tenne der Mittelpunkt, sie lag meistens neben dem Stall, dessen Decke von der Tenne her erreichbar war und als Heustall (Heuboden) diente. An der anderen Tennenseite lag die Waisch, der bis unters Dach reichende Stapelraum. Um bei den üblichen engen Raumverhältnissen möglichst viel Platz zu schaffen, lag der Boden der Waisch häufig unter dem Tennenniveau, bei uns daheim musste man fast einen Meter tief in die Waisch hinab steigen, deren Boden aus einer starken Balkenlage bestand. Das Gegenstück der Waisch und ebenfalls Lagerraum war der Steijer (Steiger), eine Balkendecke etwa vier Meter hoch über dem Tennenboden. Auf dem Steijer wurde das zu dicken Bünden gepackte ausgedroschene Stroh aufbewahrt. Im Getreidevorrat lebten Ratten und Mäuse, die sich im Verlauf des Flegeldreschens in die untersten Schichten des Kornstapels zurückzogen. In der Waisch gab es zum Schluss regelrechte „Rattenschlachten,“ wenn die Schädlinge unter den letzten Garben zum Vorschein kamen und die Dreschmannschaft ihnen mit Knüppeln den Garaus machte. Wir hatten eine ungewöhnlich große gelb-weiße Katze, die sich intensiv an der Rattenjagd beteiligte. Sie erwischte die Ratte „im Flug“ und zerbiss ihr brutal das Genick.
Wakkant
Auf den ersten Blick scheint der Ausdruck mit „Vakanz“ in Verbindung zu stehen, was aber nicht der Fall ist. Ein anderes Wort Wakkant ist Faaskant. „Faskante“ ist ein Begriff aus der Holzverarbeitung und bezeichnet eine abgeschrägte Kante oder Fläche am Werkstück. Die Fensterscheibe zum Beispiel ist auf der Innenseite des Holzrahmens zur Optimierung des Lichteinfalls mit abgeschrägten „Fasleisten“ befestigt. Faaskanten wurden zu Großvaters Zeiten mit dem speziellen Faashobbel (Hobel) von Hand an das Werkstück gearbeitet, eine enorme Knochenschinderei. Die Faaskant war also eine absichtlich hergestellte Abschrägung, die Wakkant dagegen war ein Holzschaden, der den Ersatz des betreffenden Werkstücks erforderlich machte. Die Wakkant konnte unter anderem durch Absplittern oder Einreißen entstehen, Schalbretter besaßen eine natürliche Wakkant an der Rindenseite, und schließlich konnte nachlässiges Hobeln dazu führen, dass ein Holzteil üß dem Winkel geriet (nicht mehr rechtwinklig war) und wakkantich wurde. Mit wakkantigen Bauteilen war keine saubere Arbeit möglich. Dank moderner Räzisionsmaschinen gibt es heute keine unwinkligen Bauteile und auch keine Wakkanten mehr.
Wann
Der Wann war zur Zeit unserer Eltern ein bei der Getreidereinigung unentbehrliches Gerät, ein wannenartiger flacher Korb aus Weidengeflecht, ungefähr einen Quadratmeter groß, mit zwei Handgriffen und einem etwa 30 cm hohen Rand, der sich an den beiden Griffseiten zur Vorderkante hin verjüngte. Das Gerät hieß offiziell „Getreideschwinge“. Das mit dem Flegel ausgedroschene Getreide wurde portionsweise in den Wann gefüllt, mehrfach in die Höhe geworfen und wieder aufgefangen. Dabei wurden durch den Luftzug Kaaf (Kleie) und Staub von den Körnern getrennt, nach Möglichkeit wurde zusätzlich Durchzug auf der Scheunentenne erzeugt. Das Wannschwingen wurde mit der Zeit durch die Wannmöll (Wannmühle) angelöst, eine von Hand angetriebene mechanische Reinigungsmaschine mit Rüttelsieben und einem Windrad zur Erzeugung des Luftstroms. Die Maschine hieß offiziell „Windfege“ (siehe: Wannmöll) und war eine Weiterentwicklung der ebenfalls mechanischen Fauch, bei der die Körner durch einen Luftstrom fielen (siehe: Fauch). Bei beiden Maschinen wurden die Körner im untergestellten Wann aufgefangen und gesammelt. Das ursprüngliche Arbeiten mit dem Wann war Schwerarbeit.
wann
Wie im Hochdeutschen, so leitet wann auch im Dialekt einen Fragesatz ein, typisch für die Eifel ist aber auch seine Anwendung im Sinne von „locker, undicht, wackelig.“ Wenn beispielsweise das Moosfass (Musfass, Sauerkrautfass) undicht war, war es wann geworden und die Spannreifen musste nachgezogen werden. In der Sommerhitze wurden sehr oft die Stiele von Heurechen oder Gabeln wann, weil das Holz eintrocknete und sich in der Halterung lockerte. Der Eifeler Bauersmann wusste Rat: Durch intensives Anfeuchten quollen die Stiele rasch wieder auf und der Schaden war vorübergehend behoben. Wo es anging, stellte man das Werkzeug einfach in den nächsten Bach. Mit dem Hauptwort Wann bezeichnete man bei uns die „Kornschwinge,“ den flachen Korb zum Reinigen von Ausdrusch auf der Tenne. Wann wor dr Wann wann? Dieses Wortspiel beinhaltet alle drei Anwendungen von wann, die freie Übersetzung lautet nämlich „Wann war die Kornschwinge wackelig.“ In den meisten Fällen wurde wann auf gelockerte Holzteile angewandt, wenn beispielsweise der Stuhl aus dem Leim ging, war er wann, und wenn die Türen am Klejderschaaf nicht mehr dicht schlossen, war dä janze Kaaste wann.
Wannmöll (weiches ö)
Analog zum Wann die „Wannmühle,“ eine handbediente Maschine zur mechanischen Getreidereinigung. Die offizielle Bezeichnung ist „Windfege“. Der Wann wurde in der Maschine durch ein Schüttelsieb ersetzt, das nur die Körner und die Kaaf durchfallen ließ. Ein Windrad erzeugte einen kräftigen Luftstrom, der im Sinne des Wortes „die Spreu vom Weizen trennte“ und wegblies. Die Kaaf war als Viehfutter oder als Füllung für den Kaafsack verwertbar. Ähren, Strohreste oder sonstiges grobes Material sammelten sich separat in einer Auffangvorrichtung am rückwärtigen Teil der Maschine. Die gereinigten Körner, auch Kidder genannt, wurden unter der Schüttung im Wann aufgefangen. Weitere Namen für die Wannmöll sind „Getreideputzmühle“ oder „Rotationsworfelmaschine,“ ein wahres Bandwurmwort, das aber die Funktion ziemlich genau beschreibt: Worfel ist ein gängiges Wort für den Wann und analog dazu worfeln für das Arbeiten mit dem Wann, das in der Maschine durch mechanische Rotation bewirkt wird. Der Rüttelmechanismus der Siebe erzeugt ein konstantes monotones Geräusch, vergleichbar mit dem „Klipp-klapp“ einer Mühle, daher die Bezeichnung Möll (Mühle). Ein Vorgänger der Wannmöll war die Fauch, eine Maschine mit ähnlichen Funktionen. Die Wannmöll wurde mit der Zeit durch die Dreschmaschine ersetzt, die ihrerseits durch den Mähdrescher abgelöst wurde.
wärm
Das landläufige Mundartwort für „warm.“ Das davon abgeleitete Hauptwort ist die Wärmb (Wärme), das unterdessen nur selten gebraucht und meistens durch Hetz (weiches e, = Hitze) ersetzt wird. Wärmb heißt auf Englisch „Warmth,“ die Holländer sagen „Warmte.“ Über das Wörtchen wärm existieren diverse Redewendungen. Esu wärm dat de Krohe jappe (So warm, dass die Krähen nach Luft schnappen) beschreibt beispielsweise sommerliches Heuwedder (Heuwetter). Wenn jemand über Kälte klagt, wird ihm häufig augenzwinkernd geraten: Dann maach dir ad jät wärm Jedanke (Mach dir warme Gedanken), und wenn ein Gebäude unter merkwürdigen Umständen niederbrennt, wird hinter der Hand vermutet: Dat oß wärm affjerosse wore (Das wurde warm abgerissen = Brandstiftung). Dohn dech wärm aan ist der Rat, sich warm zu kleiden, ist aber ebenso die Empfehlung, sich nicht unvorbereitet in eine heikle Situation zu begeben. Dä Schäng hät jät aan de Fööß, dä moßte dir wärmhale war (und ist) der Hinweis an die Tochter, den gut situierten Freier nicht mehr „aus den Fängen zu lassen.“ Und eine Mahnung zur Nächstenliebe besagt: Wenn´t bie dir schön wärm oß, dann denk an dä, dä ärm oß (Wenn´s bei dir schön warm ist, dann denk an den, der arm ist).
Wasserkall
Kall ist das Eifeler Dialektwort für „Rohr“ oder „Rinne,“ die Daachkall (Dachrinne) beispielsweise oder die Düwelskall (Felshöhle im Waldbereich „Urbach“ bei Nonnenbach). Die Wasserkall war früher ein Bestandteil des Fensters, so seltsam das auch klingt. Die Wärmedämmung der Fenster war damals, bedingt durch die einfachen und dünnen Rütte (Glasscheiben) sehr gering, bei Minusgraden im Freien gefror drinnen über Nacht die Luftfeuchtigkeit zu prächtigen „Eisblumen,“ die beim späteren Abtauen Wasserlachen auf dem Fensterbrett zurückließen. Um das zu verhindern, wurde dicht auf dem Fensterbrett eine muldenartig ausgefräste Holzleiste an den Fensterrahmen geschraubt. Diese Wasserkall fing die Nässe auf. Die Rinne war in der Fenstermitte geringfügig vertieft, so dass sich hier das Wasser sammelte und durch ein zentimeterdickes Bleirohr nach außen abgeleitet werden konnte. Das Bleirohr bezog der Schreiner als Meterware, die Ableitung führte schräg abwärts durch den Wasserschenkel (unterer Teil des Fensterrahmens) nach außen. Das Blei sollte ein Zufrieren des Röhrchens verhindern, was aber bei größerer Kälte nicht klappte. Vielfach war auch nach wiederholtem Anstrich der „Abfluß“ durch Lackfarbe verstopft. Die Wasserkall war kaum mehr als ein Behelf, nix Haleves on nix Janzes, wie der Eifeler sagt. An unseren heutigen Isolierglasfenstern ist eine Wasserkall nicht mehr erforderlich, weil es hier auch keine Eisblumen mehr gibt.
Wedmann
Regional auch Widmann“ oder Witmann,“ ist das Wort für den Witwer, sein „Gegenstück“ ist die Wedfrau. Um den Wedmann ranken sich mancherlei Verzällcher und Anekdötchen. Da war beispielsweise die Ehefrau von Mänes (Hermann) gestorben, nach dem Trauerjahr heiratete Wedmann Mänes kurzentschlossen die Schwester der Verstorbenen und meinte auf die Frage, warum er denn ausgerechnet seine Schwäjesch (Schwägerin) geheiratet habe: Ech well mech en mengem Alter net noch an en nöü Schwiejermoder jewenne mosse (Ich will mich in meinem Alter nicht noch an eine neue Schwiegermutter gewöhnen müssen). Noch heute kursiert bei uns ein Ausspruch unseres unvergessenen Gastwirts und Witwers Peter Schmitz (Krämesch Pitter), der ob seiner, oft absichtlich fabrizierten „Versprecher“ geradezu berühmt war. Im Verlauf einer freundschaftlichen „Fopperei“ meinte Pitter verschmitzt: Ihr konnt wahl mom ärme Jeck dr Wedmann maache (…mit einem armen Narren den Witwer machen), was natürlich real ...mom ärme Wedmann dr Jeck maache heißen sollte. Der „Strohwitwer“ wird in unserem Dialekt zum Strühwitwer und nicht etwa zum Strühwedmann. Unser Wedmann heißt in Holland „weduwnaar.“
Week
Die Eifeler Week ist alles andere als die englische „week“ und wird auch nicht „wiek“ gesprochen. Eine Verbindung zur englischen Sprache besteht aber vermutlich doch, denn Week wurde bei uns der Lampendocht genannt und der wiederum heißt auf Englisch „Wick“. Im Krieg, als wir keinen elektrischen Strom hatten, waren wir auf die Stejnollichslüech (Petroleumlampe) als Lichtspender angewiesen. Deren Week verkohlte nach längerem Betrieb am Brennerrand und musste mit einer besonderen Schere „geschneuzt“ (gereinigt, beschnitten) werden. Wenn die Lüech nur noch funzelte, meinte unsere Jött ärgerlich: Dräh ens die Week jät erop, die moß jeschneuz were (Dreh den Docht mal etwas hoch, der muss geschneuzt werden). Das Schneuzen in diesem Zusammenhang erregte stets unsere Heiterkeit, weil wir den Ausdruck eigentlich nur mit dem Naseputzen in Verbindung brachten. Der Lampendocht war übrigens in Eifeler Mundart weiblichen Geschlechts: Die Week. Zu meiner aktiven Zeit bei der DB wurden die mechanischen Signale noch durch Petroleumlampen beleuchtet, die täglich zu pflegen waren. Es gab eine besondere „Vorschrift über die Reinigung und Pflege der Signallaternen“ und darin stand unter anderem beschrieben, wie weit der Docht aus dem Brenner herausgedreht werden durfte und wie er zu schnäuzen war. Die tägliche Lampenpflege war beinahe ein Ritual. Die Petroleumlampen wurden später durch Propangasbeleuchtung ersetzt.
Wehrries
Hochdeutsch „Wehrreis,“ bezeichnet ein früher übliches Sperrzeichen an Feld- oder Wiesenflächen. Es verbot (wehrte) in erster Linie das Beweiden durch Wanderschafherden und Weidevieh, aber auch das Befahren etwa mit dem Ackerwagen und das Aufsammeln von Getreideähren. Der Ausdruck Wehrries war ausschließlich in Blankenheimerdorf üblich (Rheinisches Wörterbuch Band 9 Spalten 355/56), allgemein gebräuchlich war die Bezeichnung Strühwösch oder auch Strühwöüsch (Strohwisch). Das Wehrries war ein in die Erde gesteckter mannshoher Stock, an dem ein Bündel Stroh oder Ginster befestigt war. Gelegentlich benutzte man auch einen belaubten Ast aus dem nächsten Busch, ein Ries (Reis) also, daher der Name Wehrries. Der Strohwisch und damit auch das Wehrries waren noch um 1900 als rechtsverbindliches Zeichen in den Feldpolizeiverordnungen der Länder festgeschrieben. Der Feldhöder (Feldhüter, Flurwächter) behielt die Wehrrieser in seinem Bereich stets aufmerksam im Auge. Er besaß zwar keiner polizeiliche Befugnis und durfte schon gar keine Waffe führen, einem „Feldsünder“ konnte er unterdessen enorme Schwierigkeiten bereiten (siehe: Feldhöder).
Weich
Der Weich war früher unser Mundartwort für den „Weg,“ das allerdings inzwischen weitgehend durch den landläufigen Wääch ersetzt worden ist. Nur ein paar Senioren verwenden noch die alten Namen, Nonnebaacher Weich beispielsweise, Dörfer Weich oder Horbröcker Weich (heute Olbrücker Weg). Die Mehrzahl war interessanterweise auch früher Wäëch, das Wort kennen wir heute noch. Die Weich gibt es im Gleisbau bei der Bahn: Die Weiche. Weiche stoppe (weiches o, = Weichen stopfen) war früher eine unbeliebte Aufgabe der Rottenarbeiter. Ein Bahnhofschef fragte den Neuling beim Dienstantritt, was eine Weiche sei, und der Jungwerker meinte nach einigem Überlegen: „Eine Weiche ist keine Harte“ (eine uralte Amtsleherweisheit aus dem Dienstunterricht). Die Weich bedeutet bei unseren Nachbarn in Nettersheim, neben der Schienenweiche, auch „Woche.“ Dat wiëd sech noch dr Weich wiese (wörtlich: Das wird sich noch den Weg weisen) ist eine althergebrachte Redewendung beim Streitgespräch und bedeutet soviel wie „es wird sich noch herausstellen, wer Recht hat.“ Eine weitere Redewendung ist ejneweich (wörtlich: ein Weg) in der Bedeutung von „sowieso, ohnehin.“ Beispiel: Du fährs jo ejneweich noo Blangem, do könnste mir jät üß dr Apthek motbrenge (Du fährst ja ohnehin nach Blankenheim, da könntest du mir etwas aus der Apotheke mitbringen).
Weisch
Weisch war und ist auch heute noch unser Begriff für alles, was irgendwie mit „Wäsche“ und „waschen“ in Zusammenhang steht, beispielsweise Weischdroht (Waschdraht = Wäscheleine). Im Eifelhaus, wo es noch keine Wasserleitung gab, wurde morgens die emaillierte ovale Weischschepp (wörtlich Waschschöpfe = Waschschüssel) mit ein paar Litern Wasser beschickt: der Tagesvorrat zum Händewaschen für alle Hausbewohner. Wasser musste mühsam vom Bach herauf geschleppt werden, man ging sparsam damit um. Am Weischdaach (Waschtag) wurde die Kauchweisch (Kochwäsche = Weißwäsche) auf der Wiese vor dem Haus op de Blejch (auf die Bleiche) gelegt, wir Pänz hatten darüber zu wachen, dass unsere frei laufenden Hühner nicht auf die weiße Pracht gerieten. Sichtlich wütend schladerte (blätterte) Mattes eine Weile im dicken Kochbuch herum, bis Drinche schließlich neugierig wurde: Wat söökste dann eijentlich? Mattes knallte das Buch auf die Tischplatte: Alles Mööchliche schrievense do, äwwer wie mr Weisch kauch, dat steht net dren (Alles Mögliche wird da beschrieben, nur nicht wie man Wäsche kocht). Wenn wir mit dreckelich Hänn (schmutzigen Händen) nach Hause kamen, hatte unsere Jött eine weisen Spruch parat: Dafür oß et Weische joot (Da hilft das Waschen).
weische
Wie bereits erwähnt, gingen unsere Eltern sparsam mit dem Trinkwasser um (siehe: Weisch), weil das kostbare Nass mühsam vom Lohrbach herauf geschleppt werden musste. Dadurch bedingt, nahm man es mit der täglichen Körperpflege nicht immer so ganz genau. Es gab keine Wasserleitung und keine Badewanne im Haus, zur Samstagsreinigung stiegen wir Pänz in die große Weischbütt (Waschbütte aus Zinkblech), an den übrigen Wochentagen ging es mit dem Weischlappe (Waschlappen) mehr oder weniger dönn drüwwer (dünn drüber = Schnellwäsche). Pflicht war allerdings vor jedem Essen das Händewaschen, Jött vergewisserte sich mit konstanter Gewissenhaftigkeit: Häste dir och de Hänn jeweische (Hast du dir auch die Hände gewaschen). Wenn ein elterlicher Befehl nicht postwendend befolgt wurde, hieß es drohend: Kannste wier net hüere! Ech moß dir wahl noch ens de Uhre weische (Kannst du wieder nicht hören! Ich muss dir wohl wieder mal die Ohren waschen). Uhre weische war gleichbedeutend mit Kopp weische (Kopf waschen) und das wiederum konnte peinlich werden. Ein drastischer Hinweis auf mangelnde Sauberkeit ist die Aufforderung: Weisch dir ens dr Hals, dann bruchste dech Karneval net ze maskiere, - ein gewaschener Hals als Maske ist nicht jedermanns Sache. Die Vergangenheitsformen von weische sind übrigens woosch (wusch) und jeweische (gewaschen).
Weischkeißel
Der Weischkeißel war der früher unentbehrliche, heutzutage weitgehend überflüssige Waschkessel, das „Lieblingsgerät“ der Hausfrau. Ursprünglich war es ein möglichst großer Topf, der auf dem Herd erhitzt wurde, beispielsweise der Apperatekeißel (Einkoch- Einweckkessel), der als Universalgerät für alle umfangreichen Kochprozeduren Verwendung fand. Fürs Wäschekochen war er allerdings eigentlich zu klein. Wer es sich leisten konnte, der legte sich einen speziellen ortsfesten Weischkeißel zu. Das war in der Regel ein aus Schamotte gemauerter kreisrunder zweiteiliger Ofen. Im Unterteil befand sich die Feuerung, die mit Holz oder Kohlen beschickt wurde, das Oberteil enthielt den eigentlichen Kochkessel mit einem gut schließenden Deckel. Der Kesseleinsatz hatte einen Durchmesser von etwa einem Meter, war aus Kupfer und besaß einen Ablasshahn zum Entleeren. An der Rückseite des Oberteils wurde die Oëwespief (Ofenrohr) für die Rauchableitung in den Kamin aufgesteckt. Mangels einer besonderen Weischköch (Waschküche) stand bei uns daheim der Weischkeißel im Huus (Küche) unter dem offenen Kamin. Alte Weischkeissele (Mehrzahl) findet man heute gelegentlich als Blumenbehälter in Vorgärten und Anlagen.
Weischkomp
Auch dieser Begriff stammt noch aus der Zeit, als es keine Wasserleitung gab. Der Weischkomp war die Waschschüssel oder Waschschale, die es sowohl im bäuerlichen Schlafgemach als auch im vornehmen Hotelzimmer gab und deren Beschaffenheit dem Geldbeutel ihres Besitzers angepasst war. Komp bedeutet in erster Linie Topf oder Pott, ist also in unserem Dialekt männlichen Geschlechts, der Weischkomp war somit eine große und tiefe Keramik- oder Emailleschüssel, zu der ein ebenso großer, um die fünf Liter fassender Wasserkrug gehörte, der aus unerfindlichen Gründen „Lampett“ genannt wurde. Ein Lampett ist normalerweise eine kleine Lampe. Den Wasserkrug gab es, wie auch die Lampen, in allen erdenklichen Formen, möglicherweise besteht hier ein namensgebender Zusammenhang. In Holland heißt unser Lampett „lampetkan“ (Wasserkrug). Ein Sejfekömpche (Seifenschüsselchen) und Schalen für Kamm, Haarbürste und Zahnpflege vervollständigten das Ganze zur kompletten Weischjarnitur (Waschgarnitur). Bei uns daheim stand der Weischkomp mit Zubehör im Schlafzimmer auf dem von Vater geschreinerten Weischdesch (Waschtisch), der sogar eine massive Platte aus weißem Marmor besaß.
Wejerberch
Übersetzt : Weiherberg, ein spezieller „Dörfer“ Ausdruck, Flurbezeichnung am nördlichen Ortsrand an der Straße „Im Weiher,“ deren Verlängerung als befestigter Wirtschaftsweg über die Wejerberchbröck (Brücke) die ehemalige Ahrtalbahn überquert. Neben dem zur Brücke führenden Straßendamm lag bis zur kommunalen Neuordnung die örtliche Müllkippe, die den nächsten Anliegern ein ständiger Dorn im Auge war. Im Jahr 1954 ließ Bürgermeister Schang(Johann) Leyendecker wegen der dauernden Proteste auf der Müllhalde Rattengift auslegen und bestellte bei meinem Vater Vossen-Hein ein entsprechendes Warnschild für die Kippenbenutzer: „Vorsicht, Rattenköder ausgelegt.“ Ich selber habe stundenlang über der Beschriftung geschwitzt. Monatelang prangte das Schild auf dem Müllberg, der Ratten wurden aber immer mehr, woraus clevere Zeitgenossen den Schluss zogen, dass es sich wohl um Leseratten handeln müsse, die der deutschen Schrift mächtig seien und sich entsprechend der Schilderwarnung vor dem Gift in Acht nähmen. Auf der eingeebneten Müllhalde wird seit vielen Jahren am Kirmessamstag das Martinsfeuer abgebrannt, Blankenheimerdorf feiert die so genannte „Martinskirmes“ als eines der letzten Volksfeste im Jahresablauf.
Wellem (weiches e, nicht „wällem“)
Der Männername Wilhelm wird heute überwiegend nur noch in offiziellen Dokumenten und Urkunden verwendet, im Alltag wird er mehr und mehr in „Will“ oder „Willi“ abgewandelt. Für unsere Eltern gab es eigentlich nur den Wellem, beispielsweise Kaiser Wellem (Wilhelm II). Die niederländische Form von Wilhelm ist „Willem“ oder „Wim,“ sie wird vereinzelt auch bei uns angewendet. Unvergessen ist zum Beispiel Wim Thoelke, der in 1995 verstorbene deutsche Showmaster. Ein bekanntes Dörfer Original lebte um 1900: Der Wanderschuster Wilhelm Pfingsten, genannt Stombs Wellem, der wegen seines Humors und seiner Erzählkunst in der halben Eifel bekannt und beliebt war (siehe: Stombs Wellem). Hupperes Wellem (Willi Hoffmann) war lange Jahre „Feuerwehrchef“ von Blankenheimerdorf und gehört heute (2013) der Ehrenabteilung an. Pickartze Wellemche (Wilhelm Pickartz) war im Krieg Ortsbürgermeister von Blankenheimerdorf, er war klein von Gestalt, daher die „Namensverkleinerung.“ Nellesse Wellem (Willi Nelles) war nach Toni Wolff Ortsvorsteher von Blankenheimerdorf. Ejche Wellem (Wilhelm Eich) war mein Bundesbahnkollege und mittelbarer Nachbar. Das Namensfest des heiligen Wilhelm ist der 28. Mai, daraus hergeleitet ist das Scherzwort: Am aachonzwanzichste Wellem os Mai.
Wellstejn
Übersetzt „Wellstein,“ richtiger wäre „Wellenstein.“ Der Wellstejn war ein „Rad“ aus feinkörnigem Sandstein, ähnlich einem Mühlenstein, mit beliebigem Durchmesser und entsprechend angepasster Dicke. Es drehte sich auf einer meist hölzernen waagerechten Welle, die auf ein stabiles Balkengestell montiert war und durch eine Handkurbel angetrieben wurde. Das Ganze war eine Schleif- und Schärfvorrichtung für Werkzeuge aller Art. Den Wellstejn gab es in fast jedem Bauernhaus, elektrische Schärfmaschinen kannte man bei uns noch nicht. Oft drehte sich der Stein in einem handhohen Wasserbad, mit dreifachem Vorteil: Der Materialabrieb wurde ständig fortgespült, dadurch blieb die Griffigkeit des Steins erhalten, und schließlich war eine gewisse Kühlung gewährleistet, die besonders bei empfindlichen Werkzeugen erforderlich war. Der Nachteil beim Wellstejn: Zum Schärfen waren zwei Personen erforderlich, ein „Schleifer“ und ein „Schwengeldreher,“ der bei etwa fehlendem Wasserbad gleichzeitig die „Spülung“ von Hand übernahm. Die Vorteile des Nass-Steinschärfens: Grobes Gerät wie Axt und Schällmetz (Schäleisen) des Waldarbeiters wurde ebenso rasiermesserscharf wie das empfindlichste Küchenmesser, und das verderbliche „Verbrennen“ (Anglühen) der Schneide war so gut wie ausgeschlossen.
wenne
Das Wort bedeutet „wenden“ im Sine vom „umdrehen“ in allen denkbaren Varianten, darüber hinaus auch „um etwas bitten.“ Bekannt ist unter anderem Du kanns et drähe on wenne wie de wells (Du kannst es drehen und wenden wie du willst), oder auch Wenn dech ens aan dr Pastuër (Frag mal den Pfarrer um Rat). Heu wenne (Heu wenden = das Mähgut mit dem Handrechen umdrehen) war früher eine mühsame und zeitraubende Handarbeit bei der Heuernte. Die halbe Hausbewohnerschaft war dabei im Einsatz, auch wir Pänz mussten anpacken. Das Imperfekt von wenne ist wandt, wird aber so gut wie nie gebraucht, ech wandt et Heu ist geradezu ein Unding, wir sagen in jedem Fall ech han et Heu jewandt. Analog dazu auch das geflügelte Wort Et Blättche hät sech jewandt (Das Blatt hat sich gewendet). Die Form jewennt war und ist das Wort für „gewöhnt:“ Ech sen dran jewennt (Ich bin daran gewöhnt). Wenne (mit weichem e gesprochen) war der heute vergessene Ausdruck für „gewinnen,“ Beispiel: Wä net wooch, dä net wennt (Wer nicht wagt, der nicht gewinnt). Ein kleiner Zungenbrecher: Wennde dat Heu net wenne wells, dann wenn dir och dat Schänne aff on wenn dech aan dr Heer (Wenn du das Heu nicht wenden willst, dann gewöhne dir auch das Schimpfen ab und wende dich an den Herrn).
Wessboum (weiches e)
Den Wessboum, lokal an der Oberahr auch Wissboum genannt, gab es früher in jedem kleinbäuerlichen Betrieb, es war der „Bindebaum“ zum Stabilisieren der Heu- und Getreideladung auf dem Leiterwagen. Das lange Rundholz wurde am Vorderteil des Wagens in ein leiterartiges Gestell oder in eine Spannkette eingehakt, lang über die Ladung gezogen und am Wagenheck mittels Seil und Vrejdel (Spannholz) am Drähboum (Drehbaum am Wagenboden) festgezurrt. In älteren Lexika findet sich noch der Begriff „Wiesbaum.“ Wessboum war und ist auch unsere Bezeichnung für den Nachbarort Wiesbaum in Rheinland-Pfalz bei Dollendorf. Lokal ist auch Wessböüme gebräuchlich, in Wiesbaum selber und in der näheren Umgebung ist Wisbe üblich. In früheren Jahren war die Ortschaft wegen ihrer „Streiche“ bekannt, Wessböümer Strejch oder auch Wisber Strejch ist auch heute noch hier und da die Umschreibung für eine besonders „gescheite“ Angelegenheit, vergleichbar mit den „Schildbürgerstreichen.“ Wiesbaum gehört heute (2013) zur Verbandsgemeinde Hillesheim in der Vulkaneifel, im Jahr 2004 feierte die Ortschaft ihr 1200-jähriges Bestehen. Das kleine Bauerndorf von einst hat sich inzwischen längst zum Industriezentrum entwickelt.
Wessböümer Strejch
Was für Schilda die „Schildbürgerstreiche,“ das sind an unserer Oberahr die Wessböumer Strejch (Wiesbaumer Streiche), deren es eine ganze Anzahl im Volksmund gibt, Schmunzelgeschichten, die hier und da eine Ähnlichkeit mit den Schildbürgerstreichen erkennen lassen. Zum Beispiel die neue Kirche ohne Eingangstür und das in den Bach gefallene Bischofswort, die Geschichte vom „Hasenweiher“ oder die „Stiersaat,“ das Ausbrüten von Eselseiern oder der „Gewitterkauf.“ Über den „Maushund“ gab es sogar ein „Lesestück“ in unserer Volksschule. Der Spottname für die Wiesbaumer ist „Kuckuck.“ Meinen Vater Heinrich, gebürtig aus Wisbe, brachte dieser Spottruf, dem ein Wisböümer Strejch zugrunde liegt, zur Weißglut. Einst war in Wiesbaum die Kornernte miserabel, in Hillesheim dagegen strotzten die Ähren vor Frucht. Die Wiesbaumer Ratsherrn fanden den Grund dafür: In ihrem Dorf rief kein Kuckuck, während beim Nachbarn gleich zwei zu hören waren. Also kaufte man den Hillesheimern einen der beiden „Kornrufer“ ab und siehe da, ab dem nächsten Jahr gediehen auf den Wiesbaumer Feldern die prächtigsten Ähren. Es heißt, dass tatsächlich die Wiesbaumer bis Anfang des 19. Jahrhunderts alljährlich „Kuckuckshafer“ nach Hillesheim geliefert hätten.
Wirwel
Der mundartliche Wirwel war ein selbstgefertigter hölzerner Verschluss an Türen, Fenstern, Möbelstücken oder Truhen, eine Art Riegel oder Feststeller mit der offiziellen Bezeichnung „Vorreiber,“ der heute noch in den verschiedensten Formen aus Metall hergestellt wird. Wirwel ist abgeleitet von „Wirbel“ und deutet auf eine Drehfunktion hin. Tatsächlich war der Wirwel in der Regel zum Ver- oder Entriegeln drehbar, gelegentlich wurde aber auch der hölzerne Schiebeverschluss als Wirwel bezeichnet. Unsere beiden schmalen Huusfenstere (Küchenfenster) daheim besaßen als Verschluss einen Wirwel. Eins der Fenster wurde nie geöffnet, der Wirwel war im Lauf der Jahre durch wiederholtes Lackieren des Fensterrahmens festgeklebt und nicht mehr drehbar. Auch unsere Kellertür wurde durch einen, auf den Rahmen geschraubten massiven Holzwirwel verschlossen, ein richtiges Schloss gab es nicht. Gelegentlich bezeichnete man auch ein wirres Durcheinander, einen Wirbel also, ebenfalls als Wirwel. So wurde beispielsweise beim Dreschen die Binderkoët (Bindegarn des Mähbinders) gesammelt, weil sie im Alltag wieder verwendet werden konnte. Die Fäden bildeten ein wirres Knäuel und ich wurde beauftragt: Sortier dä Wirwel Binderkoët üßenanner.
nach oben
zurück zur Übersicht
|