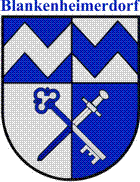|
taaste
Eine alte Eifeler Behauptung verkündet ziemlich hintergründig: Wo mr nix sitt, os et Taaste net verbodde (Wo man nichts sieht, ist das Tasten nicht verboten). Der Tastsinn des Menschen ist eine wichtige Orientierungshilfe, Ertasten kann in manchen Fällen spannender sein als in Augenschein nehmen. Taaste bedeutet allgemein „tasten, erfühlen,“ im übertragenen Sinn aber auch „einen mehr oder weniger guten Griff tun.“ Wer beispielsweise fünf Richtige im Lotto erwischt hat, der hat ene joode Taas jedohn (wörtlich: einen guten Taster getan). Der Eifeler sagt allerdings in diesem Fall eher ene jode Tööp jedohn, was soviel heißt wie „den Finger auf dem richtigen Loch haben). Häste menge Brell net jesehn ! Zum wiederholten Mal durchwühlte Vater die Hobelbankablage, fand aber seine Brille nicht. Zufällig kam Mutter an der Werkstatt vorbei, stutzte und Hein, taas dir ens aan dr Kopp (fühl dir mal an den Kopf) hätte sie besser für sich behalten. Immerhin, die Brille war gefunden. Eine unhygienische Kundengepflogenheit im Supermarkt ist das Betaaste am Obst- und Gemüsestand, das man treffender als Betatsche bezeichnen sollte. Salatköpfe, Tomaten, Äpfel und Gurken werden durch mehr oder weniger saubere Hände befummelt und malträtiert, – schließlich will man ja wissen, ob man auch frische Ware kauft. Gut und schön, wenn aber die Ware schließlich durch hundert Hände gewandert ist, wer kauft sie dann noch!
.
Taat
Das Mundartwort weckt Erinnerungen an leibliche Genüsse. Es wird auf Französisch „tarte“ geschrieben und der Holländer sagt „taart“, gemeint ist in jedem Fall die Torte. Die Eifeler Taat nahm und nimmt eine Sonderstellung ein, bekannt ist das Zitat Prommetaat un Appeltaat, alles weed parat jemaad aus dem Kölner Raum. Pflaumen- und Apfeltorte waren ein Muss beim häuslichen Kirmesback (Festtagsbackwerk), der nicht selten aus 20 und mehr Taate bestand und zu dem auch der eine oder andere Streukooche (Streuselkuchen) gehörte. Der absolute Renner war indessen die Jreeßtaat (Grießtorte), deren zentimeterdicker Belag auch nach Tagen noch nichts an Vorzüglichkeit eingebüßt hatte. Taat wurde ausschließlich zu besonderen Anlässen oder Festtagen gebacken, zur Kirmes beispielsweise oder anlässlich einer Hochzeit. Die Anzahl der etwa 30 Zentimeter durchmessenden Köstlichkeiten richtete sich nach der Zahl der zu erwartenden Gäste, oft hatte die Hausfrau einen ganzen Tag lang mit dem „Back“ zu tun. Der heimat- und standesbewusste Eifelbäcker stellt heute noch Taat wie zu Großmutters Zeiten her und findet dankbare Kunden.
Taatebär
Ein ziemlich wundersames und schwer erklärbares Wort, ins Hochdeutsche übersetzt bedeutet es „Tortenbär“ und ergibt auf den ersten Blick so gut wie gar keinen Sinn. Zieht man aber in Betracht, dass die Eifeler Taat oder Tart in erster Linie den landestypischen runden und breitflächigen Fladenkuchen bezeichnet, kommt man der Sache ein Stück näher. Taatebär nämlich ist ein gutmütiges Spottwort für eine etwas „in die Breite gegangene“ Person, die meistens auch noch ein ebenso gestaltetes Antlitz ihr Eigen nennt. Überwiegend sind die Taatebären weiblichen Geschlechts, doch gibt es auch männliche Ausnahmen. Taatebär ist generell nicht abwertend oder gar verletzend gemeint wie beispielsweise Fettsack oder Bonnestang (Bohnenstange). Im Gegenteil: Die Eifeler Taat enthält in jedem Fall einen „süßen Kern“ und der haftet auch dem Taatebär an. Trotzdem lässt sich verständlicherweise niemand gerne mit einer Taat vergleichen. Häufig sind die genannten Personen auch noch etwas tapsig und tollpatschig in ihren Bewegungen. Das bringt der Zusatz Bär zum Ausdruck, der sich auf den, früher auf jedem Jahrmarkt zu sehenden „Tanzbären“ bezieht.
Tafel
Das Wort ist identisch mit dem hochdeutschen Begriff und bezeichnet all das, was es auch in der Standardsprache definiert. Die Tafel Schokolade beispielsweise war zu unserer Kinderzeit nicht weniger begehrt als heute; die Holzfüllung in Tür- oder Möbelflächen nannte man Tafel oder auch Spejel (Spiegel); die Glasplatten, aus denen er die Fensterscheiben schnitt, nannte der Dorfschreiner Tafeljlas, und der braune Holzleim wurde in kleinen Tafeln hergestellt und hieß daher Tafelleim. Wenn unterdessen bei uns de Tafel (die Tafel) in Erwähnung kam, dann war damit unabdingbar unsere Schiefertafel gemeint, das Universal-Schreibutensil der damaligen Volksschulen. Die gängige Schiefertafel war etwa 30 mal 20 Zentimeter groß und besaß einen schön lackierten Holzrahmen, an dem mit einer Schnur ein kleiner Schwamm und das zugehörige Tafelläppche befestigt waren. Die Vorderseite unserer Tafel war mit Vierfach-Schreiblinien für die Sütterlinschrift ausgestattet, die Rückseite wies zentimetergroße Reichenhüüsjer (Rechenhäuschen) auf. Sütterlin wurde uns im ersten Schuljahr noch beigebracht. Unser Schreibstift, das war ein dünner und hochzerbrechlicher harter Schiefergriffel, der mit der Zeit auf der Tafelfläche tiefe Kratzspuren hinterließ. Transportmittel für unsere Tafel war der Schulranzen, vom Dorfschuster aus massivem Leder angefertigt. Der Ranzen wurde bei gelegentlichen Raufereien als Schlag- und Verteidigungsgerät zweckentfremdet. Dabei ging in der Regel die Schiefertafel zu Bruch, und das wiederum hatte empfindliche „Nachwehen“ im elterlichen Heim zur Folge.
Tafelläppche
Das Tafelläppche (siehe Tafel) war für uns Schollpänz (Schulkinder) ein notwendiges Übel: Zum Reinigen unserer Schiefertafel war es unerlässlich, im Übrigen aber ein lästiges Anhängsel, das am Tafelrahmen baumelte und beim Schreiben ziemlich hinderlich sein konnte. Noch unbequemer war das feuchte Schwämmche (Schwämmchen), das hier und da an einer zweiten Schnur neben dem Tafelläppche baumelte und zum Löschen der Schrift bestimmt war. Das Läppche wurde als Putztuch zum Trockenwischen benötigt. Meistens gab es unterdessen als Behälter für den Schwamm die verschließbare Schwammdoos (Dose), in der sich die Feuchtigkeit längere Zeit hielt. Das Tafelläppche bestand beim Durchschnittsschüler aus einem mehrlagigen Tuchfetzen, in der „gehobenen“ Klasse war es vom Mam (Mutter) gehäkelt und besaß einen schönen farbigen Rand. Schwamm und Läppchen bedurften der täglichen Reinigung, die aber nicht immer beibehalten wurde. Der ausgetrocknete Schwamm und das verseffte Läppche hinterließen auf der abgewischten Schiefertafel einen grauen Schleier, den man heimlich, aber vergeblich mit ein wenig Spucke zu beseitigen trachtete. Ähnlich wies auch die große Schultafel tagelang einen weißlichen Kreidebelag auf. Bis es dem Lehrer zu bunt wurde und einer der „Großen“ aus den hinteren Bänken beauftragt wurde: Jetzt mach mal endlich die Tafel sauber,“ und das bedeutete dann gründliches Abwaschen, - eine unbeliebte Schüleraufgabe.
Take
Der Ausdruck hat mit dem englischen Allerweltswort „take“ absolut nichts gemeinsam. Der Take war im Eifeler Bauernhaus unserer Vorfahren eine Art Heizung: Die steinerne Feuerwand zwischen dem offenen Herdfeuer und der Stovv (Stube, Wohnzimmer) war durchbrochen und diese Lücke mit einer entsprechend großen Gusseisenplatte verschlossen. Diese Takeplaat (Platte) übertrug die Herdfeuerwärme in den Nebenraum. Dort war die Aussparung in der Wand durch den Takenschrank überbaut, dessen Unterteil mehrere Öffnungen zur Wärmeregulierung enthielt. Gelegentlich waren über dem Take auch alkovenartige Wandbetten eingebaut, in denen es sich besonders gemütlich ruhen ließ. Mein Onkel Aegidius Weber aus Esch (bei Jünkerath, Rheinland-Pfalz) wusste seinerzeit eine Legende zu erzählen, wonach die Heiligen Drei Könige auf ihrer Reise nach Bethlehem in einem bestimmten Haus in Esch in Takenbetten übernachtet hatten. Takenplatten wurden unter anderem auch in der Eifeler Eisenindustrie hergestellt. Dr. Jakob Flosdorff aus Kall war Experte für Takenfragen und hat sich seinerzeit in der Eifel als Takendoktor einen Namen gemacht. Takenplatten sind heute begehrte Sammelobjekte. Beim Umbau unseres Hauses aan Muuße in Blankenheimerdorf wurde eine Takenplatte entdeckt, sie ist heute am Haus unseres verstorbenen Arztes Dr. Rudolf Scholz in Blankenheim zu sehen.
tallepe
Eins von zahlreichen Dialektwörtern mit verschiedenartiger Bedeutung. Allgemein bekannt ist tallepe als Wort für plan- und zielloses Wandern oder Umherlaufen, Daherstolpern. Ein Beispiel hierfür findet sich im Liedgut des Kölner Karnevals: Wejste wat, mir fahren en de Alepe…wenn mir dann esu durch de Alepe tallepe… Auch unsicheres oder tastendes Gehen wird mit tallepe beschrieben: Dr Strom wor fott on ech moot em Düüstere tallepe. Drinche hatte im Nachbarort etwas zu besorgen und meinte verdrießlich: Ech moß noch ene Tallep noo Blangem dohn. (einen Gang nach Blankenheim machen). Kopfschüttelnd betrachtete Mam die verdreckten Schuhe des Sprösslings und wetterte: Boste wier durch dr Matsch jetallep! Albertchen erschien nicht zum verabredeten Söökespelle (Suchenspielen = Versteckspiel) und seine Kameraden vermuteten: Dä oß bestemp wier aan de Knüetschele jetallep wore on daasch net erüß (beim Stibitzen von Johannisbeeren erwischt und deswegen Hausarrest). Gelegentlich umschrieb man auch eine Ohrfeige mit talepe: Du määß esu lang bos ech dir ejne talepe (frei übersetzt: Treib es nicht zu weit, sonst klebe ich dir eine).
Tant
Dr Fiffi van de Tant worr krank on kruffet dörch et Zemmer, et Höngche hau ene fulle Zank… Das ist zwar kein Dörfer Platt, wohl aber ein herrliches Gedichtchen des Alsdorfer Heimatdichters Hein Küsters. Im Alsdorfer Dialekt war, genau wie beim Dörfer Platt, de Tant durchaus nicht immer eine Verwandte, vielmehr war für uns Kinder jede ältere Frau eine Tant und wurde auch als solche angesprochen. Die Nachbarsfrau beispielsweise war nicht die Frau Klinkhammer, sondern Kaue Tant oder sogar Kaue Motter (Mutter), sofern sie verheiratet war und Kinder hatte. Analog dazu waren ältere Männer Ohme (Onkel) oder auch Vatter. Eine besonders hoch geschätzte Frau nannten wir liebevoll et Täntche und das war dann ein fester Begriff meistens im gesamten Dorf, so ähnlich etwa wie unsere Jött, die Elisabeth hieß, aber allgemein Jött genannt wurde. Meine Patentante, eine Schwester meiner Mutter, hieß Maria und wir nannten sie Tant Marie. Eine Schwester meines Vaters hieß ebenfalls Maria, zur Unterscheidung nannten wir sie Tant Marri mit Betonung des a. Eine Art „Gegenpol“ zur Tant ist die Eifeler Möhn, die wir uns eher als dunkel gekleidetes altes Weib vorstellen, vor dem die Kinder Reißaus nehmen. Den Begriff Möhn verbanden wir Kinder stets mit etwas Unangenehmem, eine Möhn konnte bei uns niemals zur Tant werden.
Tapeet
Das Wort ist fast gleichartig wie sein hochdeutsches Original, lediglich das e wird im Dialekt gedehnt und das Schluß-e „verschluckt.“ Tapeet ist offensichtlich mit dem holländischen „Tapijt“ verwandt, das aber in erster Linie „Teppich“ bedeutet. Die Tapete heißt in Holland „Behang“ oder „Behangsel,“ Behangselpapier“ beispielsweise ist Papiertapete. „Tapijt“ ist vermutlich auf die früher übliche Wandverkleidung aus Textilien oder Teppichen zurückzuführen. In unserer Kinderzeit war wegen der meist buckligen Wände das „Anstoßen“ der Tapetenbahnen kaum möglich, auch gab es nicht die heutige dauerhafte Verpackung der Rollen und deren Ränder waren oft beschädigt. Die Bahnen wurden also zentimeterbreit überlappend geklebt. Die Rollen waren an den Längsseiten mit schmalen „Schutzstreifen“ versehen, von denen einer wegen des Überlappens mit der Schere abgeschnitten werden musste. Diese Lentcher (schmale Papierstreifen) waren bei uns Kindern als Luftschlangen begehrt. Die alte Tapeet wurde meistens jahrelang nicht entfernt, die neuen Bahnen wurden einfach draufgeklebt, so dass mit der Zeit eine mehrere Millimeter dicke Schicht entstand. Beim erstmaligen Tapezieren wurden die rauen Wände dick mit Makulatur vorgekleistert oder mit Zeitungspapier beklebt. Als nach dem Krieg bei uns daheim renoviert wurde, kam unter der alten Tapete seitenweise der Westdeutsche Beobachter aus dem Jahr 1940 zum Vorschein. Die Zeitung war das im „Reichsgau“ Köln-Aachen erscheinende Propagandablatt der NSDAP.
Teek
Wie alles im Leben, so hat auch die Theke zwei Seiten, eine gute und eine schlechte. Der Eine besingt sie als den allerschönsten Platz, für den Anderen bedeutet der Schanktisch nicht selten den Anfang vom Ende. Dabei sollte man nicht übersehen, dass jeder seines Glückes – oder Unglückes – eigener Schmied ist. Die Kneipentheke war zu allen Zeiten ein „Ort der Begegnung“ meist im positiven Sinn des Wortes, aan de Teek john gehörte zu jedem Lokalbesuch dazu wie das berühmte „Amen in der Kirche.“ Man erinnert sich noch sehr gut an ganz normale Sonntags-Frühschoppen: In Dreierreihe drängten sich die Thekengäste um den Tresen, hinter dem der Wirt und seine Helfer schwitzten. Damals gab es vier Gaststätten bei uns im Dorf, und überall war Betrieb, ganz besonders bei Dorffesten, etwa zur Kirmes. Seit der Jahrtausendwende blieben immer mehr Kunden aus, einmal hockten wir sogar beim Hahnengericht am Kirmesdienstag mit sage und schreibe zwei Mann vor der Theke. Die Leute zogen die Glotze dem Kneipenbesuch vor. Heute gibt es bei uns keine Kneipe mehr, und da plötzlich vermisst man die gemütliche Thekenrunde wieder. Aan dr Teek werden gelegentlich auch sehr nützliche Ideen geboren, beispielsweise im Frühjahr 1971, als Günther Uedelhoven, Erwin Schmitz und Arthur Bertram zusammen mit Hans Klaßen den Grundstein fürs erste Dörfer Wiesenfest legten. Ein Verkaufsgeschäft wird in der Regel üwwer de Teek hinweg abgewickelt, Geheimsachen werden dagegen önner dr Teek erledigt, wo sie nur dem Eingeweihten zugänglich sind. So wunderten wir Jugendliche uns oft über ein geheimnisvolles Päckchen, das der Friseur manchem Erwachsenen verstohlen in die Hand drückt und über dessen Inhalt wir lange Zeit vergeblich rätselten.
Teisch
Die mundartliche Teisch ist eine Tasche, aber eine ganz bestimmte. Während nämlich das hochdeutsche Wort „Tasche“ für alle taschenartigen Objekte steht, bezeichnet unser Teisch ganz speziell die Tasche in der Kleidung, zum Beispiel die Botzeteisch (Hosentasche), die Jacketeisch (Jacken-, Rocktasche) oder die Schüezeteisch (Schürzentasche). Transportable Behältnisse, die Handtasche etwa, die Akten-, Einkaufs- oder Schultasche, heißen dagegen Tasch. Wer sich einem Mitmenschen überlegen fühlt, stellt fest: Dech dohn ech doch ad lang en de Teisch (Dich stecke ich doch schon lange in die Tasche), und wer seinen Zorn nicht „herauslassen“ will, der macht en Fuus en dr Teisch (eine Faust in der Tasche). Unsere Botzeteisch ist in Österreich der „Hosensack“ und an den erinnert bei uns der Begriff Sackdooch (Taschentuch). Die Jongjeselleteisch (Junggesellentasche) ist eine löcherige Hosentasche: Es ist keine Hausfrau da, die den Schaden beheben könnte. Im Kölner Dialekt wird unsere Tasch zur Täsch. Der in 2005 verstorbene Präsident der Republik Nordzypern hieß Rauf Denktasch. In Köln rätselten Tünnes un Schäl herum, was Herr Denktasch wohl für ein Landmann wäre, und Tünnes erklärte: Ene Kölsche kann et nit sin, söns heeße nämlich Denktäsch.
Teischemetz
Das Mundartwort ist allgemein verständlich: Taschenmesser. Ein robustes Teischemetz war für den Eifeler Bauersmann ein unverzichtbares Allzweckgerät, mit dem man beispielsweise die hölzernen Reichelszänn (Rechenzähne) anspitzte, die Obstbäume beschnitt, Birke schnegge (Birkenreisig fürs Besenbinden sammeln) ging oder das verrußte Sejwerdöppe (den Pfeifenkopf) auskratzte. Ein gutes Teischemetz besaß zwei Klingen verschiedener Größe und lag gut in der Hand, mehr brauchte es eigentlich nicht aufzuweisen. Weiteres Zubehör war Spellerej (Spielerei) und kostete unnötiges Geld. Wir Jungens waren indessen mächtig stolz, wenn uns das Christkind ein kleines Teischemetz mit drei oder gar fünf Werkzeugen bescherte. Der „Immerscharf“ von Ohm Mattes besaß zusätzlich zu den Klingen einen Korkenzieher und einen Piefestäucher (Pfeifenstocher). Ohm Mattes war in Norwegen bei der Kriegsmarine und brachte von dort ein Taschenmesser mit gebogener krummer Klinge mit, das heute übliche „Gartenmesser,“ das wir damals noch nicht kannten. Es eignete sich hervorragend zum Schneiden der Birkenruten und wurde zum geheiligten Birkemetz.
Telejelauch
Flur-, Orts- oder Straßennamen beruhen in der Regel auf uralten Ereignissen oder Gepflogenheiten unserer Vorfahren und sind heute nicht mehr nachvollziehbar. Eine solche Bezeichnung ist das Telejelauch in Blankenheimerdorf, ein in der Senke gelegener eng bebauter Ortsteil zwischen Tröüt und Buppeschjass, der auf Grund seiner Lage den Namenszusatz Lauch (Loch) erhielt. Telejelauch bedeutet somit auf Hochdeutsch Tilgenloch, was allerdings dort „getilgt“ wurde, das konnte offensichtlich sogar der verstorbene Pastor Ewald Dümmer nicht ermitteln, der ein großer Heimatfreund war. Vereinzelt wird vermutet, dass im Telejelauch früher ein öffentliches Gebäude stand, in dem die Bauern ihre Steuern und Abgabe entrichteten, also ihre Schulden tilgten. Eine ähnliche Einrichtung existierte beispielsweise in unserer belgischen Partnergemeinde Sint Stevens-Woluwe: Dort gibt es noch heute das Tiendeschuurveld, was übersetzt Zehntscheunenfeld bedeutet. Als seinerzeit im Zuge der kommunalen Neugliederung unsere Straßennamen vereinheitlicht wurden, wehrten sich einige Anlieger gegen die Bezeichnung Tilgenloch, der Name musste schließlich in Tilgenweg umgeändert werden. Jetzt konnten die „Lochgegner“ zwar wieder ruhig schlafen, unser Ort aber wurde um eine typische Dörfer Einrichtung ärmer. Eine ähnliche Situation entstand damals auch in unserem Nachbarort Mülheim, wo sich plötzlich alle Welt gegen die zahlreichen örtlichen „Gassen“ verwahrte. In Mülheim siegte schließlich das Traditionsbewusstsein, die Gassen blieben dem Ort erhalten und noch heute sind die Mülheimer ziemlich glücklich damit.
temptiere
De Söü han os janz Jromperestöck temptiert (Die Wildschweine haben unser ganzes Kartoffelfeld verwüstet), beschwerte sich Mattes am Stammtisch und fügte böse hinzu: Dr Düwel soll se holle. Das Eifelwort temptiere ist vom lateinischen Verb „temptare“ hergeleitet, was neben „versuchen“ auch „angreifen“ bedeutet. Beim Angriff wird in aller Regel etwas zerstört, es wird temptiert. Nach dem Krieg war in den Sägewerken Splitterholz ein gehasster und gefürchteter Begriff: Wenn die Gatter- oder Kreissäge an einen Bombensplitter im Holz geriet, war sie temptiert und in vielen Fällen nicht mehr zu reparieren. Wenn der Hammer statt des Eisennagels den Fingernagel traf, hatte man sich dr Fongernool temptiert, eine langwierige und schmerzhafte Angelegenheit. Eine weitere Bedeutung von temptiere war „drängen, bedrängen, bedrohen, drangsalieren.“ Gelegentlich wurde Tierquälerei mit temptiere umschrieben. Wer beispielsweise die Gespanntiere durch Schläge zur Höchstleistung antrieb, der war im Dorf nicht gut angesehen: Dä krommen Hond temptiert onnüedich seng Dier, dä mööd selever ens richtich temptiert were. Man wünschte also dem Schinder selber einmal Prügel auf den Leib.
Tentefaß (weiches e)
Das gute alte Tintenfass gibt es heute nur noch im Museum oder bestenfalls als Dekorstück auf Großvaters Eichenholz-Sekretär, einzelne Spezialfirmen stellen noch das mehr oder weniger kostbare Einzelstück aus Kristall, Porzellan oder Silber her, für Dekorations- oder Repräsentationszwecke. Das zeitgemäße Tintenfass von heute ist aus Kunststoff, nennt sich „Druckerpatrone,“ kostet einen Haufen Geld, und von seinem Inhalt sollte man tunlichst die Finger fernhalten: Das Zeug lässt sich nachhaltig nur mit dem Bimsstein entfernen. Noch in den 1950er Jahren gehörte das Tentefaß unabdingbar auf jeden Schreibtisch und in jeden Haushalt. Dazu gehörte ganz früher der „Gänsekiel“ als Schreibzeug, später war es dann die spitze Sütterlin-Stahlfeder, die wir Pänz noch nach dem Krieg bei Lehrer Josef Gottschalk in der Nonnenbacher Volksschule benutzten. Dazu gab es den rot lackierten hölzernen „Federhalter,“ den wir in der ebenfalls hölzernen Jreffelbüx (Griffelbüchse = Schreibzeugbehälter) im Schulranzen mitführten. Jeder Platz unserer fünfsitzigen langen Schulbänke war oberhalb der schrägen Schreibplatte mit einem Tentefass ausgestattet. Der kleine Behälter war in die Tischplatte eingelassen, bestand aus Blei und fasste zwei bis drei Fingerhüte voll Tinte. Der eigentliche „Pott“ war durch einen Schiebedeckel verschließbar, dennoch war der Inhalt in der Regel eingetrocknet. In das weiche Bleigehäuse konnte man mit dem harten Schiefergriffel schöne Figuren und Wörter einritzen, was aber der Lehrer nicht so gerne sah. Lehrer Gottschalk besaß zwei viereckige Tentefasser (Plural) aus Glas, eins für die blaue Normaltinte, das andere für die rote Korrekturflüssigkeit.
Termesflasch
Auch dieses Mundartwort ist der Standardsprache entnommen: Thermosflasche. Die Termesflasch unserer Kindertage war etwa 10 Zentimeter „dick“ und besaß eine farbige Ummantelung aus geripptem Stahlblech. Die Füll- und Ausgussöffnung war vier bis fünf Zentimeter groß und durch einen passenden Korken verschließbar. Über den Korken wurde et Scheppche (kleiner Becher aus Aluminiumblech) geschraubt, das als Trinkgefäß diente. Der doppelwandige gläserne Kühlbehälter besaß am Boden ein zentimeterlanges dünnes Zäpfchen. Das war die Verschlussstelle des Vakuums und der neuralgische Punkt der Termesflasch: Zum gelegentlichen Säubern musste der Isoliereinsatz durch Abschrauben des Halteringes am Flaschenhals aus der Hülle entfernt werden. Dabei genügte eine winzige Unachtsamkeit und das Zäpfchen brach ab. Die Flasche war dann zwar noch dicht, aber die Isolierwirkung war weg. Der gerippte Blechmantel der Termesflasch war in der Regel schön bunt gefärbt, die von Ohm Mattes beispielsweise war grün, die von Vater war blau. Nach dem Krieg wurde in vielen Fällen die empfindliche Termesflasch durch die strapazierfähige Möüt Metallflasche) ersetzt, Vater hat noch jahrelang seine mit Filz isolierte Wehrmachts-Feldflasche benutzt.
tespetiere
Das Wort ist unverkennbar von „disputieren“ abgeleitet. Der „Disput“ ist bekanntlich ein heftiges Wortgefecht oder ein Streitgespräch, manchmal wird für nix on wier nix tespetiert (für nichts und wider nichts geredet). Wenn eine langdauernde Wortfechterei ergebnislos verläuft so ist das ene onnüedije Tespetier (unnötiges Gerede). Wenn man einem Streitgespräch aus dem Weg gehen will, gibt man das mit ech tespetiere mech net mot dir zu verstehen. Anstelle von Tespetier steht manchmal der Ausdruck Tespetack oder häufiger noch Tispetack.Wenn es beispielsweise unter uns Kindern Streit gab, schaltete sich nach einer Weile Mam ein: Jett dä Tispetack draan, oder et jit jät honner de Horchlöffele (Hört mit der Zankerei auf oder es gibt Ohrfeigen). In Vereinsversammlungen, auf Parteitagen oder im Gemeindeparlament wird sich gelegentlich stonnelang tespetiert on et kött nix drbie erüß (stundenlang nutzlos geredet), was manchen Zeitgenossen zu der Behauptung veranlasst: Die solle nötzer jät Jeschejteres dohn (die sollten besser Gescheiteres tun). Manchmal zanken sich die Leute wegen belangloser Kleinigkeiten herum, und das ist des Tespetierens net drwert.
Thrönche
Ein Thrönchen ist ein kleiner Thron, ein Kindersitz sozusagen. Et Thrönche (Das Thrönchen) stand zu Omas Zeiten unter dem Bett oder im Nachtskommödchen: Der Nachttopf, den man auch als Näächsjeschier (Nachtgeschirr) oder Kamerpott (Kammertopf) bezeichnete und der ein unentbehrliches Gerät war. Vornehme Leute umschrieben den Topf mit „Mitternachtsvase.“ Es war 1986 auf der Intensivstation. Mir schräg gegenüber lag ein junges Mädchen, durch Sichtschirme vor meinen Blicken geschützt. Ich hörte aber ihr Weinen und ihr häufiges Flehen: „Schwester, Thrönchen.“ Die Schwester ließ sich aus dem Hintergrund vernehmen: „Komm gleich.“ Sie kam aber nicht, zehn Minuten und länger bat die Kranke, - ich hätte diese „Schwester“ lynchen mögen, war aber selber hilflos. Übrigens: Wer einmal auf dieses Krankenhaus-Thrönchen angewiesen war, dem ist die so nützliche Pfanne verhasster als Zahnschmerzen. Et Thrönche hat längst ausgedient, wir finden es allenfalls noch im Museum. Und in zeitgemäßem Outfit auch im Kinderzimmer: Baby auf dem farbenfrohen Plastik-Thrönchen, das Foto fehlt in keinem modernen Familienalbum.
Thuëre
Das Wort ist so gut wie „ausgestorben,“ kaum ein Dorfbewohner dürfte es noch kennen. Eine andere Version war Turre, die aber bei uns nicht gebräuchlich war. Der Thuëre war ein Teil des Türbeschlags und zwar der am Türpfosten angeschlagene Drehzapfen, in den die Langbänder der Tür eingehängt wurden. Den Thuëre in moderner Form gibt es heute noch bei den gebräuchlichen Fitschbändern unserer Zimmertüren. Im Gegensatz zum Scharnier ermöglicht der Thuëre das Ein- und Aushängen einer Tür, eines Fensterladens oder ähnlicher drehbarer Einrichtungen. Als im März 1945 die Amerikaner Nonnenbach besetzten, mussten wir unser Haus räumen und in eine Baracke am Rand der Hardt umziehen. Dort fehlte aber die Tür, und nach Einschätzung unserer Jött hätte die Tür unseres „Herzhäuschens“ in etwa passen müssen. Lange Zeit lauerten wir hinter dem Haus, das Herzbüdchen war ständig durch einen der Amis besetzt. Endlich klappte es dann doch, unter dem Gejohle der Soldaten schleppten wir die ausgehängte Klotür zu unserer Baracke. Jött hatte richtig kalkuliert: Die Tür passte ziemlich genau, sogar die Position der beiden Thuëre stimmte. Wir mussten lediglich die Tür auf den Kopf stellen: Sie war an der falschen Seite angeschlagen.
Thuëres
Eins unserer zahlreichen Dialektwörter für den Vornamen „Theodor,“ der aus dem Griechischen stammt und „Geschenk Gottes“ bedeutet. Weitere Eifeler Namen: Theo, Thej, Dores, Döres. Die Nachsilbe „es“ ist bei unseren Dialektnamen häufig: Nieres (Werner), Dölefes (Adolf), Mattes (Matthias), Köbes (Jakob), Noldes (Arnold). Im Dörf als Hausschlachter bekannt und beliebt war Baalesse Thuëres (Theodor Baales), der aus Nonnenbach stammte und dort einen Namensvetter besaß: Knubbe Thuëres (Theodor Plützer). Dr Knubbe war Landwirt und ein Nonnenbacher Original, er verkaufte Schmierseife, Staufferfett und Maschinenöl von „Heukelbach“ und führte nach dem Krieg einen kleinen Getränke-Hausverkauf. Hupperes Thej war der Bruder unseres langjährigen Feuerwehrführers Willi Hoffmann, und Watersse Thej (Theo Waters) war mein Bahnkollege. Unser Dienstvorgesetzter und Leiter des Bahnhofs Kall war übrigens auch ein „Geschenk Gottes“: Theo Brüllingen, in Kollegenkreisen Brüllingens Thüeres genannt. Nicht zuletzt kennen wir eine ganze Anzahl bekannter und berühmter „Gottesgaben“, Theodor Storm beispielsweise und seinen „Schimmelreiter,“ unseren ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, den unvergessenen Schauspieler Theo Lingen, oder auch Theo Waigel, den „Vater des Euro.“ Und schließlich gab es in den 1970er Jahren auf dem Schlagermarkt einen gewissen Theo, der millionenfach „nach Lodz“ fuhr, offensichtlich aber nie dort ankam, denn ab und zu schickt ihn die Sängerin Vicky Leandros auch heute noch auf die Reise: Theo, wir fahr´n nach Lodz.
Ticktack
Das allenthalben bekannte Kinderwort für die Uhr, dem Taktgeräusch des mechanischen Gangreglers einer Räderuhr abgelauscht. Jedes Material unterliegt dem Verschleiß, allein schon aus diesem Grund ist ein „Perpetuum Mobile“ ein Unding. Auch die beweglichen Teile der Uhr nutzen sich ab, der Rhythmus des Tick-tack verändert sich, die Uhr tickt nicht mehr sauber. Diese „Rhythmusstörungen“ haben wir der Uhr abgelauscht: Du ticks wahl net mieh sauber lautet die ärgerliche Reaktion auf dummes Geschwätz oder unberechtigte Vorwürfe. Eine landläufige Redewendung bei der Frage nach der Uhrzeit ist wievill Ticktack hammer (Wieviel Uhr haben wir = Wie spät ist es). Bei uns daheim gab es in der Stovv (auch Stuvv = Gute Stube, Wohnzimmer) das Ticktackschaaf (Uhrenschrank), auch Uhrkaaste (Uhrenkasten) genannt, eine vom Boden bis zur Decke reichende schmale Wandnische, in der eine große Räderuhr mit meterlangen Gewichtketten untergebracht war. Die Uhr war „zeitlebens“ defekt, ich kann mich nicht erinnern, sie jemals in Betrieb gesehen zu haben. Von einem Dummschwätzer wurde behauptet, er habe einen Tick aan dr Musik, und mein Vater (Vossen-Hein) kannte ein „Rätsel“: Was ist das, - Et hängk aan dr Wand on määch Ticktack, wenn et eraff fällt, os de Uhr kapott.
tiere
Das Wort hat absolut nichts mit dem Substantiv Tiere gemeinsam, vielmehr war es unser Mundartwort für „zurechtmachen, vorbereiten, herrichten, ausstatten“ und im Alltag ein vielfältig angewandter Begriff. Wenn beispielsweise Ohm Mattes am nächsten Morgen die Wiese zu mähen gedachte, musste er abends vorher noch et Mähjeschier tiere (das Mähgeschirr vorbereiten = Sense dengeln). Am Abend vor dem großen Waschtag hieß es für unsere Mutter de Weisch tiere (die Wäsche sortieren und einweichen). Wir Kinder mussten nach Erledigung der Hausaufgaben dr Schollsack tiere (weiches o, den Schulranzen herrichten), und für die täglichen Fütterung musste dr Söüsejmer jetiert (der Schweineeimer = Futterbehälter zurechtgemacht) werden. Wenn irgend ein Gegenstand verlegt wurde und nicht auffindbar war, lautete oft die ärgerliche Frage: Waar häßte dat wier jetiert (Wohin hast Du das wieder verlegt) oder es gab die ebenso ärgerliche Feststellung: Jung dat häßte äwwer noch ens joot vertiert (das hast du wieder mal gut versteckt). Für den Kirmesball hatte sich Gretchen besonders fein herausgeputzt und die Dorfburschen staunten: Mensch dat Jret hät sech äwwer noonej jetiert (zurecht gemacht). Ein paar weitere Anwendungen: Brandholz tiere, Mettecheiße (Mittagessen) tiere, Backoëwe (Backofen) tiere, Mool (Backtrog) tiere.
Tippelsbroder
In jedem Beruf gibt es einzelne „Schwarze Schafe,“ die nicht selten ihre ganze Zunft in Verruf bringen. Davor sind selbst hohe geistliche Amtsinhaber nicht gefeit, wie wir im Jahr 2013 erleben mussten. Der Tippelsbroder war ursprünglich ein Wandergeselle (Beispiel: Hamburger Zimmerleute), der in Ausübung seines Berufs durch die Welt kam und überall gern gesehen war. Eine Art Tippelsbroder im positiven Sinn war auch der Husierer (Hausierer), der über die Eifeldörfer zog und den Leuten seine Waren verkaufte. Zur negativen Sorte der Tippelsbröder (Mehrzahl) zählten unter anderem die Landstreicher, die man auch Pennbröder und Stromer nannte und die als Speckjäger sogar ein wenig gefürchtet waren: Wenn Tippelsbröder in der Umgebung des Dorfes gesichtet wurden, ging die Warnung von Haus zu Haus: Doot de Hohner en dr Stall on de Weisch van dr Leng (Sperrt die Hühner in den Stall und holt die Wäsche von der Leine). Noch deutlicher als Tippelsbroder definiert das holländische Wort den Landstreicher: Landloper (Landläufer). Tippelsbröder im durchaus positiven Sinne waren die reisenden Handwerker, Schuster beispielsweise (siehe: Stombs Wellem) oder Wanderschneider wie Hubert Kutsch aus Waldorf.
tirvele
Ein heute noch gelegentlich angewandter Begriff für „sich drehen, sich überschlagen, wirbeln.“ Ein ähnlicher Begriff ist Kuckeleboum schlohn oder Bolzaasch schlohn, womit wir den „Purzelbaum“ aus Kindertagen bezeichneten. In der Anwendung ist hauptsächlich sech tirvele (sich überschlagen) gebräuchlich, bei einem Unfall beispielsweise: Dat Auto hät sech drejmol jetirvelt on os om Daach lejje bleve (dreimal überschlagen und auf dem Dach liegen geblieben). Bei der Androhung von Prügeln heißt es nicht selten: Du kress ejne jeschosse, datte dech tirvels oder auch präziser datte et Rad schlejß (…dass du dich überschlägst / das Rad schlägst). Obwohl sie mit tirvele nicht direkt in Zusammenhang stehen, seien hier wegen ihrer Originalität zwei Zitate aus „Paul Panzers Telefonat“ angeführt. Da drohte nämlich der bekannte Dachdeckermeister: Do kress e paar jeschosse, dann mejnste, dr Kölner Dom wör en Frittebud, und ein anderes Mal erboste er sich: Ech langen dir jlich eine, dann jehste quer durch de Bud on bruchs zwei paar Schoh für ze bremse. Derartige Umschreibungen unseres tirvele gibt es eine Unmenge. Einen bösen Sturz kommentieren wir gelegentlich: Dä hät sech wööß jetirvelt (Der hat sich schlimm überschlagen). Hier ist oft auch die Umschreibung Dä hät ene wööste Tirvel jedohn (Der hat einen schlimmen Überschlag getan) gebräuchlich. Wööß bedeutet wörtlich „wüst“ und wird zur Verdeutlichung besonderen Übels gebraucht.
titsche
Das Wort bedeutet soviel wie „leicht anstoßen, anecken, berühren,“ aber auch „aufprallen und zurückfedern.“ Ein klassisches Beispiel für titsche ist die Ballführung beim Handballspiel mit wiederholtem Optitsche (Auftitschen = Aufprellen) auf den Boden. Als Kinder wetteiferten wir im Balltitsche: Sieger war, wer die meisten Titsche hintereinander erzielte, ohne einmal den Ball zu verlieren. Das gekochte Frühstücksei muss man einmal kurz auf die Tischplatte titschen oder auch mit dem Teelöffel aantitsche (antippen), um die Schale zu zerbrechen. Manchmal ist die Garageneinfahrt „zu schmal“ und der Kotflügel des flammneuen Autos titscht ekelhaft gegen die Toreinfassung. Oder der Hammer titscht schmerzhaft den Daumennagel statt des eisernen Nagels an. Mit vorgestreckten Armen stand Tünnes am Kölner Dom und starrte nach oben. Auf die erstaunte Frage eines Passanten erklärte er: Dä Schäl springk jetz vun do owwen eraff un ich fangen dä op. Einen aus 70 Metern Höhe fallenden menschlichen Körper auffangen? Der Passant äußerte energischen Zweifel an der Behauptung. Tünnes unterdessen erklärte die Sache: Ich losse dä jo eetz (erst) dreimool optitsche.
Tommesdall (weiches o)
In Höhe der Flur Maiheck liegt links neben der Kreisstraße 69 nach Nonnenbach zwischen den Anhöhen Katzekuhl (wörtlich: Katzengrube) und Freuschberch (Froschberg) der Bereich Tommesdall. Der Mundartausdruck bedeutet „Thomastal,“ der Ursprung des Namens ist nicht bekannt. Im unteren Talbereich besaßen wir zu meiner Kinderzeit etwa anderthalb Morgen Ackerland. Wegen der relativ kurzen Entfernung brachten wir die Getreideernte aus Tommesdall vom Feld direkt zum Dreischkaaste (Dreschmaschine) nach Blankenheimerdorf, wenn es die Witterung erlaubte. In Tommesdall lernte ich erstmals Eifeler Erdnüsse kennen, die Ohm Mattes beim Pflügen aus der frischen Erde grub und mir zu essen gab. Diese seltsam schmeckenden „Nüsse“ sind die Wurzelknollen des Wiesenkümmels. An der Froschbergseite reichte damals ein ausgedehntes Haselgebüsch bis dicht ans Feld heran, hier konnte ich vor Jahren einmal ein Jagdfasanenpärchen beobachten, die schönen farbenprächtigen Vögel sieht man bei uns nur selten. An der gegenüber liegenden Talseite hatte die Wehrmacht unter einer Baumgruppe der Katzekuhl eine niedrige Holzbaracke aufgebaut, vermutlich eine Unterkunft für die Mannschaft einer nahe gelegenen Vierlingsflakbatterie. Die Soldaten hatten ein Schild gemalt und über der Barackentür aufgehängt: Villa Duck Dich.
tööpe (hartes ö)
Das Wort wurde bei verschiedenen Gelegenheiten angewandt, generell bedeutete es „aussuchen, wählen, auf etwas tippen, erraten.“ Beim Zahlenraten war Jüppche seiner Sache sicher: Ech tööpe ens op de Vier (Ich tippe mal auf die Vier), und wenn die Zahl dann stimmte, hieß es bei den Mitspielern: Do häßte ene joode Tööp jedohn (Da hast du einen guten Griff getan). Hatte Jüppche dagegen falsch geraten, dann hieß es: Do häßte äwwer fies drnewwer jetööp (…arg daneben getippt). Wer vergeblich nach einer Antwort oder Problemlösung suchte, der stellte fest: Ech tööpe em Düüstere (Ich taste im Dunkel, weiß mir keinen Rat). Ein gleichbedeutendes Wort wäre in diesem Fall em Düüstere talepe (im Dunkeln tappen). Tööpe wird nämlich gelegentlich auch anstelle von „tasten, fühlen“ angewandt. Es gibt ein weises altes Eifeler Wort: Wo mr nix sitt, oß et Föhle net verbodde (wo man nichts sieht, ist das Fühlen nicht verboten), dessen Befolgung in manchen Situationen recht nützlich sein kann. Wenn jemand sich vorsichtig „tastend“ vorwärts bewegt, so nennt man ihn hier und da einen Tööpes, wobei allerdings dem Wort Talepes meistens der Vorzug gegeben wird. Der Talepes ist in der Standardsprache ein Tollpatsch.
töschen (weiches ö)
Das Eifeler Wort für „zwischen.“ Mariechen suchte verzweifelt nach ihrem neuen Sonntags-Kopftuch und stellte schließlich fest, dass das gute Stück töschen de Büjelweisch jeroode (zwischen die Bügelwäsche geraten) war. Beim Schlittenfahren auf Schlemmesch Peisch (Wiesenhang beim Nachbarhaus) war uns ein elterliches Zeitlimit gesetzt: Töschen Daach on Düüster sid ihr drhejm (Bei Anbruch der Dämmerung seid ihr daheim). Wer Hunger verspürte, der sah zu, dass er jät töschen de Zänn (etwas zwischen die Zähne) bekam, und von einem mageren Mitmenschen hieß es: Dä döesch ens jät töschen de Reppe kreje (Der dürfte mal etwas zwischen die Rippen kriegen). Das Mundartwort ist unverkennbar verwandt mit dem holländischen „tussen“ (gesprochen: tüssen), was ebenfalls „zwischen“ bedeutet. Die Holländer kennen auch „daartussen,“ und das heißt „dazwischen.“ Bei uns wird daraus drtöschen, wenn die Betonung auf „zwischen“ liegt, beispielsweise bei dem Rat, sich nicht in einen Streit einzumischen: jank net do drtösche, sons kreßte am End och noch ejne op de Muul. Wird dagegen die Silbe „da“ betont, heißt es bei uns dartösche. So erklärte beispielsweise der Dachdeckermeister dem Stift die Abdichtung der Schottelspanne (einfache Dachpfannen mit einer Überlappung anstelle einer Falz): Dartösche jehüert e Strühpöppche. Die handgefertigten Strohdichtungen glichen einem kleinen Püppchen.
Tränedier
Es ist schon ein etwas seltsames Lebewesen, das Dörfer Tränedier, das auf gut Hochdeutsch als „Tränentier“ zu bezeichnen wäre. In unserem Dialekt betiteln wir damit einen weinerlichen, oft auch furchtsamen Zeitgenossen, der „nah ans Wasser gebaut“ hat, der also sehr leicht zum Weinen zu bringen ist. Ebenso ist ein langweiliger, wortkarger Mitmensch gelegentlich ein Tränendier, über den man sich ärgert, weil mit ihm nichts anzufangen ist. Es gibt allerdings auch tatsächlich ein „Tränentierchen,“ wie ich beim allwissenden Google erfuhr. Das Geschöpf ist nur wenige Mikrometer (Bruchteile vom Millimeter) groß und lebt im nährstoffreichen Gartenteich. In unseren Flegeljahren nach dem Krieg, gab es in unserem „Verein“ auch ein Tränedier, einen übervorsichtigen und furchtsamen Kumpel, der uns mit seinen „Wenn“ und „Aber“ manchmal zur Verzweiflung und sogar zur Aufgabe des einen oder anderen Vorhabens brachte. Ab und zu platzte unserem „Boss“ aber auch der Kragen: Maach dech hejm, du Tränedier, mot dir os nix aanzefange (Hau ab nach Hause, du Tränentier, mit dir ist nichts anzufangen). Eine gute Portion Mut war bei unseren „Unternehmungen“ oft schon erforderlich. Beim Kirmesball rissen sich die Burschen verständlicherweise um die Dorfschönheiten, weniger „ansehnliche“ Mädchen blieben manchmal unbeachtet und nutzten die Damenwahl, um endlich auch einmal zum Zuge zu kommen. Da ärgerte sich manchmal der „Auserwählte“ im Nachhinein: Üßjereichent dat Tränendier moß mech zur Damenwahl holle, und das war gar nicht so besonders gentlemanlike.
Trapp
Bei diesem Wort denkt mancheiner unwillkürlich an den „Trapper,“ den amerikanischen Fallensteller bei Karl May. Oder an die „Trapp-Familie,“ einen der erfolgreichsten deutschen Heimatfilme der 1950er Jahre. Die Dörfer Trapp steht unterdessen mit keinem von beiden in Zusammenhang, sie bezeichnet schlicht und einfach die hochdeutsche „Treppe.“ Ein elterlicher Befehl fürs Zubettgehen lautete zu unserer Kinderzeit: Nu jö, de Hänn jeweische on dann erop (auf geht´s, Hände waschen und dann ins Bett), dabei bedeutete erop (hinauf) in diesem Fall eben das Schlafgemach, das sich in der Regel im Obergeschoß befand. Drastischer noch lautete seinerzeit der Befehl einer Nettersheimer Mutter: Jepiß, jepupp, de Trapp erop, und damit wurde angeordnet, sich der kleinen und großen körperlichen Bedürfnisse zu entledigen und de Trapp erop (ins Schlafzimmer) zu eilen. Im Krieg, als der Dorffriseur an die Front musste, frisierten viele Leute die Haarpracht ihrer Sprösslinge selber, mit der handbedienten mechanischen Hoormaschin (Haarmaschine = Haarschneider). Wenn da die führende Hand nicht eisern sicher war, gab es leicht eine „lichte Stelle“ am fassonggeschnittenen Hinterkopf, und solche freigelegten Hautstellen nannte man Trapp. Mein Hausfriseur war damals Plötzer Schäng aus Blankenheimerdorf, mein Onkel Johann Plützer, er hat mir manche Trapp im Nacken verpasst. Keller- und Spichertrapp (Keller- und Speichetreppe) sind allbekannt, weniger geläufig ist die Owwenopstrapp, was wörtlich „Obenauftreppe“ bedeutet und die Treppe ins Obergeschoß bezeichnet. Bei uns daheim war unter der schrägen Spichertrapp ein offener Bretterboden eingebaut, auf dem Werkzeug und allerlei alte Gegenstände lagerten, dieser Boden hieß bei uns op dr Trapp (auf der Treppe). Trappe war früher ein ortsüblicher Hausname: Aan Trappe in der Ronn wohnte damals der Junggeselle Trappe Klööß (Nikolaus Pickartz), und in der Jöddejass baute der Jagdaufseher Trappe Jüpp (Josef Pickartz) nach dem Krieg ein Haus. Em Treppche war lange Jahre ein Lokal in unserer Buppersgasse.Und schließlich: De Trapp erop falle war und ist unser Ausdruck für eine andauernde Glückssträhne.
tredde
Eine unsinnige Redewendung aus der Kinderzeit ist mir noch gut in Erinnerung: Mam, dä hät mech mot Fööß jetrodde beklagte man sich bei Mutter, wenn man etwa vom Schulkameraden beim Raufen einen Fußtritt erwischt hatte. Mit Füßen getreten, - womit sonst hätte der Kumpel treten sollen! Tredde steht sowohl für positive als auch für weniger edle Handlungen. Da ist beispielsweise das beinahe weltweit bekannte en dr Aasch tredde (in den Hintern treten) zu nennen, - ein Ausdruck größter Wut und Rachsucht. Ein „fieses“ Wort ist auch en dr Därm tredde (in den Darm treten), womit wir gewisse menschliche „Töne“ bezeichnen. Brutal und gemein hört sich en dr Balech tredde (in den Bauch treten) an, und en et Kreuz tredde bewegt sich in der Nähe des Hinterteils. En de Scheiße tredde heißt soviel wie „Unheil anrichten, und ejnem op de Fööß, dr Schlips, de Höhneroure tredde bedeutet jemanden kränken oder beleidigen. Du wiëß jetrodde (Du wirst getreten) ist eine allgemeine, nicht spezifizierte Drohung. Jät brejt tredde (etwas breit treten) ist eine Eigenart der Dummschwätzer und Tratschtanten, und dech moß ech wahl ens tredde lautet eine Mahnung beispielsweise an den säumigen Schuldner. Der Ausdruck üßtredde bedarf keiner weiteren Erörterung. Wesentlich vornehmere Redewendungen sind unter anderem en Erscheinung tredde, vüer de Versammlung tredde, en dr Verein tredde, de Kirch betredde, üß dem Huus tredde, op de Strooß tredde.
trepse (weiches e)
Das Wort bedeutet „tropfen“ und wird überwiegend mit „tröppe“ oder „dröppe“ interpretiert, trepse ist dagegen bei uns zusätzlich im Gebrauch. Ein klassischer Ausdruck ist Daachtreps (Dachtraufe), die „Tropfzone“ am Fuß der Eifeler Hauswand (siehe: Daachtreps). Wohlbekannt ist das weise alte Wort Wenn es net räänt, dann treps et, womit wir die Behauptung konkretisieren, dass „Kleinvieh auch Mist macht“ (Wenn es nicht regnet, dann tropft es). Ein anderes, heute längst überholtes Sprichwort besagte früher: Wenn et op dr Pastuër räänt, dann treps et op dr Koster (Regnet es auf den Pfarrer, dann tropft es auf den Küster), und das sollte besagten: Von den üblichen Abgaben an den Dorfpfarrer kriegt auch der Küster etwas mit. Wer kennt nicht das nervtötende Geräusch, wenn die Dichtung kaputt und der Wasserhahn am trepse os (wörtlich: am tropfen ist). Eine tropfenweise einzunehmende Melezien (Medizin) wurde früher als trepswies ze schlecke (tropfenweise zu schlucken) vom Dokter verordnet. Das Schwämmchen am Ausguss vom Kaffepott (Kaffeekanne) war der Trepsefänger oder einfach auch et Jümmiche (das Gummichen) genannt. Losse mir sehn, dat mir önner Daach konn, de ieschte Trepse fallen ad lautete die Mahnung angesichts eines drohenden Gewitters beim Heueinfahren, und wenn man es dann doch nicht früh genug önner Daach (unter Dach) schaffte, dann wurden Heuladung und Erntemannschaft trepsnass (tropfnass). Wat koss en Treps Sprit bie dir? Fragte Bäetes (Albert) an der heimischen Tankstelle und erhielt zur Antwort: En Treps kreßte ömesons (umsonst). Na jut, dann treps mir dr Tank ens voll schmunzelte der Kunde, fand aber wenig Entgegenkommen.
Tromm (weiches o)
Was wäre eine Musikkapelle, eine „Band“ oder ein Spielmannszug ohne Tromm! Es wäre ein Unding, gleichzusetzen mit dem Schelleböümche ohne Schell, das im Blankenheimer Traditionskarneval besungen wird. Tromm war und ist unser Dialektwort für die Große Trommel, die zur Musik gehört wie et Amen en de Kirch. Der Kölner sagt Trumm und meint damit insbesondere die decke Trumm (dicke = große Trommel), das Hauptinstrument im Kölner Karneval: De beste Musik määd de decke Trumm, zing bumm zing bumm zing bumm, - Toni Steingass und sein Terzett wussten das Lied über die decke Trumm zu singen. Die Tromm war unterdessen auch ein trommelförmiges Zusatzteil am gusseisernen Säulen- oder Kanonenofen mit einer Öffnung für den Kochkessel oder die Bratpfanne. Tromm in der Bedeutung von „Trumm“ war nicht zuletzt die Bezeichnung für ein möglichst großes Teilstück, e Tromm Taat oder Streukooche (ein Riesenstück Torte oder Streuselkuchen) beispielsweise oder auch e Tromm Schnedd (ein mächtiges Butterbrot). In diesen Fällen wird Tromm mit gedehntem m gesprochen, wie beispielsweise bei „Damm.“ Den „Hausfeldwebel“ nannte man früher (tunlichst hinter vorgehaltener Hand) de Tromm, sofern die Dame von stattlicher Statur war. Ihr kleines, rundliches Gegenstück war et Trömmelche.
Trommsäëch (weiches o)
Schrotsäge, Zweimann - Zugsäge für grobe Holzarbeiten, beispielsweise zum Baumfällen und Trömpe (auf Längen zurecht schneiden) der gefällten Stämme. Das frühere Wort für einen schweren oder klobigen Gegenstand, etwa einen Holzklotz, war „Trumm,“ Trommsäëch und Trömpe sind davon abgeleitet. Die Trommsäëch kam überall dort zum Einsatz, wo die handliche Rahmsäëch (wörtlich: Rahmensäge = Spannsäge) nicht ausreichte. Die richtige Handhabung der langen Zugsäge erforderte Geschick und Übung und nicht zuletzt auch Muskelkraft. Besonders beschwerlich war das Fällen von Bäumen, weil das in tief gebückter Körperhaltung geschehen musste. Der geübte Waldarbeiter setzte das vom Stamm abgewandte Knie an den Boden und stemmte den anderen Fuß gegen den Stamm als Gegenstütze beim Zug an der Säge. Die für Querschnitte durch einen Stamm bestimmte Trommsäëch war speziell für beiderseitigen Zug geschärft, für Längsschnitte war die Säge „auf Stoss“ gezahnt. Längsschnitte waren früher beim Zurechtschneiden von kantigen Balken, etwa beim Hausbau, erforderlich, - eine unendliche Schinderei. Dabei musste der Baumstamm auf ein mannshohes Gerüst gewuchtet und dort fixiert werden. Die Trommsäëch wurde in diesem Fall senkrecht geführt, wie eine Gattersäge. Die „Stoßzähne“ der zwei Meter langen Säge griffen nur bei der Abwärtsbewegung, aufwärts wurde das Werkzeug mehr oder weniger „im Leerlauf zurückgeholt.“ Sowohl der Ober- als auch der Untermann spürten nach Feierabend jedes einzelne Knöchelchen in ihrem Körper. Es gab auch relativ kurze Trommsäëje (Mehrzahl) als Einmannsägen, sie waren wie ein „Fuchsschwanz“ gebaut und in der Regel auf Stoss geschärft.
Tromp
Das Wort hat mehrfache Bedeutung. Am bekanntesten ist es als „Trumpf“ im Kartenspiel. Als Kinder spielten wir mit Begeisterung Herzblättchen, wobei bekanntlich die Farbe „Herz“ die Stichfarbe ist, - Herzer hieß das bei uns, die übrigen Farben waren Eckstejn, Schöppe und Krützer. Mit dem Ruf Tromp op knallte man beispielsweise das Herzass auf den Tisch, daher stammt der Ausdruck optrompe (auftrumpfen). Der Tromp war zur Zeit unserer Großeltern auch eine Art Feldmaß, unter anderem bei der Kartoffelernte: Quer zu den Kartoffelreihen wurde ein Areal von zehn Schritten abgemessen, das sich über die gesamte Breite des Feldes erstreckte und von zwei Personen jekaasch (Kartoffelernte von Hand mit der Hacke) werden musste. Ein solcher Tromp war ein Arbeitsmaß, vier Trömp beispielsweise waren eine beachtliche, aber gängige Tagesleistung, wobei naturgemäß die Feldbreite ausschlaggebend war. Schließlich war der Tromp auch ein Längenmaß der Waldarbeiter. Beim Brennholz wurden die Stämme auf Meterlängen zersägt und zu Raummetern aufgestapelt (siehe: Trommsäëch). Den Vorgang, übrigens mangels einer Motorsäge eine echte Knochenschinderei, nannte man Metere afftrömpe.
Troonsdöppe (hartes o, weiches ö)
Gängige Bezeichnung für einen begriffsstutzigen Zeitgenossen, dem man alles zweimool sare moot (zweimal sagen musste), bevor er das Gesagte kapierte. Ähnliche Ausdrücke waren Troonsliëch oder auch einfach Döppe, - ganz allgemein die Umschreibung von „Trottel“ oder „Dummkopf“. Troonsdöppe heißt übersetzt „Trantopf“ und Troonsliëch ist ein Tranlicht, ob seiner spärlichen Helligkeit abfällig „Tranfunzel“ genannt und als Hinweis auf das spärliche „Geisteslicht“ eines Mitmenschen gedacht. Troonsdöppe war auch ein Ausdruck für einen schläfrigen und bedächtigen Menschen, der für jeden Handgriff viel Zeit brauchte und der sech selever net üß de Fööß kam (über die eigenen Füße stolperte). Einem solchen Zeitgenossen erteilte man nicht gern einen eiligen Auftrag denn bos dat Troonsdöppe domot fäedich os, han ech et selever drejmool jedohn. Bei uns daheim gab es ein echtes Troonsdöppe im Sinne des Wortes. Es stand auf dem Wandbrett an der Kellertreppe, sein Inhalt war schwarz und roch fürchterlich: Der Topf mit dem fettigen Tran zum Einschmieren der Kinderschuhe im Winter, wenn sie knochenhart getrocknet morgens aus dem Backöfchen des Küchenherdes geholt wurden. Das Schuhanziehen für den Schulgang war eine peinvolle Angelegenheit, der Tran wirkte erst nach geraumer Zeit. Bei uns gab es auch eine Troonsflasch (Tranflasche), die noch unbeliebter war als das Döppe. Sie nämlich enthielt den fürchterlich schmeckenden Levvertroon (Lebertran), den wir täglich löffelweise schlucken mussten.
Troppe
Der Troppe ist das aus dem Zeitwort trepse gebildete Substantiv (siehe: trepse). Üß dem Rään en de Treps konn bedeutet „aus dem Regen in die Traufe kommen“ und somit doppeltes Ungemach erleiden. Unser Troppe ist der hochdeutsche „Tropfen“ und hat nichts mit dem „Tropf“ zu tun, der ein Tunichtgut ist und bei uns Nixnotz heißt. Dat os jo jät wie ene Troppe op dr hejße Stejn beschwert sich der durstige Stammgast an der Theke über ein knapp bemessenes Getränkt. Dat hie os noch e ech Tröppche (..ist ein guter Tropfen) wird der Kneipenwirt ob seines – natürlich spendierten – „Spezial“ gelobt. „Bei Ihren Gallensteinen dürfen Sie aber keinen Tropfen mehr trinken,“ mahnte der Doktor den trinkfreudigen Patienten, der seinerseits erstaunt feststellte: On ech wor bos höck der Mejnung, dat steter Troppe dr Stejn höhlt. In früheren Jahren gab es eine Fernsehwerbung: Dröpje voor dröpje kwaliteit, das holländische Wort für „Tropfen“ ist drop oder auch druppel, unser Wort vom Tropfen auf dem heißen Stein beschreiben die Niederländer bildreich mit dat is als een druppel op een gloeiende plaat (…glühende Platte). Vom Wort her mit unserem Troppe verwandt, ist der englische Ausdruck Drops, und der erinnert mich an meine Kinderzeit. Heute kaum noch gegenwärtig, damals aber hoch im Kurs, waren die erwähnten Drops, begehrte Fruchtbonbons in Rollenform: Zitronen-, Orangen- und Pfefferminzgeschmack. Als damals Neunjähriger habe ich der Wehrmacht mehrfach solche Drops aus dem Vorratslager geklaut. Die süßen Rollen lagen dort zu Tausenden in den Regalen gestapelt, den Landsern wurden sie abgezählt in die Hand gedrückt, die Schreibstubenbonzen kauten tagein tagaus, sie „fraßen“ geradezu die Süßigkeiten. Und wir vier Pänz (Kinder) bekamen – gar nichts, wir durften mit heißen Augen zuschauen, wie der Herr „Oberfeld“ Drops fraß. Verdorbene „Schoka-Kola“ gaben sie uns und wir bekamen fürchterliche Bauchschmerzen, der Stabsarzt kurierte uns mit roten Pillen und brüllte die Bonzen zusammen, die uns das verschimmelte Zeug gegeben hatten. Durch wiederholte heimliche „Besuche“ des Lagerraumes habe ich mich „gerächt.“ Es gab dort auch echte Schokolade und Bonbontütchen mit „Pastillen.“ Es gab sogar Frischfleisch und Holzfässer mit guter Butter und echtem Schmalz für die Feldküche. Und es gab wahre Zigarettenberge, den Landsern zu fünf Stück abgezählt zugeteilt, von den Bonzen unterdessen beinahe auch „gefressen.“ Ein einziges Mal habe ich „Eckstein“ und „Overstolz“ probiert. Danach glaubte ich vor Übelkeit zu sterben und ließ es sein.
Tröüt
Die Herkunft des Wortes kann nur vermutet werden, eine offizielle Version konnte ich bisher nicht ermitteln. Tröüt ist eine frühere Straßenbezeichnung in Blankenheimerdorf, nach der ein ganzer Ortsteil benannt ist: De Tröüt, allgemein auch op dr Tröüt. Die Straße führt vom Jean Leyendecker Platz bis zur Kreuzung Hochstein und wurde im Zuge der kommunalen Neuordnung in Treuter Weg umbenannt. Früher verwandelten sich die unbefestigten Dorfstraßen bei Regen in Schlammstrecken mit zahlreichen Tröüte oder auch Tröütsche (Wasserpfützen), wie man sie heute noch auf Waldwegen findet. Eine Redensart war damals auch et räänt dat et tröütsch, gemeint war starker Regen, der die Bildung von Wasserlachen bewirkte. Möglicherweise gab es am Treuter Weg besonders viele Tröüte, die dem Weg seinen ortsüblichen Namen verliehen. Die Dörfer Tröüt war seinerzeit bei uns Nonnenbacher Kindern gefürchtet: Wir mussten regelmäßig zur chreßlich Liehr (Christenlehre = Religionsunterricht) bei Dechant Hermann Lux im Pfarrhaus. Der Zutritt zur Schule war dem Pastor von der braunen Regierung verboten worden. Auf der Tröüt wurden wir gelegentlich von der männlichen Dörfer Jugend mit Prügeln „empfangen.“ Wehren konnten wir uns kaum, der Gegner war uns zahlenmäßig und körperlich weit überlegen. Warum wir Prügel bezogen, weiß niemand so genau, wir waren eben die Nonnebaacher, geringschätzig und abwertend wurden wir oft auch Kanonnebaacher (Kanonenbacher) tituliert. Daran änderte sich auch nichts, als wir ab dem September 1943 für ein Jahr die Schule in Blankenheimerdorf besuchen mussten, weil unser Lehrer Gottschalk noch „eingezogen“ worden war.
Truffel
Die Aussprache ist regional verschieden, es gibt beispielsweise Traufel, Troufel, Truufel, Troffel. Im Rheinland und damit auch bei uns, ist allgemein Truffel gebräuchlich, das Wortbild ist unterdessen überall dasselbe. Der Mundartausdruck ist vermutlich aus dem lateinischen Trulla hergeleitet, womit ein kleines Schöpfgerät zum Einschenken von Wein bezeichnet wurde, eine Kelle also. Auch die Dörfer Truffel ist eine Kelle, speziell eine Maurerkelle, und somit das Hauptwerkzeug des Maurers und Verputzers zum Auftragen, Verteilen und Glätten des Mörtels. Die Handhabung der Truffel erfordert eine Menge Übung, Geschick, Muskelkraft und nicht zuletzt ein gutes Augenmaß. Klätsch, menge Mann os Mürer (Klatsch, mein Mann ist Maurer) kommentierte früher die Eifeler Hausfrau eine entsprechende Tätigkeit, beispielsweise das Ankleistern der Papierbahn beim Tapezieren. Do hüert noch en Truffel Spies hin, hie wiëd net jeschluddert (Da fehlt noch eine Kelle Mörtel, hier wird nicht geschludert) rügte der Maurer seinen säumigen Öpperer (Handlanger). Truffele (Plural) gibt es in den verschiedensten Formen, Größen und Ausführungen, speziell abgestimmt auf den jeweiligen Anwendungsbereich. Früher gab es auch die Koochetruffel, den eher als „Kuchenschaufel“ bekannten Heber zum Servieren der Tortenstücke. Es war in den 1980er Jahren, beim Aufräumen am Morgen nach einem Wiesenfest auf dem alten Sportplatzgelände. Ein paar Kuchenreste erregten die Begehrlichkeit von Wiesenfest-Chef Walter Schmitz: Do hätt ech jetz richtich Loß draan. Wie und warum sie dorthin gekommen war, ist bis heute nicht bekannt, jedenfalls aber lag da auch eine handliche spitzwinklige Ecktruffel herum, die mir als Kuchenheber diente, und Walter verzehrte genüsslich sein Tortenstück.
Tubakskranz
Unter der Vielzahl von Kränzen der verschiedensten Sorten und Zusammensetzungen, kannten unsere Eltern einen ganz Besonderen, den man heute nur noch im Spezialladen findet, der aber früher zum Eifeler Alltag gehörte: Den Tubakskranz (Tabakskranz). Neben dem allgemeinen Krüllschnitt war der Strangtubak ein sehr beliebtes Rauchkraut für das Knasterdöppe (Pfeife), das beim Eifeler Bauersmann tagsüber nur zu den Mahlzeiten einmal „kalt wurde.“ Die etwa drei Zentimeter dicke Tubakswuësch (Tabakwurst) war aus gewürzten Tabaksblättern zu einem Endlos-Strang gedrillt. Die Verkaufsportionen gab es als gerade Stücke, hufeisenförmig oder auch zu einem Ring mit etwa 20 Zentimetern Durchmesser geformt. Ein solcher Ring war der Tubakskranz. In der Regel musste der Bauersmann morgens zeitig aus den Federn, der Rauchbedarf für den nächsten Tag wurde somit schon abends vorbereitet. Die Tagesration wurde mit dem Taschenmesser in dünnen Scheiben vom Tubakskranz abgeschnitten, ein wenig zerrieben und in den selbstgefertigten Tubaksböggel (Beutel) getan, dessen Inhalt auch bei Sommerhitze kaum austrocknete.
Tuppes
Der Tuppes ist ein Mensch, der nicht unbedingt „doof“ ist, der sich aber leicht an der Nase herumführen und einen Bären aufbinden lässt. Der Tuppes ist gutgläubig, treuherzig und meistens auch ein wenig einfältig. An einem Neubau im Dörf wurde der Dachstuhl gesetzt, Vater als Schreiner ging den Kaastenholz-Männ (die Brüder Paul und Heinrich Kastenholz, zwei einheimische Zimmerleute) ein wenig zur Hand, während ich daheim die Werkstatt hütete. Bei mir erschien ein junger Mann: Tach, ech soll et Jewiëch van dr Wasserwooch holle (…das Gewicht von der Wasserwaage holen). Oha ! Da lag in der Werkstatt das Spanngewicht einer alten Häckselbank herum. Mein Besucher packte sich das Zwanzigpfundeisen auf die Schulter, zog ab, wuchtete es auf der Baustelle weisungsgemäß die Leiter hoch und deponierte es hoch oben auf dem Firstbalken (das erfuhr ich später). Nach zwanzig Minuten war er wieder bei mir: Ech brengen et Jewiëch zeröck, die Männ bruchen et net mieh. (Ich bringe das Gewicht zurück, die Männer brauchen es nicht mehr). Nochmals oha ! So ungefähr stellt man sich einen Tuppes vor. Die Geschichte ereignete sich im Sommer 1956 bei uns in Blankenheimerdorf. Der Tuppes war ein auswärtiger Lehrling.
Tütt
Ein Gebrauchsgegenstand, dessen Vorhandensein derart alltäglich und selbstverständlich ist, dass wir uns seiner gar nicht mehr bewusst sind: Die Papiertüte, die freilich inzwischen weitgehend durch ihre „Plastikschwester“ verdrängt wurde. Es gibt sie aber noch, beispielsweise im Bäckerladen als Verpackung für duftende Brötchen und leckere Teilchen. Im Dorfladen unserer Kinderzeit hing am Nagel hinter der Theke ein Sortiment Papiertüten verschiedener Größen, braune und weiße, spitze und flache, jeder Ware angemessen. Paß op, dat kejn Tütt kapott jeht (Paß auf, dass keine Tüte beschädigt wird) gab Mam uns Kindern mit auf den Einkaufsweg. Die Einkaufstüten wurden daheim sorgsam geglättet und gefaltet und für die Wiederverwendung aufbewahrt, im Schaaf (Wandschrank) gab es einen ganzen Stapel davon. Jierdrögge Finche (die Verkäuferin und spätere Frau Bell) kannte sich aus und hob also die Tüte vorsichtig vom Nagel, damit es keinen Riss gab. Die Tütt war schlichtweg d a s Verpackungsmittel für alles, was es im Allerweltsladen an Kleinwaren zu kaufen gab. Zum Beispiel die Nägel verschiedenster Sorten, die man pfund- oder höchstens kiloweise und damit meistens unverpackt einkaufte. Die spitzen Stifte stachen dann wie Igelstacheln durchs braune Tütenpapier. Eine solche Näältütt (Nageltüte) war dann leider nicht weiter zu verwenden.
nach oben
zurück zur Übersicht
|