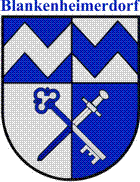|
Labbes
Der Labbes ist ein Mensch mit unangenehmen Eigenschaften. Die können von Einfältigkeit über Dummheit, Schalk und Hinterlist bis zu Nichtsnutzigkeit und Verkommenheit reichen, - Labbes steht für alle diese Untugenden. Ein Labbes ist in jedem Fall eine männliche Person, eine „Labbessin“ oder Ähnliches gibt es nicht. Gelegentlich ist auch der Körperbau ausschlaggebend, der lange Labbes beispielsweise ist ein häufiges Wort, oder auch Läbbesje für ein unartiges Kind. In unserer Jugend vor fast 60 Jahren waren wir Halbwüchsige im Dorf als jruëß Labbesse (große…) verschrien, weil wir abends Schabernack trieben und Streiche spielten. Die Leute behaupteten von uns, dass wir nix wie Labbessereje em Kopp (nur Nichtsnutzigkeiten im Kopf) hätten. Ein artverwandter Begriff ist Schlabbes, mit dem wir einen kraft- und willenlosen Kerl, ein so genanntes „Weichei,“ bezeichnen. Noch ein mit Labbes verwandtes Wort ist Flabbes. Der Flabbes ist eine „überkandidelte“ Person, ein „Geck“ oder Angeber, den die Leute nicht leiden können: Kick dir blos dä Flabbes ens aan, dä hät se doch net all. Ob Schlabbes oder Flabbes, in beiden Fällen hat der Labbes bei der Wortbildung Pate gestanden und den negativen Hintergrund geschaffen.
Lad
Die Lad war in erster Linie das Wort für einen großen, meist länglichen Holzbehälter, mehr oder weniger eine Kiste, zum Aufbewahren aller erdenklichen Gegenstände. Aber auch die wertvolle massive Eichentruhe, in der neben Bettleinen und Spitzentüchern oft auch der Familienschatz und die Hausakten verwahrt wurden, war vielfach de Lad und als solche ein feststehender Begriff. Die Schublade im Tisch war die Deschlad (Tischlade) und das Bettgestell war die Bettlad. Der Fensterladen war bei uns de Fensterlad und die verschließbare Bodenluke auf dem Heustall nannte man regional de Heulad. Allgemein üblich war auch das Wort Duëdelad (Totenlade). Noch bis weit in die 1950er Jahre stellte der Dorfschreiner die Särge her, – eine Wissenschaft für sich, denn die übliche Eifeler Duëdelad war ein Werkstück, an dem es keinen einzigen 90-Grad-Winkel gab. Einschließlich des Anstrichs dauerte die Sargherstellung mindestens zwei Tage, Vater hielt also immer ein Stück „auf Vorrat.“ Die letzte Lad, die er baute, wurde unerwartet seine eigene. Er starb am 13. November 1957 um 0,30 Uhr durch Herzinfarkt, es war die Kirmesdienstagnacht.
Lällbeck
Was bei Karl May der erfahrene Präriejäger als „Greenhorn“ bezeichnete, das war zu unserer Kinderzeit für die „Großen“ der Lällbeck: Ein unerfahrener Grünschnabel, der noch gar nicht mitreden durfte. Das Wort wird auch heute noch von Erwachsenen angewandt, die sich Jüngeren gegenüber ungeheuer klug und weise vorkommen. Der Wortteil Läll bezieht sich auf „lallen,“ wie es Kindern oder Alkoholikern eigen ist, der Beck ist gleichbedeutend mit Muul und bezeichnet einen großen Mund, ein Maul: Rieß dä Beck net esu op (Reiß den Mund nicht so auf). Lällbeck war auch die Bezeichnung für den vorlauten Schwätzer, der van nix en Ahnung hät, der sich aber überall einmischte und motkalle (mitreden) wollte. Lällbeck war fast ein Schimpfwort, zumindest aber ein Ausdruck der Verachtung des Weisen und Erfahrenen dem Unterlegenen gegenüber. Gleichwertige Begriffe waren Jrönschnabel (Grünschnabel), Rotzleffel (wörtlich = Rotzlöffel), Botzendresser (Hosenscheißer), Domme Jong (Dummer Junge). Wenn der Erwachsene einem Jüngeren gegenüber seine besondere Erfahrung und Weisheit zum Ausdruck bringen will, ist auch heute noch die Redensart üblich: Du jonge Lällbeck, ech könnt doch de Vader sen.
Lampett
Regional auch Lambett. Ein Ausdruck von ungewisser Herkunft. Gelegentlich steht d a s Lampett im Zusammenhang mit Beleuchtungskörpern und bezeichnet dann meist ein Lampen-Set. Eine sprachliche Verbindung besteht offensichtlich mit dem niederländischen Wort „Lampetkan,“ was ebenso wie d i e Lampett unserer Eltern „Wasserkrug“ bedeutet. Zu Omas Zeiten, als es im Hotelzimmer und natürlich auch im Eifeldorf noch kein fließendes Wasser gab, stand die Waschgarnitur auf dem breiten Weischdesch (Waschtisch), der als solcher mit einer „Marmorplatte“ ausgestattet war: Der flache Lampettekomp (Waschschüssel) und darin die mit frischem Wasser gefüllte eigentliche Lampett, die es in mannigfachen Formen und Größen gab. Die Garnitur bestand durchweg aus Keramik, deren Güte sich an der Preisklasse des Hauses orientierte. Die ländliche Lampett war ein zylinderförmiges hohes Gefäß mit Henkel und Gießvorrichtung und etwa fünf Liter Fassungsvermögen. Das holländische Wort für den Lampettekomp ist „Lampetkom.“ Bei uns daheim stand in jedem Schlafzimmer eine Lampett auf dem Waschtisch, - wir hatten ja noch keine Wasserleitung. Fürs Händewaschen im Alltag gab es im Huus (Küche) die emaillierte flache Weischschepp (Waschschüssel).
Lämpes
Der Lämpes ist von lämpe hergeleitet und das bedeutet allgemein „schlaff herabhängen, schlottern,“ insbesondere im Zusammenhang mit Kleidung oder Textilien. Es gibt auch den Begriff sech lämpe, beispielsweise Dä Stoff lämp sech bejm Droon (Der Anzugstoff dehnt sich, zieht Falten beim Tragen). Die Verkörperung dieser negativen Eigenschaften ist der Lämpes, ganz speziell der lange Lämpes. Er ist in aller Regel ein körperlich langer und dünner Mensch, der nicht selten etwas unordentlich gekleidet ist. In jedem Fall hat Lämpes einen leicht negativen „Beigeschmack,“ regional wird auch eine, im Dorf wenig beliebte männliche Person als Lämpes bezeichnet. Einen Faulpelz oder Tagedieb beispielsweise nennt man mancherorts einen fuule Lämpes oder ganz einfach auch Fuulich. Von einem Trunkenbold behaupten die Leute hinter der Hand: Dä Lämpes hängk dr janzen Daach en dr Wiëtschaff. Zu meiner Ausbildungszeit bei der Bahn (1953 - 1955) kannten die Euskirchener Kollegen einen treffenden Ausdruck für Austreten (Wasserlassen): dr Lämpes schwenke (den Lämpes schwenken), was ein wenig hintergründig, aber durchaus treffend ist.
länge
Das Zeitwort länge ist naturgemäß eng verwandt mit dem Substantiv Länge und bedeutet soviel wie „in die Länge ziehen, erweitern, größer machen.“ Die „Länge“ heiß in unserer Mundart Läng oder Längk. Da erhielt ich beispielsweise beim Bau des neuen Gartenzauns von Vater den Auftrag: Die Zonglatze dejste jenau op de Längk van enem Meter schnegge, die Querlatze weren op zwei Meter fuffzich affjelängk. Das Zeitwort länge ist relativ häufig in unserem Sprachgebrauch. So wurden unter anderem die Botzebejn (Hosenbeine) an der Ärbedsbotz (Arbeitshose) durch annähen eines Stoffstreifens jelängk (verlängert), im gegenteiligen Fall hatte sich wegen der schlechten Qualität de Botzebejn jelängk und mussten jeküez (gekürzt) werden. Länge war früher im Zusammenhang mit Speisen und Getränken ein wenig geliebter Begriff, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Da hatte seinerzeit Drinche die Mittagssuppe „gestreckt“ und Ehemann Mattes beschwerte sich über die Schlabberbrööt, die krett jo kee Mensch eraff (kann ja keiner essen), worauf Drinche energisch wurde: Wenn dir die Zupp ze dönn os, dann schlaren ech mir e paar Eier dren on eißen se selever, fottjeschmosse wiëd se net, – Drinche wusste sie sich zu helfen. Und schließlich weiß der Volksmund zu berichten, dass ab Driekönninge de Daach länge, jeden Daach ene Hahneschrej (dass ab dem Dreikönigsfest die Tage täglich um einen Hahnenschrei länger werden). Diese Weisheit ist nicht aus der Luft gegriffen.
längelang
Vielfach auch längelangs, eine etwas verschrobene Wortbildung mit der Bedeutung „der Länge nach, in voller Länge.“ Artverwandt ist längkelang, basierend auf Längk als Mundartwort für „Länge.“ Längelang wird seltsamerweise ausschließlich im Zusammengang mit „fallen“ oder „liegen“ gebraucht, ein Baum beispielsweise steht niemals längelang huh (der Länge nach in die Höhe), sehr wohl dagegen liegt er längelang am Boddem (am Boden). Beim Sööke spelle (Versteckspiel) kroch ich in ein zwei Meter langes Heugebläserohr und ließ es von Mitspielern aufrichten. Der „Sucher“ wippte trotz meines verzweifelten Gebrülls so lange an meinem Versteck, bis es umfiel und längelang am Boden lag. Ein fürchterliches Gefühl: Umfallen und sich nicht abstützen können. Ich bin nie wieder in ein Gebläserohr gekrochen. Ein geradezu klassisches Längelang widerfuhr seinerzeit dem Dörfer Original Stombs Wellem. Auf dem Heimweg von der Kneipe geriet er mit dem Bordstein in Konflikt und lag längelang en dr Kulang (Rinnstein). Das war der Tag, an dem in Blankenheimerdorf „Pfingsten auf Ostern fiel“ (Siehe: Stombs Wellem).
Langfahrt
Mundartwort für den „Baum“ am Acker- oder Erntewagen, lokal auch Lankert genannt, zum Beispiel in Nonnenbach. Der Langfahrt oder „Wagenbaum“ war und ist die starre Verbindung zwischen Vorder- und Hinterachse und ermöglicht durch Verschieben des Hinterschemels die Verlängerung oder Verkürzung des Fahrzeugs. Das war unter anderem für den Transport von Langholz (Langfahrt) erforderlich oder bei der Umrüstung des Ackerwagens zum Leiterwagen für die Heu- und Getreideernte. Der Leiterwagen war zur Erhöhung der Ladekapazität immer etwa einen Meter länger als der Alltags-Kastenwagen, erforderte also einen längeren Wagenbaum. Beim verkürzten Ackerwagen ragte der Langfahrt entsprechend am Wagenheck heraus und das war hinderlich, beispielsweise für den „Bremser“ an der Kanegg (Bremsvorrichtung). Andererseits bot sich hier dem Bremser die Gelegenheit zum Aufsitzen während der Fahrt. Meistens jedoch legte sich der Wagenbesitzer zwei Langfahrten zu, die an die erforderliche Wagenlänge angepasst waren. Der Eifeler Langfahrt war aus einem etwa zehn bis zwölf Zentimeter dicken Rundholz hergestellt, meistens ein schnack (gerade) gewachsener junger Fichtenbaum.
längs
Die Bedeutung ist generell „entlang, vorbei,“ aber auch die Standardsprache kennt längs etwa bei der Beschreibung eines Gegenstandes. So schneidet man beispielsweise ein Steak nicht längs (in Richtung der Fasern), sondern quer, und „Ein Jäger längs dem Weiher ging“ ist ein altbekanntes deutsches Volkslied. Unsere Mundart kennt längs in einer Vielzahl von Alltagsausdrücken und Redewendungen, wobei regional auch langs oder lans gebräuchlich ist. Loss mech ens längs ist die Aufforderung, aus dem Weg zu gehen oder Platz zu machen. Jangk längs heißt wörtlich „geh vorbei,“ wird aber auch im Sinne von „kümmere dich nicht drum“ (das geht dich nichts an) gebraucht. Em Längsjohn ist „im Vorübergehen,“ sech drlängs däue heißt „sich an etwas vorbei drücken,“ dat wor drlängs (das war vorbei) kommentieren die Kegelbrüder einen „Pudel,“ und wenn man eine günstige Gelegenheit verpasst, so nennen wir das längs de Nas John (an der Nase vorbei gehen). Längs de Dürre john ist unser Ausdruck für „Klinkenputzen,“ und dat os noch net längs Schmitz Backes besagt, dass eine Auseinandersetzung noch nicht ausgestanden ist. Wenn gelegentlich der Hammer das Ziel verfehlt und haarscharf am Daumen vorbei trifft, stellen wir erschrocken fest: Dunnerkiel, dat jing nitsch längs dr Domme, und wenn sich auf schmaler Straße zwei Fahrzeuge begegnen, haben sie oft Mühe, längsenanner ze komme (aneinander vorbei zu kommen). Ein altes, aber weises Sprichwort besagt: Wä längs de Brämelsheck jeht, bliev jähr en de Döör hange. Das heißt wörtlich: Wer an der Brombeerhecke vorbei geht, der bleibt leicht in den Dornen hängen, – im übertragenen Sinne: Man soll die Gelegenheit (zu etwas Schlechtem) meiden, oder auch: Gelegenheit macht Diebe.
längsam
Ein typisches Dörfer Wort, das allerdings heute so gut wie ausgestorben ist und durch das allgemein übliche hochdeutsche „langsam“ ersetzt wird. Etwas abgewandelt hieß es oft auch längßem, die Senioren erinnern sich noch. Nu maad längsam on jaacht mir die Dier net (Nehmt euch Zeit und jagt mir die Tiere nicht) wurden die Hütejungen ermahnt, wenn sie mit dem Vieh auf die Weide zogen. Wenn eine Arbeit nicht nur längsam, sondern auch noch besonders sorgfältig oder vorsichtig zu erledigen war, hieß die Aufforderung dohn höësch (mach langsam, sei vorsichtig). Wenn der Hausherr sein Mittagsschläfchen hielt, wurden die Pänz beim Spielen angewiesen: Doot höësch, Pap schläf. Ab dem Dreikönigsfest (06. Januar) verlängert sich das Tageslicht um täglich einen Hahnenschrei, wie der Volksmund weiß. Bei unseren Eltern hieß das: längsam längen ad de Daach. Entgegen Mutters Mahnung hatte ich zu hastig gegessen, bekam en Jrömmel en de Trööt (verschluckte mich), musste fürchterlich husten und Mam kommentierte: Siehste, dat kött drvan, wenn mr net hüet, ech han dir honnertmool jesoot, de solls längsam eiße (das kommt davon, wenn man nicht gehorcht, ich habe dir hundertmal gesagt, du sollst langsam essen).
Lappe
Ein heimisches Mundartwort mit verschiedenartiger Bedeutung. Dem hochdeutschen Lappen fehlt im Eifeler Dialekt das n: Spöllappe, Botzlappe (Spültuch, Putztuch). Besonders der Spöllappe war bei uns Kindern verhasst, der ewig feuchte Fetzen duftete nicht besonders appetitlich. Bei uns daheim gab es den speziellen Fahrradlappe, ein besonderes Putztuch zum Reinigen der Metallteile. Auch eine Überlage auf dem beschädigten Fahrradreifen, - im Krieg eine gängige „Mantelreparatur,“ nannte man Fahrradlappe. Diese Art Lappe konnte sich bei Betätigung der Vorderradbremse unliebsam bemerkbar machen. Wenn die Schuhsohle verschlissen war, hieß das bei uns: dr Lappe oß affjeloufe. Ein redseliger oder schwatzhafter Mitmensch war ein Schwaadlappe, oft auch Schwaadschnöß (Maulheld) genannt. Und wenn der Stammkneipenwirt eine Runde spendierte, hob er das Glas und meinte: Dann losse mir os noch ens dr Lappe naß maache (übertragen = die Zunge anfeuchten). Ein zu allen Zeiten begehrter und kostbarer Lappe war und ist der Führerschein. Ein kleineres Stück Wiese oder Ackerland wurde gelegentlich auch Lappe genannt, bei der Ernte beispielsweise: Ech moß om Botze (Flurbezeichnung) noch ene Lappe Haver endohn (…Hafer ernten).
lappe
Das Tätigkeitswort lappe ist vom Hauptwort Lappe in der Bedeutung von „Schuhsohle“ abgeleitet. Wenn de Lappe affjeloufe waren, mussten die Treter neu jelapp (gelappt = besohlt) werden. In den mageren Kriegs- und Nachkriegsjahren wusste selbst der Dorfschuster nicht an Arbeitsmaterial zu kommen, die Schuhsohlen verschlissen aber nicht weniger als in Friedenszeiten und die Leute waren zu oft abenteuerlicher Selbsthilfe gezwungen. Als Lappmaterial dienten häufig zerschnittene alte Autoreifen. Das Zurechtschnippeln allein war schon eine Heidenarbeit und manches kostbare Teischemetz (Taschenmesser) ging dabei zu Bruch. Schwierig war auch die Beschaffung geeigneter Nägel fürs Befestigen an der Brandsohle, und wenn es Nägel gab, dann waren sie nur mühsam durch den zähen Reifengummi zu treiben. Ein Nagelständer oder Dreifuß war zwar meistens vorhanden, das Umschlagen der Nagelspitzen im Schuhinneren wollte aber gekonnt sein, ansonsten waren Wundstellen an der Fußsohle und löchrige Strümpfe die Folge. Das Ganze war schließlich jelappte Kroom (gelappter Kram) oder Lapperej, Ausdrücke, die heute noch bei stümperhafter Arbeit angewandt werden.
Läppere
Wenn heutzutage ein Messer stumpf wird, die Schere nicht mehr richtig schneidet, der Emailletopf ein Loch hat und der Schirm sich nicht mehr aufspannen lässt, dann wandert das Gerät in die Mülltonne und wird durch Neues ersetzt: Die Reparatur wäre teurer. Unsere Eltern ließen die Dinge beim Scherenschleifer, Kesselflicker oder Schirmmacher reparieren. Diese fahrenden Handwerker suchten nämlich in bestimmten Abständen die Eifeldörfer auf und boten für ein paar Pfennige den Leuten ihre Dienste an. Oftmals wurden die Läppere (Sammelbegriff für fahrendes Volk) sehnlichst erwartet, manchmal eilte ihnen aber auch ein Warnruf voraus: De Weisch van dr Leng, de Hohner en dr Stall, de Läppere sin onnerwächs (Die Wäsche von der Leine, die Hühner in den Stall, die Läppere sind unterwegs). Die Läppere kampierten gewöhnlich außerhalb der Ortschaften im freien Gelände oder Wald. Es mag vorgekommen sein, dass nach ihrem Abzug in Dorf das eine oder andere Huhn oder Hemd vermisst wurde, die Regel war es aber nicht. Trotzdem: Den fahrenden Leuten hing ein gewisser negativer Ruf an, den sie niemals los wurden. Auf gar keinen Fall waren die Läppere mit den Hausierern gleichzusetzen, die sich nicht selten eines besonders guten Leumunds erfreuten, beispielsweise der in der gesamten Eifel beliebte Stotzemer. Seinen richtigen Namen kannte niemand, er wurde nach seinem Wohnort Stotzheim benannt, ich habe ihn noch gut gekannt. Ich erinnere mich auch an einen Scherenschleifer, der noch anfangs der 1970-er Jahre zu uns kam, und an eine Korbmachergruppe aus derselben Zeit. Einen zeitgemäßen Scherenschleifer sah ich sogar noch in 2018: Der Mann hatte einen Kleinbus zum Werkstattwagen umgebaut und arbeitete mit modernen Maschinen.
Lateng (weiches e)
Das Wort wird mit gedehntem ng gesprochen, wie beispielsweise in „Gesang,“ der Kölner sagt „Lating“ und der Holländer „Latijn,“ gemeint ist in allen Fällen die Amtssprache des römischen Reiches und des Vatikans, das Latein, das auch heute noch besonders am humanistischen Gymnasium als erste Fremdsprache gelehrt wird. Mit Lateng kam ich erstmals im Jahr 1947 in Kontakt. Im Privatunterricht bei Dechant Hermann Lux lernte ich „flamma flagrat“ und „agricola colat,“ mein großes Problem waren die unzähligen grammatikalischen Begriffe, von denen ich keinen einzigen kannte, das „Pronominaladjektiv“ oder die „Deklination der Komparative“ bereiten mir heute noch Kopfschmerzen. In der Volksschule gab es keinen einzigen lateinischen Ausdruck, wir kannten keinen „Artikel,“ kein „Plus“ oder „Minus“ und schon gar keinen „Genitiv“ oder „Konjunktiv.“ Weil ich also Lateng lernte, durfte ich die Eingangs-Sexta am Gymnasium Steinfeld überspringen, begann in der Quinta, – und war meinen Mitschülern gegenüber eine „lateinische Null.“ In meinem Regal steht noch die Lateingrammatik aus dem Jahr 1949, „Ludus Latinus“ heißt das Werk und das bedeutet „lateinisches Spiel, – dabei ist Lateng alles andere als ein Spiel. Dä kann Lateng, dä wiëd Pater, zo dem moßte höflich sen (Der kann Latein, der wird Pater, zu dem musst du höflich sein) hetzte daheim der Nachbar seinen Sohn auf, wenn ich in der Nähe war. Eine ähnliche Situation erlebte Ludwig Thoma als „Lateinschüler“ in seinen „Lausbubengeschichten.“
Latz
Die Eifeler Latz ist ein langes schmales, in der Regel vierkantiges und auf bestimmte Längen geschnittenes Stück Holz: Die Latte. Gelegentlich kann auch eine runde Stange als Latz gelten, beispielsweise die Bonnelatz (Bohnenstange). Latze gibt es auch im Sport: Die Torlatz etwa oder die Spronglatz (Sprunglatte, Sprungstab). Die bekannteste Latz ist wohl die Daachlatz (Dachlatte). In Verbindung mit der Latz gibt es eine ganze Menge Redewendungen meist doppelsinniger Art und mit verstecktem Spott. Von einem langen und dünnen Menschen wird behauptet, er könnte sich honner ener Latz verberje (hinter einer Latte verstecken), und wer in den Augen seiner Mitmenschen nicht ganz bei Trost ist, von dem vermutet man: Dä hät se net all op dr Latz. Im Zugabteil stellte Fränz seine langen Beine unter den Sitz seines Gegenüber und der meinte erbost: Dohn deng Latze do fott (fort). Der eifrige Sparer hatte im Volksmund en joot Latz op dr Kass (eine schöne Stange Geld auf der Bank). Hiervon ist vermutlich auch latze im Sinne von „blechen, berappen“ abgeleitet. In der Weiberdonnerstagnacht 2014 hatten Unbekannte in der „Woltersgasse“ (Dorfstraße) eine Menge Zonglatze (Zaunlatten) an mehreren Gartenzäunen abgerissen. Dazu gehörte Muskelkraft, um einen Kinderstreich kann es sich nicht gehandelt haben.
leddich
Das Wort bedeutet „leer“ und ist mit dem hochdeutschen „ledig“ verwandt. Ledig im Sinne von „unverheiratet“ heißt unterdessen in Dörfer Platt laus-leddich und das wiederum bedeutet wörtlich übersetzt „lose (locker) - leer“. Es gab stehende Redensarten, beispielsweise Üs enem leddije Pötz oß et schlech scheppe (Aus leerem Brunnen ist schlecht schöpfen) und von einem Zecher hieß es: Dä süff, boß hä voll on et Pottmanee (Portmonee) leddich oß. Wenn Albertchen stekum (unauffällig) vom Mittagstisch aufzustehen trachtete, nagelte ihn der elterliche Befehl an den Platz: Hiejeblewwe (hier geblieben), dä Teller oß noch net leddich! Früher war auch dä Kaaste stejt ad e halev Johr leddich (der Kasten steht schon ein halbes Jahr leer) gebräuchlich, wobei Kaaste eine abwertende Umschreibung für „Gebäude“ war. Heute käme in diesem Fall mit ziemlicher Sicherheit „leer“ zur Anwendung. Dasselbe gilt für dronk deng Tass leddich (Trink deine Tasse leer). Den Hunger umschrieb man früher mit et oß mir esu leddich em Buch (es ist mir so leer im Bauch), und eine Weisheit unserer Eltern besagt: Nöü Kirche on nöü Wiëtshuuser stohn niemools leddich (Neue Kirchen und neue Wirtshäuser stehen niemals leer), und das war ein Döüj (Anspielung, „Hieb“) auf die Neugier der Menschen. Eine weitere Weisheit: E leddich Schaaf brengk Onverdraach könnte man mit „Leerer Schrank bringt Streit und Zank“ übersetzen. Das alte Mundartwort leddich nur noch wenigen Senioren geläufig, es hat dem standardsprachlichen „leer“ Platz gemacht.
leeje
Eifeler Wort für „lügen“, örtlich auch „lurre,“ beispielsweise in Nettersheim. Du solls net leeje, mahnte Jött, wenn wir Kinder etwas „verbrochen“ hatten und erwischt wurden, lüchs du och net? unterbrach sie mein „Geständnis“ und stellte zum Schluss fest: Du häß jo doch jeloëje! Wer öfter log, der war als Luchpitter oder auch als Lüjener (Lügner) unbeliebt. Das Wort „Lüge“ wurde im Dialekt umschrieben: Dat oß Leejerej (Lügerei) oder einfach dat oß jeloëje. Ein spezielles Wort für „Lüge“ gab es nicht, allenfalls den Ausdruck Luch, was soviel wie „Lug“ bedeutet. Ech beleejen dech net oder auch loss mech net leeje sind Wahrheitsbeteuerungen, die eigentlich überflüssig sein sollten (siehe: ihrlich). Vom notorischen Lügner wird behauptet: Da kann leeje ohne ruët ze were (…ohne rot zu werden), und wenn wir Pänz der Lüge überführt wurden, hieß es drohend: Du häß jeloëje, du köß (kommst) en de Höll, - bei Algemeingültigkeit dieser Behauptung wäre die Hölle überfüllt. Eine unglaubhafte Geschichte wird kommentiert: Do häßte dir äwwer jät zesame jeloëje! Und eine gehässige, aber gebräuchliche Behauptung lautet: Wä lüch, dä klaut, dä friß och klejn Konner (Wer lügt, der stiehlt, der frisst auch kleine Kinder). Das holländische Wort für unser leeje ist übrigens „liegen.“
Lennert (weiches e)
Lennerte, häufiger aber noch Linnerte, war vor 50 und mehr Jahren ein in den Oberahrortschaften übliches Schmähwort für die Bewohner von Blankenheim, das aber seit der kommunalen Neuordnung 1969 mehr und mehr aus der Mode kam und heute fast vergessen ist. Lennert ist die volkstümliche Berufsbezeichnung des Leinenwebers und somit keineswegs ein Schimpfwort. In Blankenheim gab es aber früher Leinenweber, die offensichtlich in der Bevölkerung nicht besonders hoch geschätzt wurden, denn nach ihnen erfand man das Schmähwort. Zwischen Blankenheimerdorf und Blankenheim bestand früher eine regelrechte Fehde, deren Ursprung heute nicht mehr nachvollziehbar ist. Wenn Blangemer Lennerte und Dörfer Wendböggele (Windbeutel) aneinander gerieten, gab es nicht selten blutige Köpfe. Das aber war zu Großvaters Zeiten und ist heute längst nicht mehr wahr. Noch zur Zeit unserer Eltern war Lennert nicht nur das erwähnte Schmähwort, sondern auch eine Bezeichnung für eine verkommene, unordentliche Person, insbesondere hinsichtlich der Kleidung. Ein verwahrloster Landstreicher beispielsweise war ein Lennert, und wenn ich mir beim Spielen en Fönef em Botzebejn (einen Riß im Hosenbein) zugezogen hatte, wurde unverzüglich die Kleidung gewechselt, denn Mam war unerbittlich: Du löüfs mir net wie ene Lennert eröm.
Lentche (weiches e)
Das Lentche hat mit dem Frauennamen „Lenchen“ nicht das Geringste gemeinsam. Das Lentche, mancherorts auch Löntche ausgesprochen, ist ein langer schmaler Papierstreifen, eine Luftschlange. Zu unserer Kinderzeit im und nach dem Krieg waren Lentcher (Mehrzahl) rar und bei uns Kindern als Spielmaterial begehrt. Es gab sie eigentlich nur beim Rosenmontagszug in Blankenheim zu ergattern, wir sammelten möglichst viel davon, klebten daheim die Teile aneinander und rollten sie auf: Je größer die Rolle, desto wertvoller das Spielzeug. Lentcher fielen auch beim Tapezieren ab: Die etwa 15 Millimeter breiten Randstreifen der Rollen, die dem Schutz vor Beschädigungen beim Transport dienten und an einer Längsseite vor dem Kleben abgeschnitten werden mussten. Wegen der oft buckligen Lehmwände im Eifelhaus, war das „Anstoßen“ der Tapetenbahnen schwierig, sie wurden daher in Breite des Schutzrandes überlappend geklebt. Im Interesse von uns Kindern war man bemüht, beim Abschneiden des Randstreifens mit der Schere das Lentche über die 10 Meter Rollenlänge heil zu lassen. Auch hier klebten wir die Einzelstücke aneinander, das ergab dicke und stabile Rollen. Unser Klebstoff war eine gekochte Kartoffel, die wegen ihres Gehalts an Stärke diesen Zweck bestens erfüllte.
Lewwerwuësch
Die Erinnerung an die Wuëschdaach (Wursttage) meiner Kinderzeit weckt Gelüste mannigfacher Art. Das war stets zwei oder drei Tage nach der Schlachtung unserer, mit viel Liebe und Mühe hochgepäppelten Sau. Beim Wuëschte (Wursten, Wurstherstellung) war bei uns daheim immer Gretchen Lux als Expertin mit von der Partie, die Cousine und Haushälterin unseres Pfarrers war beinahe berühmt ob ihrer Wurstkenntnisse. Eine besondere Spezialität der häuslichen Wursterei war die Lewwerwuësch (Leberwurst), die ich in der Konsistenz und Geschmacksfülle unseres heimischen Produkts bis heute niemals mehr gekostet habe. Im Supermarkt gibt es „Hausmacher“ mannigfacher Art, an unsere Lewwerwuësch reichte bisher keine einzige heran. Unsere Leberwurst sah etwas unscheinbar grau aus, aber sie mundete köstlich, sowohl ganz frisch und nur „abgehangen“ als auch später, gut angeräuchert und etwas hart aus dem „Fliegenschrank.“ Am Wursttag durchzogen herrliche Kochdüfte das Haus: im großen Apparatekeissel (Einkochkessel) garten Herz, Leber und bestimmte Fleischteile des Schlachttiers. Das Durchdrehen durch die handbediente Wuëschmaschin (Wurstmaschine, Fleischwolf) übernahmen wir Kinder höchst bereitwillig, denn dabei fiel immer wieder ein Stückchen Leber oder Herz zum „Probieren“ ab. Und die Wuëschbrööt (Wurstbrühe) war nicht weniger delikat als die Lewwerwuësch, aus der sie hervorgegangen war.
Liëch
Im Dörfer Dialekt das Wort für „Licht,“ in anderen Eifelregionen auch Liët gesprochen, beim Nachbarn Nettersheim heißt es Leet und weiter nördlich im Raum Köln wird daraus Leech. Liëch ist das Wort für jede Art von Licht, sei es natürlicher oder künstlicher Art. Es gibt eine Vielzahl von Redewendungen, jank mir üß dem Liëch (geh mir aus dem Licht) ist beispielsweise die Aufforderung, den Lichteinfall nicht zu behindern, im übertragenen Sinne also Platz zu machen. Häufig heißt es bei solcher Gelegenheit auch jank mir üß dr Sonn (aus der Sonne). Einen einsilbigen, zurückhaltenden Mitmenschen bezeichnen wir als Drüchliëch (wörtlich = Trockenlicht), und Josef Franzen, der Besenbinder von Reetz, schnitt die Birkenreiser für seine Erzeugnisse bei jongk Liëch (junges Licht = Neumondphase, zunehmender Mond), weil das Material dann besonders elastisch und bruchsicher war. Für unsere Eltern war der elektrische Strom in erster Linie Lichtspender und damit allgemein et Liëch (das Licht), das bei uns daheim über ein paar Drähte direkt aus dem Transfomater (Transformator, Freiluftkonstruktion) neben dem Haus kam. Strom kostete Geld, onnüedich et Liëch verbrenne (unnötig Strom verbrauchen) war schon fast ein Verbrechen. Die Leistung der elektrischen „Birnen“ im Eifelhaus durfte 40 Watt nicht übersteigen, stärkere Lampen hätten zuviel Liëch „verbrannt.“
liëch
Gleichartig ausgesprochen wie Liëch, im Sprachgebrauch aber ein Eigenschaftswort (Adjektiv) mit der Bedeutung „leicht.“ Ein paar Beispiele: En liëch Ärbed (eine leichte Arbeit), liëch ze roode (leicht zu erraten), esu liëch wie en Fedder (leicht wie eine Feder), liëch berchop (leicht bergan), e liëch Züppche (ein gut verträgliches Süppchen), en liëchte Ratsch (eine kleine Verletzung). Von ganz spezieller Bedeutung ist e liëch Fraumensch (ein leichtes Mädchen), und mot Liëchtichkejt heißt „mühelos.“ Ein „stehender Ausdruck“ ist maachliëchs, zwecks leichterer Aussprache meistens in maachliëß umgewandelt. Maachliëchs ist zusammengesetzt aus „mag leicht sein“ und bedeutet damit „leicht möglich, möglicherweise.“ Mattes betrachtete eingehend seine hochträchtige Kuh und meinte dann: Ech blieven dies Nääch op, maachliëß, dat os Schwitt höck noch kalev (Ich gehe diese Nacht nicht zu Bett, womöglich kalbt unsere Schwitt (Kuhname) heute noch). „Vielleicht“ müsste eigentlich in unserem Dialekt villiëch heißen, ist aber im Lauf der Zeit über villich und vlich auf vliëts abgewandelt worden. Von einem schnell aufbrausenden Menschen sagt man: Dä oß liëch opjerääch, als Unbeteiligter hat man über eine unangenehme Sache liëch kalle (leicht reden), und ein oberflächlicher Mitmensch wird als liëchlewwich (leichtlebig) eingestuft.
Liem
Der natürliche Lehm war früher das Binde- und Klebemittel zum Verputzen der Fachwerkflächen und Innenwände beim Hausbau, im Volksmund Liem genannt. Das Mundartwort übertrug sich später auf den künstlich hergestellten Leim, den es lange Zeit nur als „Heißleim“ gab. Noch um 1950 kochte und brodelte in Vaters Schreinerwerkstatt unablässig das Liemdöppe (Leimtopf) auf dem Kanonenofen und verbreitete einen charakteristisch-penetranten Geruch. Irgendwann kam der „Kaltleim“ auf den Markt, wegen seiner Farbe auch „Weißleim“ genannt. Die Vorbereitung und Verarbeitung war sehr viel einfacher als beim Heißleim, das grobe weiße Pulver wurde mit Wasser verrührt und fertig war der Liem. Ich weiß noch, dass es bei uns „Propeller-Kaltleim“ gab, der seinen Namen der Tatsache verdankte, dass noch im zweiten Weltkrieg viele Flugzeugpropeller aus Holzverbund hergestellt wurden. Vater besaß ein handgroßes Propellersegment, das aus vielen zusammengeleimten Schichten eines rotbraunen Hartholzes bestand. Üß dem liem jejange (aus dem Leim gegangen) ist die übliche Redewendung für Beschädigungen eines Möbelstücks, das klassische Beispiel hierfür ist der wackelige Stuhl.
Liemfärv
Während Kalekbrööt in erster Linie für den Außenansrich gebraucht wurde, kam im Innenbereich eher Liemfärv (Leimfarbe) zur Anwendung. Grundstoff war meistens Knidd (Kreide) mit Knochenleim als Bindemittel vermischt. Liemfärv ergab einen dauerhaften Anstrich, der nicht wie Kalkfarbe leicht abzureiben war. Sie blieb allerdings auch nach dem Abtrocknen wasserlöslich und war somit für den Außenanstrich nicht verwendbar. Ein besonderer Vorteil der Liemfärv war, dass sie ohne die sonst erforderlichen Grundierungen beliebig oft immer wieder mit Leimfarbe überstrichen werden konnte. Die Leimfarbe war naturgemäß wesentlich teurer als Kalekbrööt, es gab sie fertig angemacht oder in der billigeren Pulverform, die bei uns daheim zur Anwendung kam. Die Vorbereitung der Farbe glich dem Ansetzen von Tapetenkleister. Das Pulver wurde mit Wasser angerührt, – ein anstrengender Vorgang, weil es bei uns keinen elektrischen Quirl gab und die Masse bald zähflüssig wurde. Für unsere Küchenwände musste die Farbe leicht gelblich getönt werden und das bedeutete doppelt intensives Umrühren, nach kurzer Zeit schmerzten die Arme. Der angerührte Farbbrei musste eine halbe Stunde lang „quellen,“ wurde nochmals umgerührt und war dann streichfertig.
nach oben
zurück zur Übersicht
Liempott
Der Liempott, auch Liemdöppe, war und ist der Leimtopf, dem der Dorfschreiner gelegentlich den Spitznamen Liempott verdankte. Es gab auch das geflügelte Wort Dr Liempott os dem Schrenger senge Herrjott (Der Leimtopf ist des Schreiners Herrgott). Tatsächlich war dieser Topf aus der Schreinerwerkstatt nicht wegzudenken. Der Heißleim wurde in kleinen braunen Tafeln geliefert, was ihm auch den Namen Tafelliem eintrug. Diese harten Tafeln mussten in Wasser aufquellen und danach im Wasserbad erhitzt werden. Der dadurch flüssig gewordene Leim musste in Windeseile verarbeitet werden, die Brühe kühlte nämlich relativ rasch ab und dickte ein. Der Liempott war das Wasserbad, in dem der eigentliche Leimbehälter bis auf etwa 75 Grad erhitzt wurde. Bei höherer Temperatur verlor der Liem einen Teil seiner Klebkraft, das Wasser durfte also nicht kochen. Der Heißleim wurde aus Knochen und tierischen Abfällen hergestellt und war über Jahrhunderte hinweg bis nach 1950 d a s Klebemittel in der Möbelindustrie, – ein Beweis für seine Qualität. Heute ist er durch moderne Kaltkleber weitgehend abgelöst. Ausschließlich aus organischen Stoffen bestehend, ist der Knochenleim absolut unschädlich und umweltfreundlich. Im Krieg mussten wir Schulkinder intensiv Knochen sammeln und beim Lehrer abliefern: Rohstoff für die Herstellung von Leim und Filmmaterial.
liëne
Unser Wort für „leihen, ausleihen, borgen.“ Regional, beispielsweise in Nettersheim, ist lenne (mit weichem e gesprochen) üblich oder auch lönne (weiches ö). Unser liëne wird mancherorts auch in liehne abgewandelt. Unverkennbar ist in jedem Fall die Verwandtschaft mit dem holländischen lenen. Ums Leihen und Borgen ranken sich zahlreiche Redensarten. Von einem Geizkragen wird beispielsweise behauptet: Dä hät alles, äwwer watte bruch, dat jehte sech liëne, und damit wird gesagt, dass der Geizkragen sich den Alltagsbedarf leiht, um seine eigenen Sachen zu schonen. Früher gab es auch den Ausspruch Du kanns mir en Mark liëne als Umschreibung des Götz-Zitats. Unbeliebt sind „vergessliche“ Zeitgenossen, von denen der gutgläubige Verleiher sein Eigentum zurückfordern muss. Einem solchen Kunden borgt man nur widerwillig etwas mit dem Hinweis: Ech liënen et dir, äwwer verjeiß et Wierbrenge net (vergiss das Wiederbringen nicht). Oder es ergeht auch der Hinweis: De näks Kier kreßte de Katz jeliënt, die kött vanselever wier (Das nächste Mal leihe ich dir die Katze, die kommt von selber zurück). Ein Eifelbauer wollte von seinem als kniestich (geizig, knauserig) bekannten Nachbarn dessen Esel ausleihen, erhielt aber die bedauernde Auskunft, das Tier sei im Augenblick an den Vetter ausgeliehen. Just in diesem Moment tönte vom Stall her lautes Eselgeschrei und der Bittsteller meinte vorwurfsvoll: „Du hast mich belogen, da schreit der Esel ja,“ worauf sich der Geizige erboste: Wem jlöüvs du dann mieh, dem Essel oder mir? (Wem glaubst du denn mehr, dem Esel oder mir)
Liev
Hochdeutsch „Leib, Körper“ und generell männlichen Geschlechts. Im Dialekt allerdings wird der Leib bei bestimmten Redewendungen geschlechtslos: et Liev (es Leib = das Leib). Da bestimmte beispielsweise Mam (Mutter) beim Frühstück: Eiß, domot de jät en et Liev kreß (wörtlich: Iß, damit du etwas in das Leib kriegst). Und im Kreis der Freundinnen berichtete Berta: Dä Klööß woll mir an et Liev, - jung, dem han ech et äwwer jezejch. Sie hatte sich also erfolgreich gegen die Aufdringlichkeit von Klöös (Klaus) gewehrt. Der neutrale Mundart-Leib stammt aus dem Holländischen, dort nämlich ist „lijf“ onbepaald (sächlich, Neutrum), unsere Buchpeng (Bauchschmerzen) bezeichnen die Holländer als „pijn in het lijf“ (Schmerzen in das Leib). Einige weitere Redewendungen: Nix em Liev han (nüchtern sein), mot Liev on Siël bie dr Saach (Mit Leib und Seele bei der Sache), dr Düvel em Liev han (den Teufel im Leib haben), lebendijes Lievs (bei lebendigem Leibe). Speziell mit Bezug auf Bauch und Magen, wird Liev häufig durch derbe Ausdrücke ersetzt: Panz, Balech, Wampes, Puttes. Das ist zwar beinahe Gossensprache, im Eifeler Alltag aber gar nicht so selten und eher ironisch gemeint.
Lievje
Wenn Liev der Leib ist, dann ist Lievje zwangsläufig das Leibchen. Mit dem Lievje sind zum Teil nicht so besonders angenehme Kindheitserinnerungen verbunden. Bei uns gab es zweierlei Lievjer (Mehrzahl): Das Ovverlievje (Ober-, Überleibchen) und als Gegenstück das Onnerlievje (Unterleibchen). Im Vorschulalter gehörte zur Alltagskleidung der Jungen die Schladerbotz (wörtlich = Klappenhose), deren Hosenboden, die so genannte Schlader, mit Knöpfen am miederartigen Oberteil befestigt und im Bedarfsfall blitzschnell herunter zu klappen war. Das konnte in eiligen Fällen nützlich sein, zumal es auch darunter meistens keine Unterhose gab. Das Mieder wurde hier Ovverlievje genannt, weil es „über“ der Unterkleidung getragen wurde. Mit Beginn der Schulzeit zogen wir natürlich keine Schladerbotz mehr, an, wohl aber nach wie vor lang Strömp (lange Strümpfe), und die wurden durch Strombännele (Strumpfbänder, Strapse) am Onnerlievje befestigt. Strombännelsjummi (Gummiband) kaufte man als Meterware beim Hausierer, der regelmäßig im Eifeldorf erschien. Die richtige Bezeichnung war Strompbännel, das ließ sich aber schlecht aussprechen und so wurde kurzerhand das p aus dem Wort gestrichen. Die Hosenbeine reichten bis übers Knie, damit der Strombännel völlig verdeckt war. Oft lugte aber doch ein Teil unter dem Hosenrand hervor, und dessen schämte man sich dann.
Loder
Unser Dialektwort für das hochdeutsche „Luder,“ sofern damit eine verkommene, liederliche und allgemein unbeliebte Person gemeint ist. In der Umgangssprache steht Loder allerdings auch für widerspenstige Tiere und sogar für unhandliche oder ungeliebte Gegenstände. Die „Brong,“ eine unserer Kühe, war beispielsweise ein Loderveh (Ludervieh), weil sie des Öfteren aus dem Weidezaun ausbrach. Geradezu klassisch zu nennen ist das geflügelte Wort kromm Loder oder auch krommp Loder (krummes Luder). Damit wurde Alles und Jedes bezeichnet, das irgendwie unangenehm oder unbeliebt war, ob Mensch, Tier oder Sache. Ein paar Beispiele: Verdammp (verdammtes) Loder, jemein (gemeines) Loder, domm (dummes) Loder, dreckich (schmutziges) Loder, Sauloder. Ein besonders knotiges und schwer spaltbares Stück Holz war e fraggich Loder. Wenn wir Halbwüchsige Schabernack trieben, nannten das die Erwachsenen Lodereje drieve (Ludereien treiben) und wir selber waren loderich Männ. Die Kollegen vom Bahnhof Kall kannten seinerzeit den Ausdruck Lodermännche. Und wenn die geizige Hausfrau den Kaffeesatz ein zweites Mal aufbrühte, so nannte man das ejne op et Loder schödde (einen aufs Luder schütten).
lögge (weiches ö)
Ein ähnliches Wort ist logge (weiches o), während allerdings lögge im Sinne von „läuten“ gebraucht wird, gilt logge meistens mehr als Ausdruck für „schreien, heulen, brüllen. Hüer op ze logge, paß nächstens besser op (Hör auf zu heulen, paß nächstens besser auf) schimpfte Mam (Mutter), wenn mir mal wieder der Schwengel von der Kolerawemöll (Rübenschneider) auf die Nase gedonnert war. Wenn dagegen die Kirchenglocken zur Messe riefen, hieß es et os am lögge, maach dech en de Kirch. Interessant ist die frühere Vergangenheitsform: Et hät jelutt heißt „es hat geläutet,“ heute gilt eher et hät jelögg. Zu meiner Messdienerzeit wurde bei der Wandlung im Hochamt eine der Kirchenglocken dreimal mit jeweils drei Einzelschlägen angeläutet, das hieß im Volksmund et lögg halev (es läutet halb = die Messe ist halb), vielfach hieß es auch et kläpp halev. Um die erforderlichen drei Einzelschläge korrekt zustande zu bringen, war eine gute Portion Geschick am Glockenseil erforderlich. Unsere Jött daheim war eine Zeit lang für das Mettechlögge (Mittagläuten) im Nonnenbacher Kapellchen zuständig, sie beherrschte den Doppelschlag des kleinen Glöckchens: Bim-bimbim-bim. Auf die Frage waröm os et do am lögge (weshalb läutet es da), erhielt man früher die verschmitzte Antwort: Weil ejner am Seil züch (Weil einer am Seil zieht).
Lönt (weiches ö)
Die Lönt, gelegentlich auch Lent oder lokal Lönk, bezeichnet den Bauchwandspeck des Schweins, den Flomen, aus dem das feine weiße Schweineschmalz gewonnen wird. Das „Rheinische Wörterbuch“ kennt den hochdeutschen Ausdruck „Lünte“. Bei der Hausschlachtung wurde die Lönt sorgfältig präpariert, nach dem Auskühlen wurde das netzartige Gewebe in kleine Stücke geschnitten und zur Schmalzgewinnung im gusseisernen Kauchdöppe (Kochtopf) ausgelassen. Am Topfboden sammelten sich die Jrewe (Grieben) und die waren, als Griebenschmalz aufs Brot gestrichen, ein besonderer Leckerbissen. Schmalz als Brotaufstrich war beliebt, ebenso beliebt waren mit Schmalz hergestellte Bratkartoffeln. Die Lönt wurde also bei uns daheim bis aufs kleinste Zipfelchen verwertet. Normalerweise wurde unser Schmalz mit einer Prise Salz gewürzt, um den etwas „starken“ Eigengeschmack ein wenig zu lindern. Eine kleine Menge ungesalzenes Schmalz wurde dennoch reserviert: Als Heilmittel bei rissigen Händen. Das Fett hielt die ausgetrocknete rauhe Haut geschmeidig, die blutigen Schronne (Risse, Schrunden) heilten rascher aus. Mit Schmalz „behandelte“ Kinderhände dufteten zwar etwas eigenartig, doch daran gewöhnte man sich.
Lötzert (weiches ö)
Eine Dörfer Flurbezeichnung. Nördlich der Ortschaft steht im unteren Haubachtal die denkmalwerte Lambachpumpe, um deren Restaurierung der Geschichts- und Kulturverein bemüht ist. Das ansteigende Wiesengelände rechts des Bachlaufs wird op Lötzert genannt und heißt in der Flurkarte Lützert. Schon immer gab es auf Lötzert größere Ginsterflächen, hier sammelten wir seinerzeit gelegentlich Körbe voller Ginsterblüten für den Fronleichnamsaltar, das „Eifelgold“ eignete sich hervorragend für den Blütenteppich. In Sichtweite von Lötzert stand noch nach dem Krieg an der Bahnstrecke Köln – Trier ein Bahnwärterhaus. Hier war auch ein Schrankenposten, bahntechnisch „Posten 48“ und im Volksmund Lomberg genannt. Auf Posten 48 tat unter anderem der Schrankenwärter Matthias Struben aus Blankenheimerdorf Dienst, wegen seiner nicht eben riesenhaften Statur Strubens Mättesje genannt. Irgendwie war der trockene Ginster auf Lötzert in Brand geraten und Mättesje meldete aufgeregt durchs Streckentelefon dem Fahrdienstleiter in Blankenheim-Wald: Herr Bahnemeister, der Jinster brüht auf Lützerath. Bekanntlich ist bröhe unser Dialektwort für „brennen,“ der eifrige Schrankenwärter hatte das Wort zu „verhochdeutschen“ versucht.
Lüech
Gesprochen „Lü-ech,“ früher unser Wort für einen „Lichtspender“ jeglicher Art, wörtlich übersetzt „Leuchte.“ Mit der Einweihung des Kraftwerks Heimbach im Jahr 1905, kam der elektrische Strom auch in unsere Eifel. Bis dahin verstand man unter Lüech einzig eine Petroleumlampe, – es gab ja auch im Bauernhaus keine andere Beleuchtung, ausgenommen noch das offene Herdfeuer. Der Standardtyp einer Lüech war die altbewährte Stall-Laterne (Stalllaterne, ein unmögliches Wort) in ihrer Urform mit dem Öltank im Fußsockel und Drahtbügel zum Tragen. Die Stallüech verbreitete für heutige Begriffe nur trübes „Funzellicht“ und musste wegen ihres leicht brennbaren Inhalts und der offenen Flamme mit Vorsicht gehandhabt werden. Für die Beleuchtung von Stube und Küche gab es die Petroleumslüech in eleganterer Form, mit einem Messinggehäuse und einem Glaszylinder auf schön verziertem Sockel. Wurde die Week (der Lampendocht) zu hoch geschraubt, blakte die zu hohe Flamme und der Zylinder wurde schwarz vom Ruß. Die Stejnollichslüech (Stejnollich = Steinöl, Petroleum) gab es daheim noch in den letzten Kriegsjahren, als wir keinen elektrischen Strom mehr hatten. Ich weiß noch, dass die Soldaten ihre Zigarette im konzentrierten Hitzestrahl des Lampenzylinders anzündeten. Petroleum gab es nur auf besonderen Bezugsschein, gelegentlich halfen auch die Soldaten mit dem kostbaren Brennstoff aus. Manchmal wurde sogar nur die Tür des eisernen Kanonenofens geöffnet und wir hockten beim düsteren Flackerschein in der Stube. Die Schlafzimmerbeleuchtung bestand aus einer Stearinkerze auf dem obligatorischen tellerartigen, flachen und weiß emaillierten Ständer, wie ihn der „Nachtwandler“ auf der Werbung eines bekannten Abführmittels in der Hand trägt.
Luh
Das Wort bedeutet „Lohe,“ doch ist damit kein Brand oder Feuer bezeichnet, sondern die „Gerberlohe,“ die bei der Lederherstellung gebraucht wurde. Luh wurde aus Baumrinde gewonnen und zwar überwiegend aus jungem Eichenholz. Als Fünf- oder Sechsjährigen hat mich Ohm Mattes (mein Onkel Matthias) noch mit zum Luhschälle (Lohe schälen) in den Wald genommen: Im Südhang der „Hardt“ war eine Fichtenkultur, in der sich Wildwuchs aller Arten ansiedelte, unter anderem auch viel Eichengebüsch. Die Rodung der Wildgewächse wurde losweise an Interessenten vergeben, für die dabei anfallende Eichenlohe gab es ein paar Pfennige extra. Ohm Mattes arbeitete nebenbei häufig im Wald und übernahm auch ein Luhloss (Lohelos). Zunächst wurde der Birken- und Buchenwildwuchs entfernt und das hierbei anfallende Brennholz abgefahren. Im zweiten Durchgang wurde das Luhholz geschlagen und die jungen Eichenstämmchen ihrer Rinde beraubt. Die Zeit hierfür war auf den Monat Mai beschränkt, weil hier die Rinde leicht abzuschälen war. Das Werkzeug fürs Loheschälen war das Luhmetz (Messer), auch Krömmche genannt, ein buschmesserartiges Hieb- und Schneidegerät mit scharfer gebogener Spitze. Die Rinde wurde am Stamm entlang eingeritzt und ließ sich dann als Ganzes lösen. Aus den geschälten Knüppeln wurde eine gitterartige Unterlage gebaut, auf der die Lohestücke zum Trocknen vor Ort aufgeschichtet wurden. In einem Sammeltransport wurde später die trockene Luh an die Gerberei geliefert, das Luhholz konnte noch als Brennholz verwendet werden. Ich weiß noch, dass unsere letzte Luhpartie aus Kriegsgründen nicht mehr abgeholt wurde, Ohm Mattes hat sie später heim gefahren und im Backofen verbrannt.
Luhmetz
Das Lohmesser ist ein heute nicht mehr gebrauchtes Spezialwerkzeug, im Museum ist es noch zu finden. Zu meiner Kinderzeit gab es bei uns daheim ein Luhmetz, ich weiß nicht, wo es abgeblieben ist. Die Gewinnung von Eichenlohe war damals noch ein Nebengeschäft der heimischen Forstwirtschaft, allerdings ein wenig einträgliches Geschäft, das dann auch bald eingestellt wurde (siehe: Luh). Im zweiten Weltkrieg stieg noch einmal der Bedarf an Eichenlohe, weil es die zum Gerben von Tierhäuten erforderlichen chemischen Mittel nicht gab. Ab etwa 1955 wurde die Lohegewinnung wegen fehlender wirtschaftlicher Nachfrage eingestellt. Das Luhmetz war ein starkes löffelförmiges Instrument, etwa fünf Zentimeter groß, mit scharf geschliffenem Rand und halbmeterlangem Holzstiel. Im Mai stand das Eichengebüsch „im Saft“ und die Rinde ließ sich leicht vom Stamm lösen. Man ritzte sie mit dem Luhmetz entlang des gesamten Stamms auf und löste sie mit dem untergeschobenen Löffelende des Werkzeugs ab. Luhschälle (Loheschälen) war eine schweißtreibende und kräftezehrende Knochenarbeit, bei der man et Salz en dr Zupp net verdeene konnte, zumal auch die geschälten Stücke langwierig getrocknet und zum Abtransport an bestimmter Stelle zusammen getragen werden mussten. Es waren auch nur die ganz Armen, die sich ein Luhloss (Lohlos, abgesteckter Bereich) ersteigerten, der „normale“ Bauersmann gab sich nicht dafür her. Zum Luhmetz gehörte in der Regel ein weiteres Werkzeug: Das Krömmche zum Abschlagen und Zerhacken des Geästs. Das Krömmche war ein Handbeil mit 30 Zentimeter langer flacher Klinge, die am vorderen Ende in eine scharfe gebogene Spitze auslief und sich auch zum Anritzen der Lohe eignete. Das Werkzeug wurde oft auch Hääp genannt. Ein Krömmche gab es früher auch bei uns daheim.
Lüsterdaach
Die wörtliche Übersetzung lautet „Lauschtage,“ lüstere oder auch lustere heißt soviel wie „lauschen, horchen.“ Die offizielle Bezeichnung ist „Lostage.“ Die Lüsterdaach sind im Volksglauben Kriterien für die Wetterprognose sowie für die Feldbestellung in der Landwirtschaft (Bauernregeln). Ähnlich dem Hundertjährigen Kalender, „belauschten“ die landwirtschaftlichen Experten in jahrelangen Beobachtungen die Natur und fanden einen Zusammenhang zwischen bestimmten Tagen und dem Wetter. Es gibt heute mehr als 100 Lüsterdaach, anfangs waren es nur die 12 „Rauhnächte“ vom 25. Dezember bis 06. Januar, jeweils ein Tag stand für einen Monat des kommenden Jahres. Lüsterdaach sind unter anderem Liëchtemoß (Lichtmeß), die Ieshellije (Eisheilige), Sebbeschläfer (Siebenschläfer), Jannsdaach (Johannis), Jierdrögg (Gertrudis) oder Mattesdaach (Matthias). Von Matthias heißt es beispielsweise: „Sankt Matthäus kalt, die Kälte lang halt (hält).“ Das Gegenstück der Lüsterdaach sind die „Schwendtage,“ Unglückstage, an denen man nicht verreisen, heiraten oder eine Operation vornehmen sollte. Es gibt um die 40 Schwendtage, einer von ihnen ist der 01. August, an dem Luzifer in die Hölle verbannt wurde. Ein anderer ist der 01. Dezember, an dem Sodom und Gomorrha untergingen. (Quelle: Wikipedia).
Lüüs
Überall dort, wo viele Menschen sich längere Zeit auf relativ engem Raum aufhalten müssen, tauchen mit ziemlicher Sicherheit in absehbarer Zeit Läuse auf, mangelnde Hygiene als zusätzlicher Faktor bewirkt, dass sich die verhassten Parasiten rasant vermehren und zur Plage werden. In den Kriegsjahren war Lüüs auch im Eifeldorf ein gefürchteter Begriff, selbst wir Kinder mussten uns mit Kopplüüs (Kopfläuse) herumplagen. Wirksame Mittel gegen das ständige Jucken und Kratzen gab es nicht, ein drastisches Hausmittel, schon beinahe eine Päedskur (Pferdekur), war ein leicht mit Petroleum angefeuchteter Kopfverband. Dieser „Turban“ stank fürchterlich, aber er half, wenn auch nur vorübergehend. Die Amerikaner hatten beinahe „eimerweise“ Lüüspolever (Läusepulver) im Gepäck, ihre erste Maßnahme nach der Besetzung einer Ortschaft war die Entlausung der Bevölkerung. Bei uns daheim war „Antreten“ auf dem Kapellenplatz, bei Männlein und Weiblein, Kind und Kegel wurden mit dicken Zerstäubern ganze Wolken von Lüüspolever unter die Kleidung geblasen, was den GIs naturgemäß bei der holden Weiblichkeit besondere Freude bereitete. Der Singular von Lüüs ist Luus. Ein altes Sprichwort besagt en ahl Hüser vell Müüs, en ahl Pelze vell Lüüs (in alten Häusern viele Mäuse, in alten Pelzen viele Läuse).
nach oben
zurück zur Übersicht
|