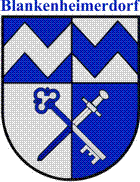|
fächte
Generell bedeutete fächte so viel wie „stehlen,“ allerdings in etwas abgemilderter Form, etwa wie „stibitzen, abstauben, mitgehen lassen.“ Nach der Silvesterpredigt 1946 des Kölner Kardinals Josef Frings kam fringsen als neuer Begriff für klauen in Umlauf. Damit war aber ausnahmslos „stehlen aus leiblicher Not“ angesprochen, fächte gehörte nicht in diese Kategorie. Ein geradezu klassisches Fächten war zu unserer Kinderzeit das Stibitzen von Johannis- oder Stachelbeeren im heimischen Garten. Woorste wiër aan de Knüetschele fächte! meckerte Jött und verteilte Uhrwatsche (Ohrfeigen). Die Beerensträucher in unserem Garten, ganz zu schweigen von Apfel-, Kirsch- und Pflaumenbaum, waren für uns Pänz „Sperrgebiet,“ wer es missachtete, musste beim Pastor ich habe genascht beichten. Fächte war auch eine Untugend des Hütebuben: Auf dem nächstbesten Kartoffelfeld grub man eine Handvoll Knollen zum Garen im Weidefeuer aus. Fächte, das war kein geplanter und gezielter Diebstahl oder gar Raub, der Fächter nutzte vielmehr eine günstige Gelegenheit, fremdes Eigentum „mitgehen“ zu lassen. Meistens war auch das „Diebesgut“ nur von geringem Wert. Auch unsere Weidetiere verstanden zu fächten, nicht selten nämlich verdrückten sie sich klamm heimlich aufs Nachbargrundstück und bedienten sich an verbotenem Futter. Das konnte für den Hütejungen fies ins Auge gehen, wenn der Feldhüter hinter die Geschichte kam.
Faddem
Wenn einer beim Erzählen plötzlich nicht mehr weiter weiß oder die richtige Textstelle im Buch nicht sofort findet, so hat er dr Faddem verlore (den Faden verloren). Unsere Jött (Tante) sah nicht mehr gut, das Einfädeln an der alten Nähmaschine war schwierig, also gebot sie mir: Hie dohn mir ens dä Faddem en (wörtlich: tu mir mal den Faden ein). Der Heudresser (Regenguß bei der Heuernte) hatte die Mannschaft bis auf die Haut durchnässt und Fränz fluchte: Dr Düwel soll et holle, mr hät keine drüjje Faddem mieh am Liev on et janz Heu os am Aasch (Der Teufel soll´s holen, man hat keinen trockenen Fadem mehr am Leib und das Heu ist total verdorben). Der Ruëde Faddem ist der sprichwörtliche „Rote Faden,“ und de Fäddem zeeje (die Fäden ziehen) bezeichnen wir das Entfernen der Wundnaht durch den Doktor. Auch bei den grünen Bohnen müssen de Fäddem jezoëje (die Fäden gezogen) werden: Beim „Köpfen“ der Fitschelbohnenschoten werden die langen Seitenfasern mit abgezogen, ansonsten gibt´s beim Verzehr Probleme mit den harten und zähen Schuëtefäddem (Schotenfäden). Das Entfasern und Einfädeln nennt man bei uns fäddeme.
Fahrscholl (weiches o)
Eine Fahrschule war zur Zeit unserer Eltern an unserer Oberahr eine Seltenheit: Im Eifeldorf besaß der Dokter ein Auto, eventuell auch der Liehrer, manchmal der Pastur und hier und da auch der Besitzer des Dorfladens. Davon konnte keine Fahrschule „leben.“ Nach dem Krieg war in unseren Breitengraden Paul Pfeiffer der einzige Fahrliehrer, seine Fahrscholl befand sich in der Alten Trierer Straße in Blankenheim. Wer in den 1950er Jahren bei uns einen Führerschein besaß, hatte dieses wertvolle Papier garantiert bei Pfeiffer-Paul erworben. Als ich in 1957 bei Ludwig Greuel in der Ahrstraße meinen Motorroller „Bella“ kaufte, absolvierte ich bei Pfeiffer-Paul den Führerschein Klasse eins, der damals um die 80 DM kostete. Paul riet mir, gleichzeitig die Klasse drei zu erwerben, aus Kostengründen. Er nämlich war überzeugt, dass ich über kurz oder lang auch „den Drei“ brauchen würde. Ein Auto, ich, niemals! Drei Jahre später machte ich bei Paul den Drei und er grinste sich eins. Paul war ein „echter Kerl,“ unvergessen bleibt ein Stöckelche (Anekdötchen), das er uns Schülern gelegentlich erzählte. In Höfen (damals Kreis Monschau) fragte er einen Jungen nach dem Weg und erhielt die bemerkenswerte Antwort: Wenn Sie willen, können Sie hier rechts erüm fahren. Wenn Sie aber nicht willen, können Sie auch da schnack aus fahren.
Famillijepott
Der Famillijepott war ein „Familientopf“ und als solcher ein Behältnis, das der gesamten Hausbewohnerschaft Tag und Nacht zur beliebigen Verfügung stand. Ein Schuft aber, wem dabei etwa ein ganz bestimmter Emailletopf vor Augen schwebt! Der Eifeler Famillijepott nämlich war der mächtige Kaffeetopf, dessen Inhalt für zehn und mehr Tassen reichte. Im Alltag kam in der Regel eine weiß oder grau emaillierte Blechkanne mit der geschwungenen Zupp (Ausguss) zum Einsatz. Nicht selten war hier und da die Emaille abgeplatzt und das blanke Metall kam zum Vorschein. Der Güte des Gerätes taten solche schwarzen Blötsche nicht den geringsten Abbruch, sie gehörten einfach dazu. An Festtagen, oder wenn die mehr oder weniger „liebe“ Verwandtschaft zu Besuch war, wurde das joot Jeschier (gutes Geschirr) aus dem Wandschaaf geholt, und zu den Goldrandtassen gehörte auch der fein verzierte joode Famillijepott, mit prächtig verschnörkeltem Deckel und einem Jümmiche (Gummichen = kleines Schwämmchen) als Tropfenfänger an der Zupp, damit nur ja kein brauner Kaffeefleck auf das kostbare weiße Deschdooch (Tischdecke) geriet.
fass
Auf die Schreibweise kommt es an: „Fass“ großgeschrieben ist gleich dem hochdeutschen Fass, das kleingeschriebene „fass“ dagegen bedeutet „fest“ in allen seinen Variationen. Halt ens dat Fass fass (halte mal das Fass fest) mag als Beispiel gelten, oder auch stell dat Fass fass aan de Wand (stell das Fass fest an die Wand). Ursprünglich schrieb man Faß und faß, das änderte sich mit der neuen deutschen Rechtschreibung ab 2005. Wer fest und tief schläft, der ist fass am schloofe; ein festsitzender trockener Husten ist ene faste Hooß; für die erwachsene Haustochter wurde es Zeit, dass sie en fass Hänn kött (in feste Hände kommt); und wenn „im Märzen der Bauer die Rösslein einspannen“ wollte, musste er verärgert feststellen: Dr Boddem oß noch ze fass, ech kann noch net plööje (der Boden war noch gefroren, pflügen konnte man noch nicht). Der rüstige Achtzigjährige war noch fass op de Bejn (fest auf den Beinen), und als mir an der Theke einmal unverhofft das Bierglas aus der Hand fiel und in Scherben ging, meinte Krämesch Pitter (der Wirt) tröstend: Oß net schlomm, dat tritt sech fass (Ist nicht schlimm, das tritt sich fest).
Fauch
Eine Windfege zum Reinigen der mit dem Flegel ausgedroschenen Getreidekörner. Die Fauch war ein Vorläufer der Wannmöll, wir besaßen daheim eine solche Maschine. Sie war vollständig aus Holz gefertigt, selbst die Zahnräder, die Drehachsen und die Kurbel. Das handbediente Flügelrad erzeugte im etwa zwei Meter langen, an der Unterseite teilweise offenen Windkanal einen kräftigen Luftstrom, durch den das Dreschgut aus dem aufgesetzten hölzernen Fülltrichter rieselte. Die schweren und damit guten Körner fielen fast senkrecht durch den Luftstrom und wurden im untergestellten Wann (flacher Korb) aufgefangen, das leichtere „Hinterkorn“ – nur als Tierfutter verwendbar – wurde weiter weggeblasen und fiel „hinter“ dem Wann zu Boden, daher die treffende Bezeichnung. Spreu und Staub wurden meterweit davongewirbelt. Das Arbeiten mit der Fauch wurde fauchen genannt. Ich habe oft daheim den Schwengel unserer Fauch drehen müssen, - für Kinderhände eine anstrengende Arbeit: Die Umdrehungszahl des Windrads musste konstant gehalten werden, weil sonst der Luftstrom zu groß oder zu gering wurde und die Reinigung nicht mehr stimmte.
Feckmöll (weiches e und ö)
Das Wort scheint auf den ersten Blick der Gossensprache entnommen zu sein, und bei tief greifender Betrachtung und einem guten Quantum an Vorstellungskraft lässt sich diese Version sogar nachvollziehen. Tatsächlich aber ist es unser Mundartwort für die, beim „Mühlespiel“ angestrebte „Zwickmühle.“ Das ist bekanntlich die bestmögliche Position der Spielsteine, eine so genannte „Doppelmühle,“ in der beim Hin- und Herschieben eines einzigen Steins jedes Mal eine Mühle geschlossen und damit ein gegnerischer Stein geschlagen wird. Diesen Vorgang nannte man Fecke und die Doppelmühle war eben eine Feckmöll. Normalerweise hieß es Fickmöll oder Fickmüll, bei uns daheim durfte unterdessen niemand dieses Wort aussprechen, - für uns Pänz eine unbegreifliche Anordnung, deren Hintergrund uns erst viel später klar wurde. Bekannt ist noch heute die Redewendung Möllen op han (wörtlich: Mühlen auf haben = sich in einer günstigen Lage befinden). Das beruht auf dem Vorteil der Feckmöll: Bei jedem Zug wird eine Mühle geschlossen und gleichzeitig die Zweite geöffnet, sodass der Gegner immer im Nachteil ist. Ein ebenso bekanntes Wort ist En dr Feckmöll setze (In der Klemme sitzen).
Fedder
Wenn unser altes mechanisches Jrammefon (Grammophon) wieder einmal streikte, stellte Vater fest: De Fedder os kapott (die Feder ist hinüber). Eine neue Feder – ein aufgerolltes drei Meter langes Stahlband – in die Trommel einlegen, das war eine heikle Angelegenheit. Wehe, wenn das Band „heraus flitschte,“ das hatte jeschend Fongere (geschundene Finger zur Folge). Nut on Fedder war ein Begriff aus dem Schreinerberuf: Die fünf Meter langen Fußbodenbretter besaßen „Nut und Feder“ zum perfekten Aneinanderfügen. Die hölzerne Jreffelbüx (Griffelbüchse, Schreibzeugbehälter) unserer Volksschulzeit enthielt unter anderem die Blejfedder (Bleifeder = Bleistift) und den rot lackierten Federhalter mit aufgesteckter Sütterlin-Fedder. Das war damals die gebräuchliche Form der Schreibfeder aus Stahl, deren Spitze in zwei winzige „Füßchen“ auslief. Wenn auch nur eins der Füßchen verbogen war, war die Fedder unbrauchbar und nicht mehr zu reparieren, jeder Versuch, die Füßchen zurecht zu biegen, beschädigte sie nur noch mehr. Natürlich waren auch die Vogelfedern Feddere (Mehrzahl von Fedder). Wenn der Habicht sich vor unserem Haus eins unserer Hühner griff, gab es ein Gerangel, dass im Sinne des Wortes de Feddere floche (die Federn flogen). Und vom Langschläfer sagt man: Dä os net üß de Feddere ze kreje (nicht aus den Federn zu kriegen). Fedder hieß bei uns auch seltsamerweise das Bauchfett des Schlachtschweins, aus dem durch Sieden das wertvolle weiße Schmalz gewonnen wurde. Das hochdeutsche Wort für diese Fedder ist „Schweineflomen.“
Feldhöder
Feldhüter, ein alter Eifeler Beruf. Den Feldhüter, auch Feldschötz (Feldschütz) genannt, gab es noch bis in die 1960er Jahre. Er war eine Art privater „Polizist“, der im Auftrag der Gemeinde auf Ordnung in den Feld- und Wiesengemarkungen zu achten hatte. Er besaß keinerlei polizeiliche Befugnis und durfte schon gar keine Waffe führen. Er konnte dem „Feldsünder“ aber enorme Schwierigkeiten bereiten. Den Hütebuben gegenüber wurde er auch schon mal handgreiflich, wenn er sie beispielsweise beim Ströppen (Beweiden gesperrter Flächen) erwischte. Die letzten Feldhöder von Blankenheimerdorf waren Peter Schröder, im Dorf Schröder-Pitter genannt, und Johann Reetz, ortsüblich Hahnebrochs Schäng. Noch in den 1950er Jahren verpachtete die Gemeinde die Grasnutzung auf ihren Jewanne (Gewannwege zwischen den Flurparzellen) für ein paar Groschen an private Interessenten. Mein Vater pachtete alljährlich zwei oder drei Wege im Bereich der Botzebröck (neuerdings „Schossenbrücke“), die bis zum Heumond (Heumonat, Juli) nicht befahren wurden und gutes Gras trugen. Ein Bauersmann wurde vom Feldhöder beim Abtransport eines ausrangierten Weidezauns über unsere Jewann beobachtet. Schröder Pitter war der Ansicht, diese Arbeit habe bis nach der Heuernte warten können. Er erschien abends mit dem „Feldsünder“ bei uns und setzte durch, dass der Bauer uns mit seinem Gespann das Heu von besagtem Weg heim zu fahren versprach, - als Ersatz für das unnötigerweise „versaute“ Gras.
Feldmösch (weiches ö)
Die Feldmösch war und ist der Feldsperling, dessen mundartliche „Geschlechtsumwandlung“ auf die holländische Sprache zurückzuführen ist: Der Sperling oder Spatz heißt bei den Holländern „mus,“ das wird „müsch“ gesprochen und ist ein „vrouwelijk“ (weibliches) Hauptwort, unsere davon hergeleitete Mösch wurde also zwangsläufig auch weiblich. Die Schwester der Feldmösch ist unsere Huusmösch (Haussperling), die sogar in 2002 zum „Vogel des Jahres“ gekürt wurde. Mösche waren früher verhasste und verfolgte Massenvögel, weil sie sich weitgehend von Körnern und Samen ernähren. Während der Brutaufzucht – und davon haben die Feldmösche oft drei im Jahr – verfüttern sie aber auch jede Menge Insekten. Im Jahr 1684 war die Spatzenplage derart enorm, dass in der Grafschaft Blankenheim ab da jeder Untertan alljährlich zwischen September und Ostern „zwölf Spatzenköpf auf unser Residenz Schloß liefern“ musste, um der Plage Einhalt zu bieten. Säumigkeit wurde mit Geldstrafe belegt, mehr als 12 Möscheköpp wurden mit klingender Münze vom Landesherrn belohnt. Intensive Landnutzung und moderne Bebauung nehmen dem Sperling heute mehr und mehr Lebensraum fort, auf der Roten Liste steht er unterdessen noch nicht. Feldmösche war regional auch das gebräuchliche Wort für die beim Jrompere üßdohn (Kartoffelernte) auf dem Feld im Feuer gegarten Kartoffeln.
Feldwebel
Dass dieses Wort einen militärischen Dienstgrad beschreibt, war schon immer klar, was aber da als Webel durchs Feld geisterte, daran rätselte ich seit meiner Kindheit herum. Erst das allwissende Google hat es mir jetzt verraten: Webel ist von Weibel hergeleitet, und das ist ein „Amtsdiener.“ Der Wortteil Feld bezieht sich in diesem Zusammenhang auf den „Kriegsschauplatz.“ Ich weiß noch, dass bei uns die Soldaten stramm standen und „Männchen bauten,“ wenn sie mit einem bestimmten Vorgesetzten sprachen, zu Befehl Herr Oberfeld hieß es dann abschließend und ich rätselte: Was war ein Oberfeld? Im Dörfer Platt ist Feldwebel das Wort für eine stramme Frauensperson, ein energisches und herrschsüchtiges Weib, eine tatkräftige und befehlsgewohnte Ehefrau. Menge Feldwebel hät mir dr Ausjang jespeert (Mein Feldwebel hat mir den Ausgang gesperrt) begründete Theo sein Fernbleiben vom letzten Skatabend. Eine Fernmeldekompanie der Bundeswehr hielt vor Jahren bei uns ihren Manöverball ab. Der verlief nicht ganz zur Zufriedenheit des Haupt- (oder Stabs-?) Feldwebels. Die beiden Verantwortlichen wurden bei seinem Gebrüll „klein und hässlich“ und wären liebend gern in die Erde gekrochen. Wir kennen unterdessen auch einen höchst willkommenen und liebenswerten Feldwebel. Da stellt beispielsweise der Thekenkunde fest, dass der Wirt ene saubere Feldwebel fabriziert habe, und das ist ein dickes Lob für die korrekte und optisch perfekte Schaumkrone auf dem frischen Bier. Dieser „Schaumkragen“ ist auf den ansehnlichen Uniformkragen des früheren Feldwebels zurückzuführen.
feng (weiches e)
Das Wort bedeutet „fein“ und wird mit weichem e und gedehntem ng (Beispiel: Ring) ausgesprochen (nicht fäng). Die Holländer sagen „fijn.“ Heute noch ist der Begriff e feng Restaurang für ein hervorragendes Speiselokal üblich. Der Sommerfrischler“ im Eifeldorf war früher ene fengen Heer (ein feiner Herr). Eine angenehme Situation bezeichneten unsere Eltern als en feng Saach (feine Sache), die abschließende Feinarbeit an einem Produkt war de Fengärbed, und im Gegensatz zum „normalen“ Roggenmehl bezeichnete man das Weizenmehl als Fengmäel. Beim Festmahl zur Kirmes war der Besuch des Lobes voll: Jung Drinche, do häßte äwwer en feng Pääps fabriziert (Die Pääps war ein besonders delikates Schulterstück vom Schwein und wurde gern als Festbraten verwendet), und wenn dann auch noch e feng Wengche (ein guter Wein) serviert wurde, war man noch lange von diesem fenge Mettecheiße (hervorragenden Mittagessen) angetan. In der Nacht hatte es unverhofft feng jeschnejt und der Winter war da. Der clevere Geschäftsmann besaß e feng Nääsje (eine feine Nase) für lohnende Objekte und der Feinschmecker e feng Zöngelche (feines Zünglein) für Delikatessen. Dat os ene Fenge (Das ist ein Feiner) hieß es von Leuten, die sich vom „gewöhnlichen Volk“ absonderten und nicht besonders gut angesehen waren. Eine gut gekleidete Person war feng aanjedoohn (fein angezogen), den häuslichen Festtagsputz umschrieb man mit et Huus feng maache, und was dem Haus zustand, war zum Fest auch ein Privileg der Hausfrau: Sech feng maache (Sich fein machen).
Fenning
Noch zu meiner Kinderzeit hieß bei uns die kleinste Münzeinheit Fenning (Pfennig), inzwischen ist längst der allgemein übliche Penning daraus geworden. Um den Fenning rankten sich früher – und ranken sich auch heute um den Penning – zahllose Redewendungen und Volksweisheiten. Eine der ältesten und weisesten Weisheiten ist wohl Wä dr Fenning net ehrt, os des Dahlers net wert, die aber in unserem Wohlstandzeitalter jede Bedeutung verloren hat. Nach einem Pfennig bückt sich kein Mensch mehr, eine Münze ist nur noch des Aufhebens wert, wenn sie mindestens von gelber Farbe ist. Am Abstellplatz der Einkaufswagen beim Supermarkt lag ein rotes Zweicentstück. Vier Kunden sahen es – und ließen es liegen. Dann habe ich es aufgehoben und eingesteckt nach dem Motto ene Fenning os och Jeld (ein Pfennig ist auch Geld). War das Diebstahl? Hätte ich die zwei Cent abliefern müssen? Als Talisman ist der Pfennig unterdessen auch heute noch beliebt, einen roten Jlöcksfenning schleppen die meisten modernen Zeitgenossen mit sich herum. Von einem Geizhals sagen wir etwas gehässig dä os op den Fenninge wie dr Düvel op den ärm Siël (…arme Seele). Wenn wir die absolute Wertlosigkeit einer Sache definieren, sagen wir oft do jenn ech kejne ruëde Fenning für (dafür gebe ich keinen roten Pfennig), und manche geplagte Hausfrau kritisiert das Haushaltsgeld: Mot denne paar Fenning krejen ech nix Jeschejtes op dr Desch. Mein früherer Vermieter rechnete den Mietbetrag stets genauestens bis auf den Pfennig ab, er war in meinen Augen ein kleinlicher Fenningsvötzer (Pfennigsfurzer).
Ferlichnumsdaach
Früher das gebräuchliche Wort für das Fronleichnamsfest. Inzwischen ist der Ausdruck beinahe vollständig ausgestorben, nur ein paar Senioren bedienen sich seiner noch. Allenfalls sagt man hier und da noch „Fronlichnam“. Ferlichnumsdaach war einer der höchsten kirchlichen Feiertage im Dorf, die Prozession war jedesmal ein Ereignis. Man wetteiferte beim Aufbau der vier Stationsaltäre, „Gutachter“ taxierten die Arbeiten ab und diskutierten später an der Theke über ihre Beobachtungen. Der Prozessionsweg war beiderseits der Straße mit Maien geschmückt. Diese frisch belaubten Buchenäste wurden einfach im Wald geschlagen, das war Tradition. Hier und da mag der Forstbeamte ein wenig „gemurrt“ haben, an ernsthafte Schwierigkeiten kann ich mich unterdessen nicht erinnern. Am Kippelbergkreuz vor unserem Haus war die erste Altarstation, 40 Jahre lang haben wir in der „Altarmannschaft“ mitgemacht, das war Ehrensache. Am Vorabend von Ferlichnumsdaach fuhren wir junge Burschen mit unserem Nachbarn Scholtesse Lej (Leo Hess) und dessen Traktorgespann in den Gemeindewald und besorgten die Maien für den halben Keppelberch (Kippelberg = Ortsteil). Aus Naturschutzgründen wurden die Maien später durch Fähnchenschmuck ersetzt. Aus dem einstigen „Hochfest“ ist, möglicherweise wegen „Personalmangels“ in der katholischen Kirche, inzwischen beinahe „ein Tag wie jeder andere“ geworden,
fiele
Die Fiel ist ein Werkzeug, nämlich die Feile, fiele ist die Anwendung des Werkzeugs und bedeutet feilen. Feilen gibt es bekanntlich in jeder beliebigen Form, Größe und Funktion, von der groben Holzraspel bis zum Miniatur-Schüsselfeilchen. Die Handhabung einer Fiel scheint einfach und problemlos, und doch ist es eine Fertigkeit, die sich der Mechanikerlehrling als eine seiner ersten Aufgaben anzueignen hat: Das Arbeiten mit der Flachfeile. Do moßte jo mot dr Fiel draan (Da musst du ja mit der Feile dran) ist die Beurteilung des Werk- zeugschärfers beispielsweise eines übermäßig stumpfen Messers. An einem Gegenstand erömfiele bedeutet „rundum feilen, bearbeiten.“ Ich besitze noch zwei von Vaters Holzraspeln, ihr „Hieb“ ist ungewöhnlich rauh und scharf, bei unachtsamer Handhabung gibt es leicht Verletzungen. Wenn in meiner Kinderzeit Ohm Mattes seine Rahmsäech (Rahmensäge, Bügelsäge) „schärfte,“ entstand ein unheimlich schrilles, kreischendes Geräusch, das en de Uhre wieh (in den Ohren weh) tat: Die tausendmal gebrauchte Feile war selber stumpf und „schliff“ nicht mehr. In Blankenheimerdorf fordern die „Eiersammler“ in der Mainacht mit ihrem Sprüchlein den Hausbesitzer zum beschleunigten Öffnen der Haustür auf: Doot Ihr öch net zaue, doohn mir de Düer ophaue, doot Ihr öch net beiele, doohn mir de Düer opfiele, im ersten Fall würde also, wenn sich der Hausbesitzer nicht zaut (sputet), die Tür „aufgehauen“ (geschlagen), wenn sich der Mann nicht beielt (beeilt), würde die Tür „aufgefeilt.“
Fieroovend
Für jeden Berufstätigen ist bekanntlich der Feierabend der schönste und beliebteste Tagesabschnitt. Fieroovend zu meiner Kinderzeit daheim: Haus und Hof waren für die Nacht gerüstet, die Stalltiere waren gemolken und versorgt, bis zum Abendessen war noch ein halbes Stündchen Zeit, - Gelegenheit für einen Plausch mit dem Nachbarn, man ging noch jät noobere (in die Nachbarschaft). Auf dem Holzplatz neben dem Haus baute man sich in dem schrägen Berg Ofenholz aus den Hackstücken einen provisorischen Sitz und beredete die neuesten Tagesereignisse. Fieroovend heute: Rushhour, rote Ampeln, verstopfte Straßen, Raserei und Stau auf der Autobahn, Hetze, Stress, erschöpfte Ankunft, Abendessen hinunter schlingen, Glotzstunde, Horror, Terror, Mord, Sex, – noch im Schlaf verfolgen uns die Bilder, und um sechs Uhr klingelt der Wecker. Fieroovend! Wenn Punkt 17 Uhr die Werkssirene ertönte, legten die Arbeiter im Sägewerk Milz in Blankenheim-Wald ihre Werkzeuge aus der Hand. Die Sirene war kilometerweit zu hören, dr Melz hät Fieroovend konstatierten die Leute bei der Feldarbeit, et os fönnef Uhr. Die Wenigsten besaßen damals ein Uhr, man war auf „Fremdsignale“ angewiesen. Pünktliche Arbeitsruhe zur festgesetzten Zeit gab es im bäuerlichen Betrieb eigentlich nicht. Wenn beispielsweise noch eine Fuhre Heu einzuholen war, so wurde das getan, auch wenn die Mitarbeiter brummten Höck jitt et ens wier ene späde Fieroovend (Heute gibt´s mal wieder einen späten Feierabend). Und wenn wir Pänz uns mal wieder untereinander in die Haare gerieten, schrie Ohm Mattes über den Gartenzaun herüber: Ech komme jetz erüwwer, dann os Fieroovend mot der Zänkerej (Ich komme jetzt rüber, dann ist Feierabend mit der Zankerei).
fies
Alles was schlecht, bösartig, widerwärtig ist, findet im Eifeler Dialekt seinen Niederschlag im Eigenschaftswort fies. Mit dem Wörtchen fies umschreiben wir alles Negative auf der Welt, fies mit positiver Deutung gibt es nicht. Die Herkunft des Adjektivs ist unklar, das schlaue Google meint: Es könnte eine lautmalende Bildung zu „fi“ (pfui) sein oder auch eine Ableitung zu „vist“ (Blähung) darstellen. Es gibt unendlich viele Anwendungsformen oder Redewendungen, ein paar davon seien erwähnt. Fies Wedder beispielsweise bedeutet Dauerregen; der Fiese Möpp ist ein unangenehmer Zeitgenosse; Do häßte dech äwwer fies jeschnedde (Da hast du dich aber böse geschnitten) heißt „Du hast dich geirrt.“ Wenn wir uns vor etwas ekeln, sagen wir Do sen ech fies vüer: von einem missgünstigen oder gemeinen Zeitgenossen heißt es Dä hät ene fiese Charakter und eine unansehnliche Farbe ist en fies Färv. Aus meiner Volksschulzeit ist mir noch die Aufzählung von Gegensätzen in Erinnerung: „Hoch / tief, dick / dünn, süß / sauer, schön / fies…“ die Mitschüler grinsten und der Lehrer schmunzelte. Unsere Nachbarn in Holland kennen das Wörtchen auch: Vies bedeutet dort „widerlich, ekelhaft, unflätig.“ Wenn sich der Niederländer vor etwas ekelt, sagt er „ik ben er vies van.“ Das Adjektiv fies hat längst Eingang in unseren offiziellen Sprachschatz gefunden. Heute Morgen (am 08.Januar 2019) hat es auf der Bundesstraße 51 zwischen Blankenheimerdorf und Schmidtheim janz fies jekraach (ganz schlimm gekracht), dort nämlich stand ein LKW quer über die Fahrbahn, als ich vom Zahnarzt kam.
Fiete
Eifeler Wort für den aus der Studentensprache stammenden Ausdruck „Fidibus,“ richtiger für dessen Mehrzahl Fidibusse, - Pfeifenanzünder aus dünnen Holzstäbchen oder gefaltetem Papier. Der Fidibus ist in Eifeler Mundart weiblichen Geschlechts: die Fiet. Die Fiete (Plural) wurden bei uns daheim aus astfreiem Fichtenholz gespalten, auf der Herdplatte getrocknet und im Löffelblech oder in einem besonderen Fietenhalter aus Draht an der Wand neben dem Ofen aufbewahrt. Die Stäbchen waren etwa 20 Zentimeter lang, ihre Herstellung war nicht selten mit schmerzhaften Schnittwunden am Finger verbunden. Fieten standen uns in jeder beliebigen Menge und kostenlos zur Verfügung, Ohm Mattes ging trotzdem sparsam damit um und verbrauchte sie bis zum letzten Stümpfchen. Fiete wurden üblicherweise auch zum Anzünden von Herd- und Ofenfeuer gebraucht, dem heutigen Kaminanzünder vergleichbar. Speziell für diesen Zweck gab es jedoch nach dem Krieg einen ziemlich gefährlichen Ersatz: Poleverstange (Pulverstangen), das Röhren-Schießpulver aus den Patronen der 37 Millimeter-Kanonen der Wehrmacht, gelegentlich auch die dickeren Röhrenstangen aus der 88 Millimeter-Flakmunition. Die Poleverstange brannten relativ träge ab, als Feueranzünder waren sie unterdessen recht brauchbar. Die Gefahr lag in ihrer Beschaffung, denn dafür musste die Granate von der Patronenhülse „abgebrochen“ werden. Im zerbombten Munitionsdepot der Wehrmacht am Kaiserhaus bei Schmidtheim lag dieses Teufelszeug – und noch vieles mehr – in Haufen herum, wir brauchten uns nur zu bedienen. Wir schleppten Rucksäcke voller Poleverstange in stundenlangem Marsch quer durchs Eichholz heim nach Nonnenbach. Wir hatten alle einen mächtigen Schutzengel, nie ist etwas Schlimmes passiert.
Fiësch
Unser Wort für den Dachfirst, wobei wieder einmal die mundartliche „Geschlechtsumwandlung“ in Erscheinung tritt: Die Fiësch. Der Kölner sagt übrigens die Feesch. Im Dachfirst liegt der Fiëschtebaleke (Firstbalken, Firstpfette), der mit den Mittel- und Fußpfetten die Sparren trägt. Zur Firstabdeckung dienen halbrunde oder winkelförmige Fiëschtepanne (Firstziegel), die bei den früher noch verwendeten Schottelspanne (halbrunde Dachziegel ohne Falz) in Zementspies (Mörtel) eingelegt wurden. Im Zusammenhang mit dem Firstbalken gibt es ein Anekdötchen über das „Gewicht der Wasserwaage“ (siehe: Tuppes), bei dem auch die Kaastenholz-Männ beteiligt waren: Die Zimmerleute Heinrich und Paul Kastenholz. Das körperlich recht kräftige Brüderpaar hat in den 1950er Jahren auch den Dachstuhl an unserem Haus erneuert. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie, mit einer sechs Meter langen vieronzwanziger Fiëschtepfett auf der Schulter, freihändig über das Dachgebälk turnten. Auch der Baumwipfel wurde bei uns gelegentlich als Fiësch bezeichnet. Beim Apfelpflücken beispielsweise musste ich wie ein Eichhörnchen im Geäst herum turnen und erhielt unter anderem den Befehl: Du moß bos en de Fiësch klomme, do hange de Beste (Du musst bis in den Wipfel klettern, dort hängen die Besten).
Flabbes
Wer auf irgendeine Weise absonderlich wirkt, wer Ungewöhnliches tut oder sagt, wer also irgendwie den Rahmen des Alltäglichen und Üblichen sprengt, der ist in unserer Eifel ein Flabbes, und den gibt es sowohl im positiven als auch im weiger angenehmen Sinn. Selbst Kinder können schon davon „angesteckt“ sein, ich erinnere mich noch gut: Wenn ich mal wieder dauerhaft „quengelich“ war, wurde ich von Mam zurecht gestutzt: Stell dech net emmer esu flappich aan. Ein Luftikus, der gern Witze erzählt und die Leute zum Lachen bringt, ist ein Flabbes der positiven Art. Wir Halbwüchsige, die wir abends den Dorfbewohnern Streiche spielten, waren von der gegenteiligen Sorte: Die jruëß Flabbesse han nix wie Flabbesserejen em Kopp, und damit brachten die ehrenwerten Bürger ihre Entrüstung zum Ausdruck: Die großen Nichtsnutze haben nichts wie Schandtaten im Kopf. Auch ein Mensch von ungewöhnlichem Körperwuchs konnte zum Flabbes werden: Nu betraach dir doch blos ens dä lange Flabbes (…schau doch mal den langen Lulatsch), und von einer lebenslustigen, eventuell putzsüchtigen Frau wurde hinter der Hand getuschelt: Dat stellt sech ens emmer jät flabbessich aan. Generell war der Flabbes ein Zeitgenosse, den die Leute für nicht so ganz „voll“ nahmen und mit dem man „leben“ konnte.
Fladem
Kürzlich in einem hiesigen Restaurant: Als Vorspeise zu unserer, übrigens vorzüglichen Mahlzeit, gab es Fladenbrot, – für die Eifeler Zunge etwas ungewöhnlich, aber lecker. Der Fladen ist bekanntlich ein dünner, flacher Kuchen, ein Pfannkuchen beispielsweise, den wir allerdings als Pannekooche bezeichnen. Fladenbrot ist eine der ältesten Speisen überhaupt, bei uns gewinnt es zunehmend an Beliebtheit. Während der Kölner Flade sagt, wird eifelspezifisch das hochdeutsche Schluss-n in m umgewandelt, was gar nicht so selten ist, Beispiele: Faden / Faddem, Schatten / Schädem, Besen / Beissem. Eine ganz spezielle Eifeler Leckerei ist die Taat (Torte, Kuchen), die heute noch beim traditionsbewussten Konditor erhältlich und als Spezialität beliebt ist, freilich in etwas „aktueller“ Form im Vergleich zu früher. Damals wurden zur Kirmes oder zum Patronatsfest im Eifelhaus Taate geradezu in Massen gebacken, 20 Stück waren beispielsweise keine Seltenheit. Die Taat war ein etwa 30 Zentimeter großer, kreisrunder und nur zentimeterdicker Flademkooche, meistens mit Obst belegt, – Äpfel, Pflaumen, Beeren. Ganz besonders beliebt war die Jreeßtaat oder Jreeßfladem (Grießfladen), dessen Güte nach der Dicke des süßen Grießbelags beurteilt wurde. Flädem (Plural von Fladem) gehörten zum Fest im Eifelhaus – Kirmes, Hochzeit, Taufe – dazu wie das bekannte Amen zur Kirche, es war erstaunlich, welche Menge an Fladem bei derartigen Anlässen verzehrt wurden. Und auch Tage nach dem Fest leckten wir Kinder uns die Finger, wenn Mam (Mutter) verkündete: Et os noch jät Fladem övverich (übrig). Wir kennen auch einen Fladem aus dem Tierbereich, der aber hier nicht näher erörtert werden soll.
flämme
Das Mundartwort für „abbrennen, absengen, flämmen.“ Beim Flämmen wird in erster Linie leicht brennbares Material beseitigt. Wenn daheim eins unserer Hühner für den Kochtopf jeköpp (geköpft) und jeropp (gerupft) war, wurde es kurz über der Herdflamme jeflämmp (geflämmt) und dadurch die restlichen Flaumfederchen abgesengt. Das roch in der Regel ziemlich unangenehm. Auch das Schlachtschwein wurde vor dem Zerlegen jeflämmp, allerdings im starken Strohfeuer. Die dabei in den Ohr- oder Beinwinkeln stehen gebliebenen Borsten wurden mit einem Strühwösch (Strohwisch, hier: Strohfackel) besonders nachbearbeitet. Eine oft recht gefährliche und schädliche Unsitte war bis vor wenigen Jahren noch das verbotene „Abflämmen“ trockener Grasflächen und Böschungen im Frühjahr. Kaum war der letzte Schnee verschwunden, rauchte es an tausend Ecken und Enden und nicht selten bekamen die Feuerwehren Arbeit, wenn das Flämmfeuerchen außer Kontrolle geriet. Bei uns in Deutschland ist das Abbrennen von Grasflächen und Böschungen generell verboten, aus Natur- und auch Brandschutzgründen.
Flejeschrank
Holl mir ens de Schonk üß dem Flejeschrank. Mit diesen Worten hieß mich Mam (Mutter) den Räucherschinken aus dem Fliegenschrank holen, der bei uns op dem Jang (Flur im Obergeschoß) stand. Im Eifeler Dialekt war und ist der Schinken weiblichen Geschlechts: Die Schonk. Den Fliegenschrank als Einrichtung zum luftigen und gleichzeitig „fliegensicheren“ Aufbewahren von Lebensmitteln gab es zu meiner Kinderzeit in jedem Haushalt, im Keller aufgestellt, ersetzte er sogar den damals bei uns noch wenig bekannten Kühlschrank. Beim Flejeschrank bestanden die Seiten und die Tür aus Flejendroht (Fliegendraht), einem engmaschigen dünnen, meist grün lackierten Drahtgitter, das den Insekten den Zugang versperrte, die Lüftung aber nicht beeinträchtigte. Beim Öffnen der Tür musste man höllisch aufpassen: Die Fliegen lauerten geradezu auf eine Möglichkeit zum Durchschlüpfen. In Vaters Schreinerwerkstatt wurden noch Fliegenschränke aller Größen angefertigt, das umständliche Befestigen der sperrigen Drahtbahnen an den Rahmen der Innenwände mittels breiter Deckleisten wurde in der Regel stillschweigend mir übertragen.
Flejsch
Bei Karl May verzehrte der echte Westmann spielend drei Kilo Fleisch bei der Mahlzeit am Präriefeuer. Westmänner sind heute rar geworden, Fleisch aber ist nach wie vor eine unserer Hauptspeisen, der Zubereitung sind keinerlei Grenzen gesetzt. In weiten Teilen der Eifel ist der Mundartausdruck Fleesch gebräuchlich in Anlehnung an das holländische vlees (gesprochen: Vleesch), bei uns sagt man üblicherweise Flejsch. Die Folge einer Krankheit ist dem Patienten sehr oft anzusehen: Dä os äwwer vam Flejsch jefalle, wer sich selber infolge eines Irrtums Schaden zufügt, der hät sech ente jene Flejsch jeschnedde, der Familiensprößling ist meng eje Flejsch on Bloot. Viele Menschen (auch ich selber) haben eine Abneigung gegen das so begehrte Mettbrötchen, mag es noch so gewürzt und gezwiebelt sein: Wie kann e Mensch rüüh Flejsch eiße. Wenn daheim nach der Hausschlachtung et Flejsch üßjebloot (ausgeblutet) war und der Flejschbeschauer die Unbedenklichkeit mit seinem violetten Stempel auf der Schweinehälfte bescheinigt hatte, kamen die Fleischstücke mit einer Menge Salz in die Flejschbütt zur Haltbarmachung. Ene Rängel Flejschwuësch on en Flasch Bier (ein großes Stück Fleischwurst und eine Flasche Bier) war zu allen Zeiten und ist auch heute ein gängiger Mahlzeitersatz auf der Baustelle. Flejschbrööht (Fleischbrühe) wird unter anderem zur Herstellung von Panhas gebraucht, Flejschhauer war früher die Bezeichnung für den Metzger, – in Brüssel gibt es noch heute die berühmte kleine Beenhouwerstraat (Beenhouwer = Knochen-, Beinhacker, Metzger). Flejschpott nennen wir eine Eintopfportion, die ungewöhnlich viel Fleisch enthält. Und dat os e fuul Flejsch (ein faules Stück Fleisch) beschreiben wir den arbeitsscheuen Mitbürger.
Fleischbeschau
Als es bei uns noch kaum Schlachthäuser gab, war die Hausschlachtung von Rind und Schwein üblich und erlaubt. Vorgeschrieben waren dabei die Kontrolle des Schlachttiers und die Freigabe des Fleisches durch den amtlich Beauftragten. An unserer Oberahr war es der Tierarzt Dr. Scharrenberg aus Blankenheim, der die Flejschbeschau (Fleischprüfung in Verbindung mit der Trichinenschau) abhielt und mit einem violetten Stempel auf Vorderschinken und „Hinterbacken“ des Schlachttiers die Unbedenklichkeit bescheinigte. Mich faszinierte es immer, wenn der Flejschbeschauer die winzigen Fleischproben zwischen zwei dicke Glasplatten presste und durchs Mikerskop (Mikroskop) begutachtete. Manchmal durfte ich sogar durch die Linse spähen, sah aber nichts weiter als einen rötlichen Schimmer. Eine Flejschbeschau besonderer Art gab es bei heißer Sommersonne im Freibad in Blankenheim, wo massenhaft Flejsch am lebenden Objekt in der Sonne schmorte und dunstete. Da wurden freilich keine Proben entnommen und auch keine violetten Stempel aufgedrückt, und „beschauen“ konnte man hier auch ohne Mikerskop. Und zu sehen war weit mehr als nur ein rötlicher Schimmer. Einer allerdings war von dieser Art Flejschbeschau wenig, besser gesagt überhaupt nicht angetan: Unser Seelenhirte und Dechant Hermann Lux.
Flitsch
Die Flitsch ist ein Katapult, eine Steinschleuder, auch „Zwille“ genannt und fällt unter das Waffengesetz. Als Kinder bastelten wir uns selber unsere Flitschen aus einer Noßhecke-Jaffel (Astgabel aus Haselholz) und einem alten Einmachgummi, den Jött meist nur widerstrebend und nach dauerhaftem Quängele (Drängen) herausrückte. Unsere Flitsch reichte in keiner Weise an die heutige Waffe heran, wir hatten auch keine Stahlkugeln als Geschosse. Aber auch mit unserem Spielzeug hätte man leicht ein Auge „ausschießen“ können und die Eltern waren mit unserer Flitscherei gar nicht so sehr einverstanden. Flitsch war früher auch die volkstümliche Bezeichnung für die von Kall bis Hellenthal führende Oleftalbahn, deren Dampfzüge in den 1950er Jahren durch die damals modernen „Schienenbusse“ ersetzt wurden. Auch diese roten Fahrzeuge wurden noch Flitsch genannt, die Romantik der Ur-Flitsch war aber dahin. Es gibt den uralten Witz von Fritzchen, der vergeblich Gummi für seine Flitsch zu beschaffen versuchte, sich als Ersatz ein Mädchen wünschte, mit dem er in den Wald gehen und ihm den Schlüpfer ausziehen würde. Und dann, und dann? - der Vater wurde hellhörig und Fritzchen erklärte: Dann han ech Jummi für meng Flitsch.
Fleech
Die Fliege ist bei uns Menschen eine ziemlich ungeliebte Kreatur, die uns aber sozusagen „auf Schritt und Tritt“ begleitet und nicht „kleinzukriegen“ ist. Es gibt bekanntlich zweierlei Fliegenarten: Die Adfleech und die gleichermaßen verhasste Nochfleech, beide sind mehr oder weniger Einzelgänger. Die Adfleech ärgert uns schon ganz früh im Frühjahr, manchmal bereits im Februar, wenn ihre Artgenossen noch schlafen, daher auch ihr Name (ad = schon). Die Nochfleech dagegen schwirrt manchmal noch im Dezember durch unsere Stube, auch daher der Name. Kein Wunder also, wenn wir uns üwwer de Fleeje aan dr Wand ärgern. Fliegen können auch nahrhaft sein, zumindest als Notration, denn en dr Nuët friß dr Düvel Fleeje, na dann guten Appetit. De Fleeje steiche, et kött e Jewitter, den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung kennen wir alle von der Heuernte her, wenn die Stechbiester in Scharen über uns her fielen. Die spanische Fleech lautete im Kölner Dialekt ein herrliches Theaterstück mit Willi Millowitsch. Auch das Oberlippenbärtchen wird Fleech genannt, mancher von uns erinnert sich noch an den Diktator, der sich dieses Gesichtsschmucks bediente und ungezählte Nachahmer fand. Maach en Fleech heißt so viel wie „hau ab, verschwinde,“ und als Kommunionkinder waren wir Jungens stolz auf die Schleifenkrawatte, die ebenfalls Fleech genannt wurde. Fleejendress sind die punktförmigen schwarzen Flecken, den die Biester oft auf dem strahlend weißen Tischtuch hinterlassen. Den Fleejefänger mochte und mag ich wegen seiner unerhörten Klebrigkeit nicht leiden.
Floch (kurzes weiches o)
Floch heißt wörtlich „Flug,“ steht aber gelegentlich auch für „Flucht“ : En de Floch schlohn (in die Flucht schlagen), allerdings wird diese Redewendung heute kaum noch gebraucht, Flucht und fliehen umschreiben wir heute mit loufe john, de Kurv kratze, tirre john, sech dönn maache. Ein Kollege war mit dem Fahrrad gestürzt und Schäng (Johann, Hans) bedauerte ihn: Jung do häßte äwwer ene fiese Floch jedohn. Hierbei war nicht die Flucht, sondern der Flug, besser der „Fall“ gemeint. Jierdrögg jitt de Bejje dr Floch (Gertrud gibt den Bienen den Flug) lautet eine alte Bauernregel und die besagt, dass auf Gertrudis (17. März) die Bienen zu fliegen beginnen. Mehr oder weniger der Waidmannssprache entnommen ist unter anderem ene Floch Hoolejänse (Ein Flug Schneegänse) oder auch Ene Floch Duuve (Tauben). Regional steht Floch auch für den „Fluch,“ wobei dann aber das o gedehnt ausgesprochen wird. Die Schreibweise sollte dann eher Flooch lauten.
Flockekösse (weiches ö)
Das Eifeler Kösse hatte absolut nichts mit dem Küssen gemeinsam, vielmehr war es das Mundartwort für „Kissen.“ Ein Flockekösse war somit ein mit kleingeschnippelten Tuchresten (Flocken) gefülltes Kissen. Unseren Eltern fehlten die Groschen für den Einkauf weicher Daunenfedern, und bis sich vom eigenen Federvieh die Menge für ein einziges Kösse angesammelt hatte, vergingen Jahre : Höchstens zwei- bis dreimal im Jahr kam ein Huhn in et Kauchdöppe (Kochtopf), trotzdem wurden die wenigen weichen Federchen gesammelt und aufbewahrt. Generell im Gebrauch war das Flockekösse. In stundenlanger „Flitscharbeit“ wurden ausgediente Kleidungsstücke und Ähnliches mit der Alltagsschere zu Flocke zerstückelt. Die joot Scheer (gute Schere) durfte dafür nicht verwendet werden, damit sie nicht vorzeitig stupp (stumpf) wurde. Der Scherenschleifer kam nur selten und Selberschleifen war wenig erfolgversprechend, weil das richtige Werkzeug fehlte. Die Kössescheer war meistens tatsächlich ziemlich stumpf, nach einem halben Stündchen Flocken schnippeln schmerzten Finger und Hände ganz jämmerlich. Nicht selten bildeten sich an den geschundenen Hautstellen schmerzhafte Blasen.
Flöppche
Flöppche oder Föppche ist ein altes landläufiges Wort für das Kleinkraftrad, das heutige Moped. Die Namensgebung ist vermutlich auf das knatternde Auspuffgeräusch des Maschinchens zurück zu führen. Das Ur-Flöppche war die in den 1930er Jahren auf den Markt gekommene „98er Sachs,“ ein Kleinkrad mit dem bekannten 98 Kubikzentimeter-Sachsmotor, das Motorrad des Kleinen Mannes. Nach dem Krieg wurde zunächst das „Fahrrad mit Hilfsmotor“ mit höchstens 30 Kubikzentimeter Hubraum zugelassen, - eine Handvoll Motor, einschließlich Tank auf dem Vorderrad montiert, mit Keilriemenantrieb. In Blankenheimerdorf besaß Hammesse Mattes (Matthias Jentges) ein solches Maschinchen. Mitte der 1950er Jahre wurde unter der Dorfjugend das Moped aktuell, wer mitreden wollte, besaß ein Flöppche. Mein Flöppche hieß „Heinkel Perle“ und war für rund 700 D-Mark bei Hammesse Häns (Hans Hammes) gekauft, der damals eine kleine Autowerkstatt betrieb. Die „Perle“ besaß einen nicht rostenden Alu-Rahmen und war daher leichter als andere Mopeds, bei 49 Kubikzentimetern Hubraum und zwei Schaltgängen, leistete der Motor 1,5 PS, das Maschinchen war 50 Km/h schnell. Eine Besonderheit war die im geschlossenen Ölbad laufende Antriebskette. Heinkel-Lieferant war damals das Autohaus Löffel an der Aachener Straße in Köln. Heinkel-Mopeds waren selten, eine zweite „Perle“ gab es in unserem Nachbarort Mülheim.
Flutsche
Die Flügel größerer Vögel bezeichnete man häufig als Flutsche, das galt insbesondere auch für das Federvieh im heimischen Stall. Bei kleinen Vögeln war dagegen meistens von Flüjele die Rede. In der Regel hatte die Hühnerschar freien Auslauf, trieb sich in der Nähe des Hauses herum und geriet nicht selten über die Einfriedung hinweg in den frisch bestellten Garten. Um das zu verhindern, wurden ihnen de Flutsche jestüpp (die Flügel gestutzt): Die Spitzen der Schwungfedern wurden abgeschnitten. Die Tiere konnten dann zwar noch mot de Flutsche schladere (flattern), kamen aber nicht mehr über den Gartenzaun. Bei längerer Sommerhitze lassen de Jrompere de Flutsche hange und das bedeutet, dass unsere Kartoffelpflanzen zu welken beginnen. Der Volksmund dichtete sogar dem Menschen Flügel an: Wenn Klöösje (Klaus) net joot draan war (sich nicht wohlfühlte) und bedröppelt (niedergeschlagen) herumschlich, ließ auch er de Flutsche hange. Wenn wir Pänz daheim den frisch geschlüpften gelben Küchelcher (Küken) zu nahe kamen, rannte Mutter Henne mit gespreizten Flutsche und warnendem Zischen auf uns zu und wir nahmen schleunigst Reißaus: Eine „giftige“ Klotz (Henne, Glucke) konnte eklige Schnabelhiebe austeilen.
flutsche
Dieses Zeitwort steht in keinem Zusammenhang mit Flügeln oder Flutschen. Es bedeutet vielmehr „entgleiten, entwischen“ oder auch „gut vorangehen, gelingen.“ Hier ein paar typische Beispiele: Wenn der Mäher gut voran kam, hieß es Dem flutsch et höck (heute) äwwer joot. In solchem Zusammenhang war häufig auch fluppe gebräuchlich: Dem flupp de Ärbet (Arbeit). Für eine unbedachte Äußerung entschuldigte man sich: Dat os mir esu erüß jeflutsch. Ein Kaninchen war durch ein Loch im Drahtgitter seines Laufställchens jeflutsch, ich wollte es einfangen, doch et os mir durch de Fongere (Finger) jeflutsch. Beim Schuhkauf gab es zu unserer Kinderzeit eine Faustregel: Dr Fooß moß liëch eren on erüß flutsche konne, dann paß dr Schoh (Der Fuß muß leicht hinein und heraus gleiten können, dann passt der Schuh). Was flutscht, das ist in der Regel glatt und glitschig, die Seife beispielsweise oder der Fisch, und das heißt in unserer Mundart flutschich. So ist unter anderem bei Glatteis de Strooß (Straße) flutschich, und als Kind war mir der Spöllappe (Spültuch) verhasst, weil er unangenehm duftete und flutschich war. Flutschich hatte meistens einen negativen Beigeschmack.
Foderjang
Die Übersetzung lautet Futtergang oder auch Füttergang, was im Grunde gleichbedeutend ist. Der Foderjang war im kleinbäuerlichen Stall unserer Vorfahren eine feste Einrichtung: Der Raum zwischen den Futterstellen der Stalltiere – Veehkömp (Futtertröge) und darüber in Kopfhöhe die Röüf (Futterkrippen, Raufen) – und der Stallwand. Von hier aus wurden die Futterstellen beschickt. Der Foderjang besaß nicht selten einen direkten Türzugang zur Scheunentenne für den Transport von Heu und Stroh. Meistens gab es in der Foderjang-Decke zusätzlich eine Klappe, durch die das Futter direkt vom Heustall an den „Einsatzort“ befördert werden konnte. Bei uns daheim wurden im Foderjang auch die Kolerawe (Rüben) gelagert, die von Zeit zu Zeit portionsweise aus der Kolerawekuhl (Rübenmiete) neben dem Haus entnommen wurden. Im Foderjang lagerten sie frostfrei und wurden nach Bedarf gereinigt und als besondere Leckerei an die Tiere verfüttert. Zum Zerkleinern der dicken Knollen stand im Foderjang die handbediente Kolerawemöll (Rübenmühle), deren halbrunde Schnipsel auch bei uns Kindern hoch im Verzehrkurs standen: Die Kolerawe waren weiß, saftig und appetitlich, schmeckten leicht süßlich und kamen häufig auf den Eifeler Mittagstisch. Roh waren sie nicht weniger lecker. Bei uns daheim bestand der Boden im Foderjang aus gestampfter Erde. Als im Frühjahr 1945 die Amerikaner immer näher kamen, wurde in einer Ecke ein höllentiefes Loch gegraben und eine massive Holzkiste mit „Wertsachen“ darin versenkt. Ein paar besondere Gläser, Goldrandbesteck, Silbergeschirr, ein paar Schmuckgegenstände, – mehr „Wertsachen“ gab es im Eifelhaus kaum. Bei uns kam noch Vaters Lieblings-Spielzeug hinzu: Ein echter 6 Millimeter Kleinkaliber-„Flobert“ nebst einer Menge Munition. Das hätte im Entdeckungsfall fies ins Auge gehen können. Die Schatzkiste wurde aber nicht gefunden, und als sie später ausgegraben wurde, hat unsere Mutter als Erstes den schönen Flobert so lange auf den Hackstock gedonnert, bis der Schaft zersplittert und der Lauf krummgebogen war.
föhle
Wie im Hochdeutschen, so rankt sich auch im Dialekt eine Unzahl von Redewendungen um das kleine Wörtchen „fühlen,“ aus dem das Substantiv Jeföhl hergeleitet ist. E Jeföhl wie Weihnachte ist ein Ausdruck für Glück und Freude. Wer intensiv befragt oder geprüft wird, dem wird op dr Zant jefohlt (auf den Zahn gefühlt). Föhl dir ens aan dr Kopp heißt soviel wie „du bist bescheuert,“ wobei dem also Betitelten meistens auch noch das „Vögelchen“ gezeigt wird. Wer einem Irrtum unterlag oder einen Fehlschlag erlitt, wem also Unangenehmes widerfuhr, der hat sich fies aan dr Aasch jefohlt (ist böse enttäuscht worden). Bei manchen Zechgenossen steht der Bierpegel so hoch, dass man mom Fonger dran föhle (mit dem Finger dran fühlen) kann. Jemandem dr Puls föhle bedeutet so viel wie dessen Meinung erforschen. Wer die unangenehme Gewohnheit hat, andere Leute zu betatschen und anzugrapschen, der ist als Föttchesföhler verschrien. Wä net hüere well, moß föhle (Wer nicht hören will, muss fühlen) ist ein weises altes Sprichwort, und wo mr nix sitt, os et Föhle net verbodde (wo man nichts sieht, ist das Fühlen nicht verboten) ist ein Eifeler Sprichwort für spezielle Fälle, die allerdings nicht unbedingt mit Weisheit im Zusammenhang stehen.
Fonger (weiches o)
Unverkennbar Blangemerdörfer Platt: Im örtlichen Dialekt wird das i zum o, weitere Beispiele: Kind / Kond, Kiste / Koss, Mist / Moss, Schmied / Schmodd. Aus der Unmenge von Redensarten ein paar Auszüge: Dr Fonger om richtije Lauch han bedeutet „Recht haben, richtig liegen,“ De Fongere em Spoll han heißt „Die Finger im Spiel haben,“ Kromm Fongere maache kennzeichnet den Dieb, von dem auch gesagt wird dä kann de Fongere net bie sech haale (der kann die Finger nicht bei sich halten). Wehleidigkeit offenbarte sich früher oft durch einen mehr oder weniger überflüssigen Verband bei kleinster Wunde, und das kommentierten die Kumpels mit häste wier en krank Lomp öm dr jesonne Fonger jeweckelt (hast du wieder einen kranken Lappen um den gesunden Finger gewickelt). Sech de Fongere dreckich maache heißt eine unbeliebte Tätigkeit verrichten müssen, gelegentlich auch umschrieben mit do sin mir meng Fongere ze schad für. In Schloßtal bei Dollendorf steht die Ruine der früheren Burg, im Volksmund Fonger Joddes (Finger Gottes) genannt. Fongere van de Bilder ist ein meist gutgemeinter Rat und bedeutet so viel wie „Finger weg.“ In unseren Flegeljahren spielten wir abends im Dorf Schellemstöcker (Schelmenstreiche), und wenn wir dabei erwischt wurden und „stiften“ gingen, schallte es hinter uns her Waat nur, wenn ech öch en de Fongere kreje (Wartet nur, bis ich euch in die Finger kriege). Und schließlich heißt es von ungeliebten, egoistischen Zeitgenossen: Wemmer dem dr klejne Fonger jitt, talep dä noo dr janz Hand (Der rafft die ganze Hand, wo nur der kleine Finger gereicht wird).
fonne
Im Vergleich zur weitgehend üblichen Ausdrucksform fenne (finden, weiches e) bildet unser Dörfer Platt wieder eine Ausnahme, indem das i in o abgewandelt wird. Dat fonnen ech och richtich esu (Das finde ich auch richtig so) würden unsere Dorfsenioren, so es sie noch gäbe, diese Feststellung kommentieren. E blon Hohn fend ab on zo och e Koor lautet die Dörfer Übersetzung des bekannten Ausspruchs vom blinden Huhn. E jefonne Freiße ist bei uns das „gefundene Fressen,“ und wer senge Mann jefonne hät, der ist auf einen ebenbürtigen Gegner getroffen. Wä söök, dä fend ist eins der weisesten Sprichwörter aller Zeiten. Es gibt ungeliebte Mitmenschen, die an allem jät üßzesetze fonne, und von einem zueinander passenden Paar wird behauptet Die Zwei han sech jesoot on jefonne (…gesucht und gefunden). Do wiëste dech dren fonne mosse oder auch domot moßte dech affonne ist der Hinweis auf eine Unabänderlichkeit. Die Imperfektform von fonne ist bemerkenswert: fon, zum Beispiel Jester fon ech en dr Kulang ene Euro (Gestern fand ich in der Straßenrinne einen Euro), das Perfekt dazu: …han ech jefonne. Ein beliebtes Wort unseres unvergessenen Krämesch Pitter lautete Dat wied sech alles noch fonne (Das wird sich alles noch finden.“Noch weiser lautete jedoch eine zweite Formulierung des beliebten Gastwirts: Dat wiëd sech alles noch dr Weich wiese (wörtlich: Das wird sich alles noch den Weg weisen).
Fönnef (weiches ö)
Die mundartliche Fönnef ist unverkennbar die Fünf, und fönnef ist das entsprechende Zahlwort. Wie in der Standradsprache, so ist auch im Dialekt fönnef häufiger Bestandteil von Redewendungen: Aan de fönnef Fongere (Finger) afzälle beispielsweise, oder Dä hät seng fönnef Minutte (Schlechte Laune). Als das bekannte fönnefte Rad am Woon (Wagen) fühlt sich einer, dem nicht genügend Achtung entgegen gebracht wird. Die Fönnef dagegen war früher ein gängiges Wort für einen V-förmigen Riss in der Kleidung, hergeleitet von der römischen Zahl fünf (V). Eine solche Fönnef führte daheim in aller Regel zu heftigem Gezeter: Du häß (hast) jo ad wier en Fönnef em Hemp (Hemd), dat os jetz ad de Drette (die Dritte). Als Halbwüchsige spielten wir nächtlicherweile Schellemstöcker (Bubenstreiche) im Dorf und mussten dabei manchmal auch stifte john (flüchten). In der Finsternis lief ich gegen einen Zaun mit drei Stacheldrähten, und als wir unter der Straßenlampe den Schaden begutachteten, stellten meine Kumpels gehässig fest: Du häß jo en Fuffzehn en dr Botz. Unsere Erdkundelehrerin konnte mich nicht leiden (das beruhte auf Gegenseitigkeit), weil mich dieser Lehrstoff absolut nicht interessierte. In Geographie hatte ich eine Dauer-Fönnef.
Fooßließ
Haben Sie jemals Fußleisten an einer Bruchsteinwand befestigen oder auch nur einen Nagel in besagtes Mauerwerk einschlagen müssen? Wenn Sie dabei Glück hatten, geriet Ihr Nagel in eine Mörtelfuge und „hielt“ wenigstens halbwegs. Meistens aber traf er den Bruchstein, ein handgroßes Stück Putz platzte ab und mit dem haltlosen Nagel fiel die Fooßließ von der Wand. Jedes Fluchen war umsonst, auch der neue „Ersatznagel“ traf auf Stein. Die einzig effektive Lösung war das Eingipsen von Holzteilen in den Putz, und das war aufwendig und zeitraubend. Die Fooßließ war früher in der Regel ein mindestens handbreites und zwei Zentimeter dickes massives Eichenbrett, das beim Annageln an die Wand in aller Regel auch noch aufsplitterte und allein aus diesem Grund schon nicht mehr „hielt,“ vom abgeplatzten Mörtel ganz zu schweigen. Die Nägel mussten später „versenkt“ und zugekittet werden, und dabei platzte das Holz erneut auf… Die Oberkante der Ließ hatte der Schreinermeister zur optischen Verbesserung mit einem schönen, mehrstufigen Profil versehen, – in mühsamer Handarbeit mit dem Hobel, beim splitterigen Eichenholz eine grausame Arbeit. Die Eifeler Lehmwände waren alles andere als „plan,“ Buckel und Mulden im Putz waren üblich und damit das bündige Anliegen der Fooßließ absolut unmöglich. Ungemein kritisch war das „Einfassen“ etwa eines Kamins mit der Bodenleiste. Winkelschnitte waren geradezu unmöglich, wegen der Breite der Bretter passte so gut wie keine einzige Gehrung, besonders an den Außenseiten. Dasselbe galt für die Sockelließ, die wir heute als „Stuhlleiste“ bezeichnen würden. Ein gut meterhoher Sockel war im Eifelhaus üblich, die Wand wurde nicht durchgehend tapeziert, der Sockel wurde aufgemalt und damit Tapete gespart. Die Sockelließ sorgte für eine gerade Trennlinie. Eine dritte, unvermeidliche Leiste war die Tapeteließ in Gestalt einer zentimeterbreiten halbrunden Leiste, die etwa 20 Zentimeter unterhalb der Zimmerdecke den Wandabschluß markierte: Die Tapete wurde nicht bis an die Decke geklebt.
Föttche (weiches ö)
Während unser Dialektwort Aasch als ziemlich derbe Bezeichnung für „Hinterteil“ anzusehen ist, gilt Fott (weiches o) als „gemäßigtere“ Ausdrucksweise, und das davon abgeleitete Föttche ist schon sozusagen „salonfähig.“ So erkundigt sich beispielsweise meine Taxifahrerin Rosi, wenn sie mich frühmorgens zur Dialysefahrt abholt: Wiëd et Föttche wärm? Sie kennt meine dauernde „Knochenkälte“ und schaltet fürsorglich die Sitzheizung ein. Fott war zu unserer Kinderzeit der gängige Ausdruck der Eltern uns Pänz gegenüber. De Fott haue war eigentlich schon ein Allerweltsbegriff, den niemand von uns mehr ernst nahm. In Aachen gibt es einen interessanten Mundartvers: Et flooch en Fott et Daach erop, die wor met Hoddele ußjestopp und das besagt, dass ein mit Lumpen ausgestopftes Hinterteil das Dach hinauf flog. Im Kaffeekränzchen am Besuchertisch wurde der frische Familiennachwuchs vorgestellt und Tante Anna stellte entzückt fest: E Föttche hät dat Kerlche wie e Äppelche (Ein Pöchen hat das Kerlchen wie ein Äpfelchen). Aus dem Kölner Karneval ist beinahe weltweit das Stippeföttche bekannt, ein Tanz der Funkengarden zu den Klängen von ritsch ratsch de Botz kapott. Ein alter Kinderreim ist mir noch in Erinnerung: Adam on Eva sooßen en enem Höttche, hooven sech et Hembche op on klatschten sech et Föttche. Diese Behauptung scheint mir ein wenig weit hergeholt, dem Vernehmen nach trugen doch die beiden Paradiesbewohner statt des „Hembchen“ ein Feigenblatt. Ein nicht so ganz beliebter Zeitgenosse ist der Föttchesföhler, den man in unserem „verenglischten“ Deutsch aktuellerweise als Backside-Feeler betiteln müßte.
fottschmieße
Bevor unsere Eltern einen Gegenstand fottschmosse (wegwarfen, wegschmissen), wurde er dreimal ömjedräht (dreimal umgedreht) und eingehend geprüft, ob er nicht doch noch irgendwie verwendbar sein könnte. Wer noch die mageren Kriegs- und Nachkriegsjahre erlebt hat (ich zähle mich zu diesen Leuten), der scheut auch heute noch das unüberlegte „Entsorgen“ über die Mülltonne. Man ärgert sich zwar hundertmal über den, immer wieder en de Fööß (in den Füßen = im Weg, hinderlich) liegenden alten Kram, zum Wegschmeißen ist er aber zu schade, gebraucht wird er unterdessen nie, solange er noch präsent ist. Kaum aber in die Mülltonne gewandert, wird er schmerzlich vermisst. Fottschmieße, nöüet koufe (wegwerfen, neues kaufen) ist heute die Devise bei jedem noch so minimalen Defekt. Das ist in unserer Wegwerfgesellschaft absolut verständlich: Die Reparatur etwa eines Staubsaugers kann wesentlich teurer sein als ein Neukauf. Wer bückt sich heute noch nach einem zu Boden gefallenen Nagel? Als vor Jahren unser Hausdach erneuert wurde, sammelte ich nach Abschluß der Arbeiten zwei Kilo neue Nägel der verschiedensten Sorte rund um unser Haus auf. Zu meiner Kinderzeit erklärte mir Ohm Mattes (mein Onkel Matthias) beim Abbau alter Weidezäune: Die aal Nääl schmieß mr net fott, die klopp mr schnack on bruch se wier (Die alten Nägel schmeißt man nicht weg, die richtet man und braucht sie wieder). Ohm Mattes hortete auch die Henke (Griffbügel) von alten „Zinkeimern“ (Plastikeimer gab es damals noch nicht), weil sich eine solche Metallstange vielfach wiederverwenden ließ. Sperrmüll heute, - ganze Wagenladungen sind an einem einzigen Haus abzuholen. Jede Menge Möbel, fünf Jahre alt und unmodern geworden, - die schönsten Bauteile für eigene Kreationen. Man geniert sich aber, die Sachen beim Nachbarn weg zu holen und kauft lieber teure Neuware. Und in der Seele tut es weh, wenn das Holz in der Presse so richtig herzhaft kracht und splittert. Fottschmieße, solange die Sachen noch brauchbar sind, - man sollte es sich überlegen.
Fräusch
Wieder mal ein Beispiel für die „Geschlechtsumwandlung“ eines Substantivs im Eifeler Dialekt: Der Frosch ist bei uns Die Fräusch, was vermutlich auf die Verwandtschaft zwischen Frosch und Kröte zurückzuführen ist. Eine spezielle Benennung der Kröte kennt unser Platt nicht. Einen winzigen grünen Laubfrosch fand ich im vergangenen Sommer in unserem Garten, wie er dahin kam, ist mir ein Rätsel, denn dort gibt es keinerlei Wasserstellen. Zu meiner Kinderzeit hatten wir daheim in Nonnenbach alljährlich zur Laichzeit im Frühjahr eine regelrechte Fräuscheplooch (Froschplage). In der Ortsmitte bildete sich im Siefen (Talmulde, Geländeeinschnitt) beim Haus Knubbe (Plützer) direkt neben der Straße ein flacher Teich, in dem sich Hunderte von Fröschen (ich weiß nicht, welcher Gattung) tummelten. Allabendlich schallte ihr Laichgeschrei bis in die Dunkelheit weit über das stille Dorf hinaus, sogar wir in Schlemmershof hörten es gut. Die Nonnenbacher wünschten dem Froschvolk wegen der Schlafstörung alles Mögliche, nur nichts Gutes. Wochen später hörte das Geschrei auf, dafür aber wurde der Teich fast schwarz vor lauter Kutteköpp (Kaulquappen, Jungfrösche). Am Biotop Rosensiefen im damaligen Staatsforst Salchenbusch stieß ich wiederholt auf Geburtshelferkröten, deren helles Läuten ebenfalls weithin zu hören war. Hier fand ich auch einmal unter einem flachen Stein einen Feuersalamander, den wir Klinkemöll nennen und der angeblich giftig sein soll. Sein „Gift“ ist aber für den Menschen unschädlich. In Fortsetzung der Nonnenbacherr Hardt gibt es den Fräuschberch (Froschberg, Flurbezeichnung). Ob es dort besonders viele Frösche gab oder gibt, ist mir nicht bekannt. Knallfräusche sind bekanntlich die Feuerwerkskörperchen, die wir Kinder früher Fützer (Furzer) nannten. Wer en Fräusch em Hals hat, der hat eine „rauhe Kehle“ und muss sich ständig räuspern. Ein Fräuschebejn ist ein Froschschenkel, angeblich eine Delikatesse, die ich noch nie gekostet habe. Und die Fräuschebloom ist die schöne, sattgelbe Sumpfdotterblume. Wir Kinder kannten schließlich noch den Fräuschespej (Froschspucke), das sind die weißen Schaumpäckchen an den Grashalmen, in denen sich die Larven der Wiesenschaumzikade entwickeln.
Frellinge (weiches e)
Bei uns das übliche Wort für die Ortschaft Freilingen. Am ersten Wochenende im Mai feiern die Frellinger (Bewohner Freilingens) ihre traditionsreiche Kirmes und die war schon immer ein „Magnet“ besonders für die Jugend an unserer Oberahr: Die Frellinger Kirmes war und ist die Erste des Jahres in unserer Region. Ich erinnere mich an manche Ballnacht in Meiesch Hoff (Gaststätte Meiershof), nach dem Krieg charterten wir einen Kleinbus für die Kirmesfahrt nach Freilingen. Seit 1946 pilgern alljährlich am ersten Sonntag im Oktober die Gläubigen von der Oberahr zur „Mittlerin aller Gnaden“ nach Freilingen. Meistens fuhren wir mit dem Fahrrad, manchmal organisierte Dechant Lux einen Bus. Die Andacht auf dem Platz vor der Kapelle war stets ein besonderes Erlebnis. Am 25. Oktober 1891 brannte die damalige Kapelle nieder, der 19-jährige Matthias Gossen aus Lommersdorf rettete die Muttergottesstatue unter Einsatz seines Lebens aus den Flammen. Ein Frellinger Jong (Freilinger Junge) ist in Sportlerkreisen bekannt: Fabian Giefer, der seit 2014 beim Bundesligisten Schalke 04 das Fußballtor hütet. Und Dominic Sanz aus Freilingen hat sich als Popsänger einen Namen gemacht. Bundesweit bekannt geworden ist unser Frellinge durch die Freizeitanlage Freilinger See, die durch den Bau der Weilerbachtalsperre entstand und 1975 fertiggestellt wurde.
Fuëpsch
Das Wort wird mit deutlicher Trennung zwischen u und e gesprochen, wobei das e stimmlos ist: „Fu-äpsch“ wäre falsch. Eine hochdeutsche Übersetzung für die Fuëpsch gibt es eigentlich nicht, allenfalls könnte man das Gerät als „Musikinstrument“ bezeichnen, mit dem sich unmusikalische, quietschende und schrille Töne erzeugen lassen. Etwa in der Art, wie sie eine falsch geblasene Klarinette zustande bringt. Die Fuëpsch war eine Art selbst gebastelte Flöte oder Pfeife, die Vater beim Sonntagsspaziergang für uns Kinder herstellte: Von einem fingerstarken glatten Noßhecke- (Haselnuss) oder Vurelskiëschtestämmchen (Vogelbeerbaum) wurde durch leichtes Beklopfen mit dem Griff des Taschenmessers und vorsichtiges Drehen ein acht bis zehn Zentimeter langes Rindenstück abgelöst und so der Resonanzkörper für die Fuëpsch gewonnen, der am oberen Ende mit einem Luftspalt wie bei der Blockflöte versehen wurde. Das Rindenstück wurde mit dem leicht abgeplatteten „Block“ verschlossen, am unteren Ende wurde der Rest des entrindeten Stämmchens eingesteckt, und fertig war die Fuëpsch. Durch Verschieben des Stäbchens erreichte man verschiedene Tonhöhen, ein geschickter Fuëpscher (Bläser) brachte sogar „Hänschen klein“ zustande. Die Fuëpsch war ein kurzlebiges Instrument: Nach wenigen Stunden waren Holz und Rinde eingetrocknet und funktionierten nicht mehr. Das primitive Spielzeug ist längst aus der Mode gekommen, man kennt nicht einmal mehr den Namen Fuëpsch.
Für os Pänz
Das ist seit 1971 ein fester Begriff in Blankenheimerdorf, der inzwischen auch weit über die Ortsgrenzen hinaus guten Klang besitzt: Alljährlich findet bei uns am Pfingstsonntag das Wiesenfest Für os Pänz statt. „Für unsere Kinder,“ unter dieses Motto stellten die Initiatoren seinerzeit die Veranstaltung, die als eine Art „Kirmesersatz“ für die Kinder gedacht war: Zur Dörfer „Martinskirmes“ ist es sehr oft schon empfindlich kalt, Schausteller und Kirmesbuden kamen nur spärlich ins Dorf, die Kirmes spielte sich in den Kneipen ab und war ein Fest für die Erwachsenen. Im Frühjahr 1971 beschäftigten sich die Fußball-Seniorenspieler Günther Uedelhoven, Erwin Schmitz und Arthur Bertram mit der Realisierung eines Juxspiels Pils gegen Kölsch. Mit in der Thekenrunde stand Hans Klaßen (die Hääp), der die Idee hatte, das Fußballspiel mit einem Kinderfest zu verbinden, als Ersatz für verlorene Kirmesfreuden. Man fand auch gleich das treffende Motto Für os Pänz, das Kinderfest war geboren. Schon am Pfingstmontag 1971 wurde zum ersten Mal Wiesenfest gefeiert, am morgigen Pfingstsonntag, 24. Mai 2015, startet auf dem alten Sportplatz auf dem Stein das 45. Kinderfest. Die vier Initiatoren sind längst nicht mehr unter uns, ihre Idee aber lebt weiter im Dörfer Wiesenfest Für os Pänz.
Füerschöpp (weiches ö)
Die „Feuerschaufel“ war im bäuerlichen Alltag unentbehrlich, sie wurde auch Kolleschöpp (Kohlenschaufel), Klütteschöpp (Brikettschaufel) oder Eischeschöpp (Aschenschaufel) genannt. Es war eine handliche schmale eiserne Schaufel mit Holzgriff, die durch das Feuerloch an Herd und Ofen passte und für den Transport von Glut gebraucht wurde. Das war beispielsweise der Fall, wenn in der Stov (Stube, Wohnzimmer) der Ofen aanjestauch (angeheizt) werden sollte: Aus dem Küchenherd wurde mit der Füerschöpp ein wenig Glut in den Stubenofen befördert. Dabei breitete sich naturgemäß Qualm aus, was aber niemanden störte. Das Gegenstück der Füerschöpp war die breite Dreckschöpp, die wir heute vornehm „Kehrblech“ nennen. Die Füerschöpp diente gelegentlich sogar als Schmelztiegel bei der Herstellung von Pfeilspitzen für unseren selbst gebastelten Flitzebogen: In der Schaufel wurden die aus der Hülse gebrochenen Geschosse der K98-Gewehrpatronen erhitzt, bis die Bleifüllung geschmolzen und ausgeflossen war. Die nunmehr hohle Spitze wurde auf den Holzpfeil gesteckt. Ein solcher Pfeil war, gut ausbalanciert, ein ziemlich brauchbares Geschoß.
Füerstejn
Füer heißt Feuer und Stejn ist der Stein, der Füerstejn ist also der simple Feuerstein, der aber im und besonders nach dem Krieg eine Rarität und damit in der Maggelzeit (Zeit des Schwarzhandels) ein beliebtes Tauschobjekt war. Drei der winzigen silbernen Stäbchen gegen ein Viertelpfund Speck, das war ein gängiger Handel. Die aus Patronenhülsen oder Rohrstücken selbst gebastelten „Feuerzeuge“ brauchten nun einmal Feuersteine. Die „Tausendzünder“ waren meistens undicht und mussten häufig nachgefüllt werden, außerdem rochen Botzeteisch (Hosentasche) und Sackdooch (Taschentuch) ständig nach Sprit. Später gab es Feuerzeuge zu kaufen, dazu „gereinigtes Benzin“ und „Betriebsmaterial“ in Gestalt kleiner Glasröhrchen, Inhalt fünf Feuersteine und ein fertiger Feuerzeugdocht mit gehärtetem Ende zum Einfädeln. In der Brandheck (Waldbereich) bei uns daheim gab es im sandigen Boden massenhaft Kieselsteine aller Größen. Die versprühten beim Gegeneinanderschlagen kräftige Funken und wir bezeichneten sie also auch als Füerstejn. Unsere Urväter hätten damit eventuell ein Feuerchen in Gang gebracht. Auch wir Pänz versuchten es gelegentlich, unser Zunder muss aber zu feucht und unsere Ausdauer zu gering gewesen sein, denn gelungen ist es uns nie.
Fussläucher
Ortsübliche Bezeichnung für den Flurbereich „Fuchslöcher“ auf einer Anhöhe nördlich von Blankenheimerdorf. Bis Anfang der 1980er Jahre waren die Fussläucher Ausgangspunkt für den örtlichen Wintersport. Es gab hier kleinere Abfahrten und natürliche Schanzen, die der Dorfjugend vollauf genügten. Die Trasse der im Jahr 1984 in Betrieb genommenen Umgehungsstraße B.51n zerschneidet heute das Hanggelände, Wintersport ist nicht mehr möglich. Es war in den Jahren kurz vor dem Bau der Umgehung, als Walter Schmitz (Brummi-Schmitz) und Erich Klaßen (Back) eines Sonntags eine Idee in die Tat umsetzten: Sie malten Hinweisschilder „Wintersport“ und wiesen damit den Weg von der Ortsdurchfahrt über den Wejerberch (Weierberg = Flurbereich) bis zu den Fuchslöchern. Tatsächlich kämpften sich mehrere auswärtige Autofahrer über verschneite Feld- und Wirtschaftswege bis zu den Fussläuchern durch und waren nicht wenig verärgert, als sie das „Dörfer Skigebiet“ zu Gesicht bekamen. Ich sehe noch die aufgetakelte „Wintersportfregatte“ vor mir, wie sie wutbebend unter Hinweis auf den nicht vorhandenen Skilift ins Auto stieg. Immerhin: Ein paar Kinder tobten bereits im frischen Schnee herum, und ein paar Erwachsene kosteten von Back-Erichs duftendem Glühwein. In der Nähe der Fussläucher liegt das frühere Sportplatzgelände „Auf dem Stein“. Auf diesem einladenden Waldplatz findet seit 1971 am Pfingstsonntag das beliebte Wiesenfest Für os Pänz statt, hier steht auch die stark frequentierte Grillhütte mit Nebenanlagen.
Fützer
Das typische Dörfer Wort ist heute praktisch ausgestorben. Es entstand in den Nachkriegsjahren, als zaghaft die ersten pyrotechnischen Erzeugnisse wieder in den Handel kamen. Die eigentlichen Fützer, das waren winzige, streichholzförmige Papier-Knallkörper, die vom Geräusch her kaum mehr als einen mittleren „Furz“ von sich gaben und daher ihren Namen erhielten. Die Fützer waren relativ harmlos, man konnte sich höchstens daran die Finger verbrennen. Damals gab es noch keine Kanalisation im Dorf, die Abflussrohre der Spölstejn (Spülbecken in der Küche) mündeten an der Außenmauer der Häuser in die Kulang (Straßenrinne), manche Abflüsse besaßen nicht einmal einen Siphon. In diese Rohre steckten die Lausbuben den glimmenden Fützer und erschreckten damit so manche biedere Dörfer Hausfrau bei der Arbeit im Huus (Küche). Mit der Zeit kamen immer „härtere“ Kaliber auf, beispielsweise die „Schweizer Kracher.“ Auch die wurden ins Abflussrohr gesteckt, allerdings war in diesen Fällen schleuniges stifte john (stiften gehen = Flucht) angezeigt, wollte man nicht den wütenden Hausbewohnern in die Hände fallen. Fützer und Schweizer Kracher gab es an der Kirmesbude für jedermann zu kaufen, ebenso wie Poleverblättcher (Knallblättchen), Knalläetz (Knallerbsen) und sogar die später aus dem Verkehr gezogenen kräftigen Knallstoppe (Knallkorken) samt zugehöriger Pistole.
Fuulhouf
Ein Ausdruck, den es bei uns früher nicht gab, der auch heute wieder so gut wie ausgestorben ist. Fuulhouf bedeutet „Faulhaufen“ und bezeichnet einen Faulenzer, Nichtstuer oder Müßiggänger, hier und da ist es auch der etwas hintergründige Titel für einen Tunichtgut allgemein. Der Begriff ist vornehmlich im Euskirchener Raum gebräuchlich und wurde nach dem Krieg von dort durch Berufspendler bei uns „eingeschleppt,“ hat sich aber nie eingebürgert. Heute taucht Fuulhouf gelegentlich noch in der Kleingärtnersprache auf, als Umschreibung für den Komposthaufen: Ech moß menge Fuulhouf noch ömsetze (Ich muss den Komposthaufen noch umsetzen). Wer sich im Vereinsleben auskennt, der weiß, dass es immer wieder arbeitsscheue Drückeberger gibt, die immer dann durch Abwesenheit glänzen, wenn es irgendwo etwas aanzepacke (anzupacken) gilt. Das sind dann die üblichen Fuulhöuf (Mehrzahl), die außer Muulrappele (Maul aufreißen) wenig zustande bringen. Unsere Eltern und Großeltern bezeichneten einen Faulpelz in der Regel als Fuulich, beispielsweise wurde der Morgenmuffel von Mam auf Vordermann gebracht: Du Fuulich, sech datte op Jank jeräts (Du Faulpelz, sie zu, dass du in Schwung kommst).
nach oben zurück
|