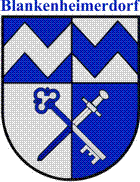|
Daachszitt
De Daachszitt sohn (die Tageszeit sagen = grüßen) wenn man sich begegnet, ist einer der wenigen schönen Bräuche unserer Kinderzeit, die bis heute im Eifeldorf erhalten geblieben und noch nicht in der Namenlosigkeit der Stadt untergegangen sind. Morje, Tach, n´Ovend, Nääch, – wie allgemein üblich, lassen auch wir den Zusatz „guten“ der Einfachheit halber weg, nur bei n´Ovend setzen wir das n voran, weil sich das besser aussprechen lässt. Nach Möglichkeit fügen wir auch den Namen unseres Gegenübers an, das klingt freundlicher, persönlicher. Begrüßen wir eine Personengruppe und wollen besonders freundlich sein, lautet der Gruß beispielsweise Jooden Oovend zesamme. Für uns Kinder war de Daachszitt Pflicht. Freilich durften wir die Erwachsenen nicht mit Du und dem Namen anreden. Für uns hieß es stattdessen Tach Schmette Ohme (Onkel) oder n´Ovend Lenze Tant. Das hochdeutsche „Herr“ oder „Frau“ kam für uns nicht in Frage. Zwei Ausnahmen gab es aber doch: Den Lehrer hatten wir mit dem „deutschen Gruß“ und dem Zusatz „Herr Lehrer“ anzureden, beim Pastor war „Grüß Gott, Herr Pastor“ vorgeschrieben. Im Übrigen waren die erwachsenen Dorfbewohner für uns Pänz generell Ohme oder Tant, was heute noch allgemein beim Onkel Doktor in Erscheinung tritt. Bei uns daheim war sogar zum Ausdruck der Achtung Schlemmesch Vatter oder Kaue Motter als Anrede an die Nachbarsleute üblich.
Daachtreps (weiches e)
Dachtraufe, abgeleitet von Treps = Tropfen. Das Eifelhaus besaß früher keine Dachrinne, das Regenwasser floss von den Schottelspanne (einfache Dachziegel) auf den Boden und hinterließ dort mit der Zeit eine deutlich sichtbare Tropfspur, im gepflasterten Hof waren die Steinfugen unter der Daachtreps aus- und blankgewaschen. Als Kinder wollten wir naturgemäß ständig schnell größer werden und Mam (Mutter) hatte ein Mittelchen dafür: Stell dech önner de Daachtreps, dann wiëschte jruëß (Stell dich unter die Traufe, dann wirst du groß). Wenn es am Waschtag zufällig regnete, wurde die große Zinkwanne unter die Daachtreps gestellt und das Regenwasser aufgefangen, nachdem der erste Guss die Dachziegel sauber gespült hatte. Das Regenwasser war besonders „weich“ (weil destilliert) und fürs Wäschewaschen bestens geeignet. Außerdem ersparten wir uns auf diese Weise das mühsame Wasserschleppen vom Lohrbach herauf: Zu meiner Kinderzeit gab es daheim noch keine Wasserleitung. Wir kannten damals allerdings auch nicht den heute so widerwärtigen Sauren Regen. Ob heute noch das Regenwasser ideal fürs Waschen wäre, wage ich zu bezweifeln.
Daaneisch
Ein wenig bekanntes Wort für die Dasselfliege, die allgemein Bremsch oder Brämsch (Bremse) genannt wird. Mit Bremsch werden unterdessen auch die Stechfliegen insgesamt bezeichnet, beispielsweise die Rinderbremse oder der Wadenbeißer. Daaneisch (Da-nisse) deutet darauf hin, dass es sich um eine übergroße Stechfliege handelt. Wenn bei der Heuernte in brüllender Sommerhitze die Stechfliegen in ganzen Wolken um unserer Gespanntiere summten, wurde einer von uns Kindern zum Flejejare (Fliegenjagen) abgestellt. Mit einem belaubten Zweig aus dem nächsten Gebüsch wedelten wir um die Köpfe der Tiere, die diese „Behandlung“ bereitwillig über sich ergehen ließen. Kritisch wurde es nur, wenn dabei ein paar hummelgroße Daaneische auftauchten. Allein deren bösartiges Brummen machte die Tiere schon wild. Wenn sie in Panik gerieten, konnte das böse Folgen für Menschen und Heuladung haben. Die Dasselfliege sucht das dicht behaarte Fell der Huftiere für die Eiablage, Menschen attackiert sie nur in Ausnahmefällen. (Siehe auch Angelbetz).
Daaneißel
Der Begriff ist so gut wie ausgestorben und nur bei einzelnen Senioren noch aus ihrer Kinderzeit in Erinnerung. Daaneißel oder regional auch Daanessel war das Mundartwort für die Taubnessel, die nicht „brennende“ Schwester der Bröhneißel (Brennessel). Im Krieg mussten wir Schulkinder wieß Daaneißele (weiße Taubnesseln) als Heilkraut sammeln, die Pflanze sollte bei Darm- und Atemwegerkrankungen hilfreich sei. Sehr häufig ist bei uns die ruëd Daaneißel (rote…) anzutreffen. In unserem Garten beispielsweise bedeckt sie schon früh im März ganze Beetflächen und ist dem Hobbygärtner ein lästiges Unkraut. Des Gärtners Ärger vergeht unterdessen rasch angesichts des emsigen Treibens unzähliger Insekten, die auf dem rot-lila Teppich einen reichgedeckten Nektartisch vorfinden, dicke schwarze Erdhummelköniginnen beispielsweise, die schon so früh im Jahr auf Nestsuche sind. Tatsächlich produziert die Daaneißel relativ viel Nektar: Steckt man ein ausgerupftes Blütchen in den Mund, so spüren wir deutlich ein winziges süßes Tröpfchen auf der Zunge. Die Taubnessel gedeiht besonders gut in stickstoffreichem Boden, sie zeigt dem Gärtner an, dass sein Gartenbeet hervorragend als Jromperestöck (Kartoffelfeld) geeignet ist. Und als Unkraut ist sie leicht durch einfaches Ausreißen zu beseitigen. Kein Grund also für besonderen Gartenärger.
Daaßfett
In der Tierfabel heißt der Dachs „Grimbart,“ in unserem Dialekt ist er der Daaß, sein Fett ist das Daaßfett und das war zur Zeit unserer Eltern ein gängiges Hausmittel gegen mancherlei Gebrechen. Auch bei uns daheim gab es eine Dose mit Daaßfett, das seltsam „stark“ duftete und bei uns Kindern unbeliebt war. Dachsfett war in der Apotheke erhältlich, manche Leute stellten es aber auch, wie Schweineschmalz, selber her. Daaßschonk (Dachsschinken) soll sogar eine Feinschmeckerkost gewesen sein. Dachsfett wurde daheim bei allen möglichen Knochen-, Muskel-, Rücken- und Gelenkschmerzen angewandt, es half aber auch bei Erkältungen, Grippe und sogar bei heftigem Juckreiz und Schronne (Schrunden, rissige Hände). Besser noch als Schweineschmalz hielt Daaßfett die Haut geschmeidig und die blutigen Risse heilten, wegen des strengen Dachs-Geruchs zogen wir Pänz unterdessen das Schmalz vor. Die Erwachsenen massierten sich dagegen die schmerzenden Körperteile intensiv mit Daaßfett. Gelegentlich wurde das Fett auch erhitzt und getrunken, das schmeckte scheußlich wie Lebertran, half aber erstaunlich bei Bauchschmerzen.
dä, die, dat
Das sind unverkennbar die Mundartbezeichnungen für die hochdeutschen Artikel „der, die, das.“ Übrigens: In der Volksschule gab es keine „Artikel,“ da kannten wir nur „Geschlechtswörter,“ und das war eine sehr viel treffendere Bezeichnung. Viele Wörter unserer Standardsprache erfahren im Eifeler Dialekt eine „Geschlechtswortumwandlung,“ in zeitgemäßem Deutsch also eine „Artikeltransformierung.“ Geradezu charakteristische Beispiele hierfür sind unter anderem die Baach (der Bach), die Schonk (der Schinken) oder die Knauch (der Knochen). Dä Baach, dä Schonk, dä Knauch, - im Eifeler Platt absolut unmöglich. Markante Beispiele sind auch dat Öllich (die Zwiebel), dä Ollich (das Öl) oder dat Schaaf (der Schrank). Die Anwendung von dä, die, dat kann in der Regel durch dieser, diese, dieses ersetzt werden, weil wir nämlich einen ganz bestimmten Gegenstand präzise bezeichnen wollen. Beispiel: Dä Boum, die Frau, dat Fenster. Wenn wir über dieselben Gegenstände im Allgemeinen sprechen, sagen wir dr, de, et, Beispiel: Dr Boum, de Frau, et Fenster. Diese Version ist weitgehend mit dem Holländischen verwandt: De boom, de vrouw, het venster. Das holländische het wird et gesprochen. Angesichts eines derartigen „Geschlechtswort-Wustes“ lobe ich mir die Engländer, die jeglichen „Artikelsalat“ vermeiden und durch ein einziges Wörtchen ersetzen: The.
dämmele
Das Wort bedeutet „niedertreten, niedertrampeln“, im weitesten Sinne allgemein laufen oder trampeln. Wenn im ersten Stock Gerenne war und die Decke bebte, ereiferte man sich im Parterre: Wat oß da für e Jelöufs (Gelaufe) do owwe, wat dämmelen die do eröm. Einen vergeblichen Fußmarsch beschrieb man etwa so: Nu sen echt doch für nix on wier nix noh Blangem jedämmelt! Wenn beim Viehhüten eins der Tiere ins benachbarte Rübenfeld geriet, waren sehr bald de janz Kolerawe zerdämmelt und das konnte zu mächtigem Ärger mit dem Feldeigentümer führen. Gefürchtet war bei uns Pänz das Wort dämmele im Zusammenhang mit dem Heu abladen in der Scheune. Da nämlich mussten wir auf dem Heustall das sperrige frische Heu durch ununterbrochenes Darüberlaufen nierdämmele (niedertreten). D as spielte sich zum Schluss hoch oben unter den sommerheißen Dachpfannen ab, zwischen meterlangen staubgefüllten Spinnweben und unter Wespennestern mit angriffslustigen Bewohnern. Hitze, Schweiß, Staub und von der Tenne herauf die Mahnung Nu jö, ens jät monter do owwe, wenn man einmal zu verschnaufen trachtete. Heudämmele war eine Qual.
Dämp
Der Ausdruck wird bei unterschiedlichen Gelegenheiten gebraucht, wurzelt aber in jedem Fall in dem Grundbegriff „Dampf.“ Während die Standardsprache darunter den Wasserdampf versteht, zählen bei uns auch Qualm und Rauch zum Dämp: De Pief moß dämpe (Die Pfeife muss qualmen) oder Dr Dämp stejch huh, et jitt joot Wedder (Eifeler Wetterregel: Der Kaminrauch steigt hoch, = gutes Wetter steht bevor). In speziellen Fällen ist auch Damp gebräuchlich: De Lok stet önner Damp (Die Lok steht unter Dampf) oder Dampmaschin, Dampwalz, Wasserdamp, bei diesen Hauptwörtern wäre Dämp fehl am Platz. Auch der Kochdunst war Dämp: Et Kauchdöppe dämp (der Kochkessel dampft), allerdings nannte man diesen Dampf meistens Schwadem. Wenn bei schwerer Arbeit den Leuten der Schweiß ausbrach, ging ihnen dr Dämp erüß und wenn irgendwo Rauch aufstieg, wurde man misstrauisch: Do dämp et, et wiëd doch wahl net brenne (Da ist Rauch, es wird doch wohl nicht brennen), wobei mit diesem „brennen“ naturgemäß ein Schadenfeuer gemeint war. Der brave Arbeitsmann rackert sich Tag für Tag ab, damit dr Kamin am dämpe bliev (Sorge fürs tägliche Brot), und von einem starken Raucher sagt man: Dä dämp wie en Lok (Der qualmt wie eine Lokomotive).
Dampwalz
Für uns Kinder war es ein Riesen-Ereignis, wenn irgendwo beim Straßenbau eine Dampfwalze auftauchte. Eine solch mächtige Maschine sah man nicht alle Tage, und schon gar nicht dampfend und fauchend bei der Arbeit. Wir liefen drei Kilometer bis zur Schmidtheimer Straße bei Blankenheimerdorf, um eine Dampfwalze im Einsatz zu sehen. Uns faszinierten die mächtigen Eisenräder, das ständig drehende Schwungrad, und ganz besonders der trichterförmige Schornstein, der manchmal dicken schwarzen Qualm ausstieß. Im Sommer 1949 gab es für uns ein Ereignis: Der Weg nach Blankenheimerdorf wurde ausgebaut, die Dampwalz war direkt bei unserem Haus im Einsatz. Der Straßenbau war schon in 1938 begonnen worden, wurde aber kriegsbedingt unterbrochen. Die Wehrmacht hatte das bei Regen matschige Grundbett durch einen Knüppeldamm befahrbar gemacht und hierfür kurzerhand den schönen Fichtenbestand am Fuß der Hardt zum Großteil „abgesäbelt.“ Übers Wochenende war die Dampwalz bei uns am Transformator abgestellt worden. Am Sonntagnachmittag erschienen drei jüngere Männer aus Blankenheimerdorf, heizten die Walze auf und kutschierten eine Weile hin und her, bis plötzlich der frische Damm nachgab und die schwere Maschine schräg in den Graben rutschte. Ratlosigkeit, Verzweiflung, schließlich lieh sich einer der Drei Vaters „Adler-Fahrrad“ und strampelte nach Blankenheimerdorf. Von dort erschien eine Stunde später Bürgermeister Johann („Schang“) Leyendecker mit dem „Kassentrekker“ (Traktor). Mit dessen Hilfe gelang nach stundenlangem „Schuften“ endlich die Bergung der schweren Maschine. Wie die Geschichte endete, weiß ich nicht, ganz sicher aber haben sich an nächsten Morgen die Firmenarbeiter über den zermurksten Straßengraben gewundert.
danndohn (hartes „an,“ Beispiel: „Tann“)
Dohn dir dat Booch ens joot dann, späder boste fruh drmot (Heb dir das Buch mal gut auf, später hast du Freude daran) meinte Jött und schenkte mir Karl May´s „Winnetou.“ Das Buch bestand aus acht oder mehr Einzelheften und wäre heute eine Rarität. Danndohn bedeutet wörtlich „wegtun, forttun,“ wobei der früher übliche Ausdruck „von dannen“ offensichtlich Pate gestanden hat. Eine weitere Bedeutung hatte danndohn im Sinne von „wegstecken.“ Da wetterte beispielsweise Ohm Mattes: Jetz hät os doch dä Fuss ad zwei Hohner vüer dr Nas fottjehollt, dat moßte dir ens danndohn! (Jetzt hat uns doch der Fuchs schon zwei Hühner vor der Nase weggeholt, das musst du dir mal wegstecken). Und Jannespitter, der ihm das nicht glauben mochte, wehrte ab: Hüer op, Mattes, do häßte äwwer noch ens ejne dannjedohn. (…da hast du aber wieder mal einen von dir gegeben). Wä hät menge Brell dannjedohn zeterte Jött und suchte vergeblich im Haus nach ihrer Brille, die sich schließlich im Nähschäußje (Schublade an der mechanischen Nähmaschine) fand. Dohn dir dat joot dann (Schreib dir das hinter die Ohren) war eine oft gebrauchte Mahnung im Zusammenhang mit einer elterlichen Anordnung.
Dännebetz (weiches e)
Tannenzapfen, allgemein das Samengehäuse der Nadelbäume. Die Dännebetz war bei uns speziell der Fichtenzapfen: Dänne (Tannen) war und ist die landläufige Bezeichnung der Fichten. Trockene Dännebetze wurden häufig als Brennstoff für den Küchenherd benutzt. Die Betze entfachten im Handumdrehen ein Höllenfeuer, das beispielsweise beim Rievkoochebacke (Reibekuchenbacken) erforderlich war. Sie verbrannten allerdings sehr rasch, es musste häufig nachgelegt werden. Trotzdem wurden die Zapfen nicht selten als Wintervorrat für den Stubenofen gesammelt. In 1996 trug unser Weihnachtsbaum den prächtigsten Schmuck, den man sich denken kann: mehr als 100 natürliche Dännebetze. Wegen der Zapfenlast mussten die Äste einzeln hochgebunden werden. Künstlicher Baumschmuck war da kaum erforderlich und unser Wohnzimmer duftete köstlich nach Fichtenharz. Die zwei Meter hohe Spitze einer gut gewachsenen mittleren Fichte war ein Geschenk des Forstbeamten. Dännebetze fanden in vielen Eifeler Stuben als dekoratives natürliches Weddermännche (Wettermännchen) Verwendung: Bei trockener Witterung öffnen sich die Samenschuppen, bei Feuchtigkeit schließen sie sich fest. Dännesoome (Fichtensamen) sind eine Lieblingsspeise des Eichhörnchens.
Danzliehrer
Tanzlehrer, das war früher in den ländlichen Gegenden ein selten anzutreffender Beruf, den gab es nur in der Stadt. Den Tanzlehrer kannte man bei uns nur dem Namen nach. Die Leute hätten auch kein Geld für die Danzscholl (Tanzschule) erübrigen können. Mit 14 Jahren, nach acht Volksschuljahren, kam man damals üß dr Scholl (aus der Schule), und mit 16 oder 17 durfte man in Begleitung der Eltern schon mal auf den Kirmesball gehen. Die hierfür erforderlichen Tanzkenntnisse hatte man sich in zahllosen „Probeabenden“ mit Gleichaltrigen selber beigebracht: Tanzsaal war nicht selten die blank gefegte Scheunentenne, sofern sie wenigstens in etwa glatt und eben war. Einer sorgte mit dem Quetschböggel (Harmonika, meistens ein Knopfakkordeon) für „Tanzmusik,“ und unter Anleitung eines kundigen Erwachsenen wurden Walzer, Rheinländer, Polka und Tango geübt. In Blankenheimerdorf beispielsweise trainierten Konsums Ann (Anna Rosen) und Kuhle Klööß (Nikolaus Görgens) die Dorfjugend bis zur Perfektion in Quadrille und Lancier. Nach dem Krieg hielt die Tanzschule Bert Müller aus Köln regelmäßig Kurse bei uns im damaligen Saal Buhl ab. Wir waren so um die 12 bis 15 Schülerpaare und alle sehr schüchtern, hielten also auch „gehörigen“ körperlichen Abstand zueinander. Beim Tango, der ja eng geschlossen getanzt wird, stupste uns der Lehrer deutlich gegeneinander: „Da darf kein Gras mehr zwischen wachsen.“ Dabei strich er mit der flachen Hand zwischen uns her, was ihm auf der weiblichen Seite offensichtlich besonderes Vergnügen bereitete. Wer will es ihm verdenken. Heute käme der Mann vor den Kadi, wegen unsittlicher Berührung!
Danzscholl (weiches o)
Die mundartliche Danzscholl ist die hochdeutsche Tanzschule. Ab und zu wird im Fernsehen über die Arbeit von Tanzschulen berichtet. Dabei gehen die Gedanken zurück in die frühen 1950er Jahre, als wir selber im damals noch vorhandenen Saal Buhl die ersten Tanzschritte übten. Unser Danzliehrer (Tanzlehrer) hieß Bert Müller, er war aus Köln und hielt damals alljährlich bei uns einen Tanzkursus ab. Er besaß einen altertümlichen Plattenspieler und etliche reichlich abgenutzte „78er“ Schellackplatten. Unsere Tänze waren damals noch „zahm“ und siddich (gesittet), als Erstes lernten wir den Langsamen Walzer. Ich hatte mir damals gerade selber einen Plattenspieler zugelegt und brachte einige meiner Schellackplatten mit in die Tanzschule. Eine davon gefiel dem Lehrer gut: „Neuer Jux und Rhythmus,“ zwei 78er Seiten flotter Swing, darunter beispielsweise „Alexanders Ragtimeband.“ Die Platte existiert und funktioniert heute noch. Ich erinnere mich noch an den Abschlussball. Den mussten wir allein über die Bühne bringen: Der Tanzlehrer war aus irgendwelchen Gründen verhindert, er hatte uns aber seine Musikanlage zur Verfügung gestellt.
dardrohn (hartes o)
Die wörtliche Übersetzung lautet „dahintragen,“ die Bedeutung ist „ausreichen, genügen, zufrieden stellen.“ So muss beispielsweise der winterliche Heuvorrat für die Stalltiere derart bemessen sein, dass er bos et Fröhjohr dardrejht (bis zum Frühjahr reicht). Mattes hatte auf dem Hillesheimer Markt eine Kuh verkauft und meinte zum Verkaufserlös: Mir hät et darjedrohn (Mir genügt es). Ich hatte von Mam sechs Reichsmark Taschengeld für die Blankenheimer Kirmes bekommen und wurde ermahnt: Dat moß für all drie Daach dardrohn, mieh jit et net (Das muss für alle drei Tage reichen, mehr gibt es nicht). Mit sechs RM vergnügte man sich damals drei Tage lang auf dem Kirmesrummel, und daheim nach dem „Haushalt“ gefragt, konnte man mehr oder weniger zufrieden verkünden: Et hät esu jrad darjedrohn (Es hat gerade so gereicht), womit man deutlich zu verstehen gab: Et hät röhich och jät mieh sin konne (Es hätte ruhig auch etwas mehr sein können). Neben dem altgewohnten drohn hat sich längst auch drare für den Begriff „tragen“ bei uns eingebürgert. Dardrohn wird allerdings nur ganz selten durch dardrare ersetzt.
Därm
Unser Dialekt kennt sowohl dä Därm als auch die Därm, im ersten Fall ist ein einzelner Darm gemeint und die Aussprache lautet wie bei „Lärm.“ Im zweiten Fall sind es eben mehrere Därme und das ä wird wie in „Wärme“ gesprochen. Mancher Zeitgenosse rümpft ein wenig die Nase, wenn vom Darm die Rede ist. Dabei handelt es sich um unser wichtigstes Verdauungsorgan. Bei der Hausschlachtung daheim wurden die Därme des Schlachttieres für die Wurstherstellung gebraucht und mussten zuvor entsprechend gereinigt werden. Noch jetzt sehe ich unsere Jött mit dem Schrappbrett auf den Knien im Huus (Küche) sitzen und Stunde um Stunde mit dem Rücken des Küchenmessers die linksgedrehten Därme abschaben. Därm schrappe war „ihre“ Arbeit, die sie niemandem sonst überließ. Es gibt ein paar mehr oder weniger salonfähige Redensarten. Einen dünnen langen Menschen nennt man beispielsweise ene lange Därm. Wenn sich in einer Ansammlung von Menschen plötzlich ein ungewohnter Duft bemerkbar macht, stellt man fest: Hie hät sech äwwer ejner fies en dr Därm jetrodde (…in den Darm getreten), und bei strenger Kälte ergeht der gut gemeinte Rat: Zieht euch warm an, sonst friert euch der Darm an.
dauch
Eine positive Antwort auf eine negative Frage wird mit dauch (doch) eingeleitet. Du häß bestemp deng Aufjabe noch net jemääch (Du hast vermutlich deine Hausaufgaben noch nicht gemacht) fragte beispielsweise die Mutter, und Fränzchen wehrte sich: Dauch Mam, die sin ad lang fäëdich (Doch Mutter, die sind schon lange fertig). Du wiësch mir doch wahl net krank were (Du wirst mir doch wohl nicht krank werden) meinte Drinche besorgt, und Mattes quengelte: Et schenk dauch, mir dohn ad all Knauche wieh (Es scheint doch, mir tun schon alle Knochen weh). Wenn dauch mit besonderem Nachdruck betont werden soll, wird daraus endauch, analog dazu als Gegenbeispiel enää (nein). Wo blievste esu lang, wejßte net, wie spät et ad os (Wo bleibst du so lange, weißt du nicht, wie spät es schon ist)! – Endauch, äwwer et jing net fröher (Doch, aber es ging nicht früher). Ein unvergessliches Episödchen von der Kirmes in Weyer: In den 1950er Jahren, mitten in der Nacht verspürten wir Lust auf eingelegte Gurken. Gegenüber dem Tanzsaal rappelten wir so lange an einer Haustür, bis ein altes Mütterchen im Nachtgewand erschien und auf unsere entsprechende Frage völlig ratlos stotterte: Endauch, ech han e Döppe Jurke. Eilfertig verschwand sie im Hintergrund und brachte uns den Steintopf, den wir im Handumdrehen leerten. Zwei Tage später tat Kollege Jupp im gemeinsamen Auftrag einen Zehnmarkschein in den leeren Gurkenpott, was zwar dankend angenommen wurde, eigentlich aber gar nicht nötig gewesen wäre. Das Mütterchen hatte bereits ein neuen Pott eingelegt und versicherte: Nääks Johr Kirmes maachen ech für öch e Extradöppe Jurke. Sie war also absolut nicht böse, im Gegenteil: Wir sollten im nächsten Jahr wiederkommen. Das war um 1958, heute würde daraus eine Polizei- und Gerichtsaktion.
Decker
Decker ist eigentlich kein Mundartwort, es unterscheidet sich in keiner Weise vom Standartausdruck und ist ein häufiger Familienname. Von 1973 bis 1993 hieß beispielsweise der Oberkreisdirektor von Euskirchen Dr. Karl Heinz Decker, und der Vorgänger unseres Amts- und späteren Gemeindedirektors Reger hieß Fritz Decker. Im Eifeler Dialekt war Decker ganz früher die Bezeichnung speziell für den Strohdachdecker, heute beschreibt der Ausdruck das Dachdeckerhandwerk in allen seinen Variationen. Vor einiger Zeit hörte ich ungewollt ein originelles Gespräch zwischen einem Dachdeckermeister und seinem Gehilfen mit. Der Meister arbeitete auf dem Dach, der Lehrling hielt sich unten am Boden auf: He Jong, häste dr Hamer aan dir? – Enää, Chef. – Waröm dann net, ene joode Decker hät emmer dr Hamer aan sech! Nu dohn en aan dech on dann kößtens erop! Den Hammer „an sich haben“ bedeutet „in der Halterung am Koppelgürtel tragen,“ ein Zustand, der nach Ansicht des Eifeler Meisters für einen „guten Decker“ selbstverständlich ist. Und köstens erop heißt wörtlich „kommst du mal herauf.“
Dejlche
Im und nach dem Krieg, als es bei uns noch kein Ladenschlussgesetz gab, hatten die Geschäftshäuser in Blankenheimerdorf regelmäßig sonntags ab etwa 8,30 Uhr, wenn die Frühmesse zu Ende war, ihren Laden geöffnet, - hauptsächlich für die Kirchenbesucher aus Nonnenbach und Schlemmershof, denen dadurch ein besonderer Einkaufsgang ins Dörf erspart blieb. Jedes Geschäft hatte seine Stammkundschaft, wir selber kauften aan Katze ein, im Dorf eher aan Jierdrögge genannt. Im Laden bediente Katze Finche, die junge Frau Josefine Bell. Wir Kinder mochten sie besonders gut leiden, sie hatte nämlich meistens für uns ein leckeres Dejlche (Teilchen) aus ihrer Bäckerei parat, damit wir uns für den langen Fußmarsch ein wenig stärken könnten. Heffedejlcher (Hefeteilchen) oder gar Puddingdejlcher, das waren für uns seltene Leckereien, die schmeckten noch besser als die beliebte Jreeßtaat (Grießtorte). Ich meine mich entsinnen zu können, dass damals das gängige Dejlche 10 oder 15 Pfennig gekostet hat, - das waren noch Zeiten! Wenn später Bäckermeister Eberhard Bell seine Nonnenbacher Kundschaft vor Ort per Auto belieferte, wurde er am Pötz (Brunnen in der Ortsmitte) von den Dorfkindern erwartet: Bells Ewwert (Eberhard) hatte immer ein paar Extras für die Pänz dabei, zum Beispiel süße Dejlcher.
Dejßem
Das Wort bedeutet „Sauerteig“ und ist in der Eifel weit verbreitet, regional ist auch Deeßem üblich. Der Begriff scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, ist aber einfach zu erklären: Der Sauerteig heißt in Holland „Desem.“ Unser ripuarischer Dialektraum hat bekanntlich sehr viele Ausdrücke aus dem Niederländischen übernommen, darunter auch den Dejßem. Etwa alle drei Wochen wurde bei uns daheim Brot gebacken. Zwei Tage vorher setzte Mam im krugähnlichen Stejndöppe (Steintopf, Keramikgefäß) den Dejßem an, der als Triebmittel fürs Roggenbrot erforderlich war. Aus Roggenmehl, Wasser, Milch und Hefe knetete sie einen faustgroßen Klumpen, der im abgedeckten Döppe zwei Tage „ziehen“ musste. Am Backtag wurde der fertige Dejßem in der hölzernen Mool (Backtrog) dem Brotteig beigegeben, der bald mächtig opjing (aufging) und manchmal die ganze Mool ausfüllte. Unser Koorbruët (Korn-, Roggenbrot) wurde im kühlen Keller aufbewahrt, schimmelte nie und war selbst nach drei Wochen noch genießbar. Vom früheren Gut Altenburg ist überliefert, dass dort alle zehn Tage 30 Brote gebacken wurden. Den Dejßem setzte jeweils das Familienoberhaupt Andreas Rohen selber an, das eigentliche Backen war Sache der Hausfrau.
Denn
Bei uns daheim hieß es, offensichtlich fälschlicherweise, dä Denn, richtig wäre dagegen die Denn, gemeint ist nämlich die Tenne, der Scheunenboden im Eifeler Bauernhaus. Lautgleich, aber mit anderer Bedeutung, ist die Dänn, unser Wort für die Tanne oder Fichte. Die Eifeler Schüerendenn (Scheunentenne) war etwa 8 x 5 Meter groß, die Abmessung war naturgemäß von der Gebäudegröße abhängig. In jedem Fall konnte auf der Fläche ein beladener Heu- oder Erntewagen abgestellt werden. Das wurde gelegentlich bei einem drohenden Gewitter erforderlich: Die Ernteladung mußte schnellstens önner Daach (unter Dach, ins Trockene) gebracht werden. Der Tennenboden bestand in der Regel aus festgestampftem Lehm. Der nämlich erwies sich beim Dreschen des Getreides von Hand mit dem Flegel wegen seiner „Elastizität“ gegenüber etwa dem Beton als vorteilhaft: Die Körner wurden nicht so umfangreich beschädigt. Die Fläche war allerdings längst nicht so eben und leicht zu reinigen wie der Betonboden. An den beiden Längsseiten der Denn befanden sich in der Regel der Heustall (Heuboden) und die Waisch (Lagerraum für Getreide, der Boden der Waisch lag unter dem Niveau der Tenne). Der Tennenraum war um die fünf Meter hoch, die Decke bestand aus einer Balkenlage, Steijer (Steiger) genannt, zu dem seitwärts eine Sprossenleiter hinaufführte. Der Steijer bot bis unters Dach zusätzlichen Lagerraum, meistens wurde hier das ausgedroschene Stroh aufbewahrt. In der hinteren Tennenwand gab es die Schurp, eine schießschartenartige schmale Öffnung zum Durchführen der Deichsel bei abgestelltem Erntewagen. Durch eine solche Schurp mussten wir drei „Flegel“ einmal flüchten, was wegen der Bauweise des Durchlasses nur „hochkant“ und damit äußerst schwierig war. In unseren Taschen befanden sich ein paar zufällig „gefundene“ Eier, denen bekam der lichte Raum der Schurp nicht so besonders gut. Das Abenteuer auf jener Denn bleibt unvergessen
denoovend
„Abend“ heißt in Dörfer Dialekt Oovend, denoovend ist eine Zeitbestimmung und bedeutet „diesen Abend, heute Abend,“ regional ist auch höck Oovend gebräuchlich. Die holländischen Nachbarn sagen „vanavond,“ die Wortverwandschaft ist unverkennbar. Denoovend war für uns Pänz gelegentlich mit einer dumpfen Drohung verbunden, sofern wir nämlich wieder einmal etwas aanjestallt (angestellt) hatten: Waat nur, bos Pap denoovend kött (Warte nur, bis Vater heute Abend kommt), lautete Mutters düstere Ankündigung drohenden Unheils. Pap war aber glücklicherweise meistens müde von der Arbeit und nicht dazu aufgelegt, sich mit unseren kindlichen Schandtaten herumzuärgern. Bedrohlich war die Situation nur dann, wenn wir etwas tatsächlich Schlimmes angestellt hatten. Ein ganz spezielles Denoovend bleibt unvergessen, wenngleich ich das Datum nicht mehr weiß, es war vermutlich in 1947. Wir hatten – unserer drei – in der Schule etwas wirklich Fieses angestellt und wurden von Josef Gottschalk vor versammelter Mannschaft fürchterlich verdroschen. Nach der Besichtigung meines blau und schwarz angelaufenen Hinterteils, machte sich Mam auf den Weg zum Liehrer, kam zurück und verkündete mit drohendem Blick: Waat nur bos denoovend…
Destelsmetz
Mit diesem Mundartwort weiß heute kaum noch einer etwas anzufangen. Es bedeutet Distelmesser, war früher im kleinbäuerlichen Alltag ein gängiger Begriff, wird heutzutage längst nicht mehr gebraucht und ist damit „out,“ zumal seine Anwendung beim heutigen Großbetrieb auch praktisch undenkbar wäre. Wenn früher beim Eifelbauern Schwitt oder Minka (Tiernamen) mal wieder einem Kälbchen das Leben geschenkt hatten, wurden sie mit besonderen Futterrationen belohnt: Junge Disteln, so unwahrscheinlich das auch aussehen mag. Bevorzugte Erntezeit ist ganz früh im Frühjahr, wenn im noch grauen Wintergras die Wiesendisteln in Massen hervor brechen. Zu diesem Zeitpunkt waren die an sich verhassten Stachelträger beim Kleinbauern willkommen: In kochendem Wasser abgebrüht, verloren die Pflanzen ihre Wehrhaftigkeit und wurden zur wertvollen „Sonderzulage“ für das durch die Geburt entkräftete Tier. Ich selber bin viele Male durchs Lohr (Wiesental bei unserem Haus) gezogen, mit Eimer und Destelsmetz bewaffnet. Destele steiche (Disteln stechen) war meistens eine Aufgabe für uns Kinder, das Werkzeug hierbei war ein breites, spitz zugeschliffenes rostiges altes Bruëtmetz (Brotmesser), mit dem die Disteln wenige Zentimeter tief in der Erde ausgestochen und herausgehoben wurden: Destelsmetz. Angesichts von Datenschutz und Postgeheimnis heute absolut undenkbar, damals Alltäglichkeit: Nach der Schule brachte ich unsere Post und auch die unseres Nachbarn mit, weil es an Kaue (Nachbarhaus) keine Schulkinder gab. Einmal stellte ich dem Nachbarn die Post während des Distelstechens zu. Dabei fiel mich Stropp, der allgemein als „giftig“ gefürchtete große Hund, aus dem Hof heraus an, die gefährlichen Zähne schnappten nach meiner Hüfte. Dort stak das alte Destelsmetz in der Tasche, die spitze Klinge fuhr schmerzhaft in den Raubtierrachen. Wenn Stropp mir später begegnete, schlich er mit eingeklemmtem Schwanz davon, er hat mich nie mehr angefallen.
Dier
Do könnste äwwer et ärm Dier kreje! (Da könnte man aber trübsinnig werden) – eine von zahllosen Redewendungen, in denen das Tier als Vergleichsobjekt oder zur Beschreibung einer Situation herangezogen wird. Beim ärm Dier spielen weder die Gattung noch das Geschlecht eine Rolle, im Gegensatz etwa zu jeftich wie en Spenn (giftig wie eine Spinne) oder schlaue Fuss (schlauer Fuchs). Eine hochgestellte Persönlichkeit ist e huh Dier (ein hohes Tier), ein zuverlässiger Mensch ist e treu Dier (treues Tier) oder mehr noch ene treue Flüppes, und ein liebes kleines Mädchen ist e lecker Dierche. Ein grobschlächtiger Mensch ist e Ondier (Untier) und die Heulsuse ist e Tränedier. Ein Dier besonderer, fast einmaliger Art gibt es in Blankenheimerdorf: Das Kirmesdier. Dieses „Tier“ gehört, neben Höit Jong, Pott und Fähnrich, zum jährlich neu zu wählenden Vorstand im Kirmesreih und ist der Träger der Kirmesknauch (des Kirmesknochens), der bei den Umzügen das Kirmessymbol dem Zug voran trägt. Die Knauch war ursprünglich ein Pferdekopf als Sinnbild ausgelassener Freiheit und Fröhlichkeit, heute ist es eine Rinderkopfplatte mit möglichst mächtigen Hörnern.
Dier jare
Wörtlich: „Tier jagen,“ ein uralter Eifeler Brauch, eine Art Selbstjustiz bei Vergehen gegen die ungeschriebenen Gesetze der Dorfgemeinschaft. Wenn beispielsweise der auswärtige Freier den Dorfburschen das Ströppe (Freikauf der Braut) verweigerte, wenn ein Brautpaar die Hielich (Polterabend) ablehnte, oder wenn ein Kniesuhr (Geizhals) keine Maieier herausrückte, dann wurde am Abend danach et Dier jejaach. Anlass zur Selbstjustiz konnte aber auch sehr wohl ein Ehekrach oder eine Beleidigung sein. Vor dem Haus des Übeltäters wurde mit einer schweren Well (eiserne Ackerwalze) und viel Geschrei ein Heidenlärm veranstaltet. Oft wurde das Heck eines Ackerwagens hochgebockt, mittels einer „Drehkette“ eins der Räder in Schwung gebracht und ein altes Sensenblatt auf den eisernen Radreifen gedrückt. Das ergab einen geradezu infernalischen Lärm. In den Lärmpausen wurden lauthals die Schandtaten des Übeltäters verkündet und Spottverse vorgetragen. Nicht selten kam es beim Dier jare zu Tätlichkeiten, in Blankenheimerdorf wurden beispielsweise in den 1950er Jahren einmal die Glasscheiben des Windfangs an einer Haustür zertrümmert, Vater hatte einen ganzen Tag mit der Reparatur der Rütte (kleine Fensterscheiben) zu tun. Der Brauch ist wegen derartiger Ausschreitungen längst verboten, im Dörf wurde zum letzten Mal Anfang der 1960er Jahre im Ortsteil Kippelberg et Dier jejaach. Vergleichbar mit unserem Dier jare war die in Rheinland-Pfalz übliche „Eselshochzeit.“ Eine solche Aktion in der kleinen Ortschaft Hütten (Kreis Bitburg - Prüm) im Jahr 1958 wuchs sich zu einer Staatsaktion aus, weil sie vom Landgericht Trier als „ehrverletzend“ und damit nicht rechtens erklärt worden war. Gut 15.000 neugierige Gaffer kamen damals aus Nah und Fern nach Hütten, auch bei uns ging die „Eselshochzeit von Hütten“ durch die Tagespresse. Angeblich hat damals der auswärtige Freier den Hüttener Burschen 150 DM Freikauf angeboten, in 1958 ein schönes Stück Geld. Er sei aber mit der Begründung „zu wenig“ abgewiesen worden, so hieß es. Wenig später, Anfang der 1960er Jahre, kam ich selber bei den Burschen in unserem Nachbarort Mülheim mit zwei Kasten Bitburger als Freikauf und damit sehr viel preiswerter davon.
Dießel
Den Dießel kennt man heute in der Landwirtschaft kaum noch, weil die Tiergespanne durch den Ackerschlepper abgelöst wurden. Der Dießel war früher der Deichselbaum, kurz Deichsel genannt, der mit den Zugtieren verbunden wurde und die Lenkung des Wagens steuerte. Die häufige Geschlechtsumwandlung in der Mundart zeigt sich auch hier wieder: Die Deichsel = Der Dießel. Diese „Männlichkeit“ ist aber sehr wohl verständlich, Dießel nämlich ist vom holländischen Wort „Dissel“ („Disselboom“) hergeleitet und dieses Wort ist „mannelijk“ (männlichen Geschlechts). Der Dießel am Eifeler Ackerwagen konnte hochgestellt werden. Das war erforderlich, um einen beladenen Heu- oder Getreidewagen vollständig auf der Scheunentenne abstellen zu können. Der Eifeler Denn (Der Denn = Die Tenne) war so bemessen, dass gerade mal ein beladener Wagen hinein passte. Vielfach gab es in der rückwärtigen Scheunenwand die Schurp, eine schießschartenartige Öffnung, durch die der Dießel gesteckt werden konnte.
Dilldopp
Ein im gesamten Rheinland bekanntes Wort für „Kreisel“. Der Dilldopp war noch bis in die Nachkriegszeit ein beliebtes Spielzeug. „Dill“ heißt soviel wie „sich schnell drehen“ und „Dopp“ ist die Bezeichnung für einen spitz zulaufenden Gegenstand, einen Kegel. Der echte Dilldopp unserer Kinderzeit war aus Buchenholz und besaß an der Spitze einen blanken Nagelkopf als Lauffläche. Die ursprüngliche Lackfarbe war durch häufigen Gebrauch nur noch ansatzweise vorhanden. Der Kreisel wurde mit der selbstgefertigten Dilldoppschmeck (Peitsche, weiches e) in Gang gehalten. Manchmal verhedderte sich die Peitschenschnur, der Dilldopp kam aus der Bahn und donnerte schmerzhaft gegen das Schienbein des Spielkameraden oder im schlimmsten Fall durch die nächste Fensterscheibe. Das zog dann Ärger nach sich. Fürs Dilldoppschmecke war naturgemäß eine möglichst glatte Bodenfläche erforderlich. Das Jebönn (Fußboden) in der Stube war wegen der Möbel und Fenster indiskutabel, die Straße war unbefestigt und knubbelich (holperig) und kam auch nicht in Frage. Es blieb somit meist nur die Scheunentenne, die zuvor gründlich gekehrt werden musste. Manchmal geriet der Dilldopp auf den Heuboden und war dann beinahe do schwer wieder auffindbar wie die berühmte Nadel im Heuhaufen.
Dobbel (kurzes weiches o)
Während in der Standardsprache das Doppel ein bekannter Begriff aus dem Sportbereich darstellt, ist unser Dobbel mehr oder weniger eine Eifel-spezifische Definition: Die Dobbel als Bezeichnung für ein aus zwei Scheiben bestehendes Butterbrot, ein „Doppelbrot“ also oder eine „Doppelschnitte. Zwei Schnedde dobbel jeschlohn, dat os en Dobbel (Zwei Schnitten doppelt geschlagen…), würden wir im Dörf das Wort Dobbel erklären. Als Verpflegung beim Viehhüten gab uns Mam (Mutter) eine Dobbel mit auf den Weg. Das waren zwei Brotschnitten, dick mit Butter bestrichen, mit Schonk (Schinken) belegt und aufeinander geklappt. Den Belag verzehrten wir pur, die Schnitten wurden auf einer Astgabel am Weidefeuer geröstet, die geschmolzene Butter machte unsere „Toastschnitten“ zur echten Köstlichkeit. Im südlichen Teil der Gemeinde Blankenheim hieß und heißt eine Doppelschnitte Dubbel, das holländische Wort für „doppelt“ ist „dubbel“ (gesprochen „dübbel“), die Wortverwandtschaft ist unverkennbar. Als Kinder hatten wir praktisch ständig Hunger, auch mitten im spannenden Sööke spelle (Suchen spielen = Versteckspiel). Dann holten wir uns bei Jött en Dobbel op de Fuuß (Ein Butterbrot auf die Faust) und weiter ging das Spiel.
Dölek
Dölek ist eins der zahlreichen Mundartworte für den Begriff „Rauch,“ wir kennen beispielsweise Dämp, Damp, Schwalek, Rouch, Qualem, Broodem, Röüch. Der Dölek ist vorwiegend das Wort für besonders dichten und geruchsträchtigen Rauch, der unter anderem beim Verbrennen von Grünzeug entsteht. Frische Fichtenzweige erzeugen einen intensiven und sogar wohlriechenden Rauch, der mir früher als Orientierungshilfe diente, wenn ich Ohm Mattes das Mittche (Henkelmann) mit dem Mittagessen in den Wald zu bringen hatte. Den Dännedölek (Fichtenqualm) roch ich schon aus mehreren hundert Metern Entfernung. Feuchtes Heu, das wegen anhaltenden Regens om Hoppe verdorve (auf dem Haufen verdorben) und unbrauchbar geworden war, wurde verbrannt und verbreitete einen fürchterlich stinkenden gelb-grauen Dölek. Wenn auf der Dampflok der Heizer die Feuerung mit frischen Kohlen beschickte, entstieg dem Schornstein ein mächtiger schwarzer Dölek. Aus der Messdienerzeit ist noch der Dölek in Erinnerung, der dem Rauchfass entströmte, und das selbst gebastelte Röuchdöppe der Hütebuben erzeugte beim Rundschwenken prächtige Dölekreng (Qualmringe) in der Luft. Beim raucharmen Feuer sprach man in der Regel eher von Qualem oder Dämp.
Dollschlaach
Ein auch heute noch gängiges Wort für einen Menschen, der lauter lustiges Zeug im Kopf hat, dem sozusagen „der Schalk im Nacken sitzt.“ Die wörtliche Übersetzung lautet „Tollschlag.“ Der Dollschlaach ist ein „lustiger Vogel“, ein Schelm, der geradezu vor Witz und Übermut sprüht. Er ist wegen seines ständigen und unverwüstlichen Humors bei den Leuten im Dorf beliebt. Auch wenn er gelegentlich mit versteckter Ironie seine Meinung sagt, kann ihm keiner böse sein. Ein echter Dollschlaach und angenehmer Mitmensch war mein im August 1988 im Alter von nur 51 Jahren verstorbener lieber Freund und Nachbar Heinrich Klaßen, im Dorf allgemein nach seinem Elternhaus Austengs Hein genannt. Er war der geborene Karnevalist, wenn er die Bühne betrat, tobte der Saal. Ein Zeichen für seine Beliebtheit auch bei seinen Arbeitskollegen: Im Sommer 1987 wurde Hein 50 Jahre alt und feierte seinen runden Geburtstag zusammen mit seiner Silberhochzeit und seinem 25-jährigen Arbeitsjubiläum bei der Schmidtheimer Baufirma Theo Lenz (vormals Hermann Thur). Nach Feierabend erschien die gesamte Firma, mit der kompletten Belegschaft und sämtlichen mobilen Baumaschinen und Fahrzeugen beim Geburtstagskind, blockierte den halben Kippelberg, kümmerte sich absolut nicht um eventuelle Proteste und feierte mit „ihrem“ Hein bis in die Nacht. Ein ebensolcher Dollschlaach und eingefleischter Karnevalist ist Walter Schmitz, der bei seinen Speditionsfahrten die halbe Welt und ganz Europa bereist. Schmitze Walter war ebenfalls in der Dörfer Karnevalsbütt zu Hause und hat jahrelang die Sitzungen geleitet. Walter hat längere Zeit bei Hein in der Woltersgasse gewohnt. Zwei Dollschlääch unter einem Dach, direkt gegenüber im Nachbarhaus, - da blieb kein Auge trocken. Da war jät loss (etwas los) auf dem Kippelberg, es war die „Blütezeit“ unseres Ortsteils.
nach oben
zurück
Donge (weiches o)
Der Ausdruck ist so gut wie ausgestorben und nur noch ganz wenigen Dorfsenioren geläufig: Donge war früher das Dörfer Wort für „Ding“ in allen seinen Anwendungen. Inzwischen ist es weitgehend dem modernen Deng (weiches e) oder allenfalls noch Denge gewichen. Wie im Hochdeutschen, so gibt es auch im Dialekt eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Alles Unbekannte ist beispielsweise ein Donge, was gelegentlich zum Schmunzeln verleitet. Da war beispielsweise am Stammtisch von „Television“ die Rede und Nikla (Klaus) fragte treuherzig: Wat os dat dann für e Donge. Angesichts von etwas Ungewöhnlichem oder Unfassbarem äußerte man sein Erschrecken oder Erstaunen: Jung dat os äwwer e Donge (Das ist aber ein Ding). Wenn man sich in einer Angelegenheit keinen Rat wusste oder wenn es mehrere Lösungsmöglichkeiten gab, war die gängige Redewendung Dat os e Donge wie en Heische (Das ist ein Ding wie ein Handschuh). Wer sich veräppelt (auf den Arm genommen) fühlte, drohte dem Kontrahenten: Maach die Donger net mot mir (Mach nicht solche Sachen mit mir). Bei einer Erkältung musste der Patient e paar Daach em Donge blieve (ein paar Tage im Haus bleiben) und sich auskurieren. Und nach einem Gebäudebrand wünschte man dem Geschädigten: Hoffentlich hattste dat Donge och joot versichert.
dönn
Ein findiger Witzbold definierte seinerzeit den Eisenbahnbegriff „Weiche“ mit „Eine Weiche ist keine Harte.“ Sein Kommentar zu dönn würde vermutlich lauten: Dönn os net deck. Wortverbindungen mit dönn sind in der Regel negativer Natur, Beispiele: Dönnbier, Dönnbejn (Dünnbein), Dönnflitsch (Durchfall). Letzteres wird häufig auch einfach als dr Dönn (der Dünne) bezeichnet. Um das Eigenschaftswort dönn rankt sich eine Vielzahl von Redewendungen. Dem jeht et dönn durch de Reppe (…Rippen) behaupten wir von einem wenig „betuchten“ Mitmenschen. Von echten Freunden weiß man, dass sie dönn jesät sind. Wer sich in schwieriger Situation klammheimlich verdrückt, der hat sech dönn jemääch (sich dünn gemacht). Einen mageren Menschen beschreibt man mit dönn wie en Bonnestang (Bohnenstange) oder auch dönn wie ene Piefestäucher (Pfeifenstocher). Zwei treue Freunde gehen gemeinsam dürch Deck on Dönn, und als Ausdruck der Verachtung gilt Du Dönndärm (Dünndarm). Aus neuerer Zeit stammt folgende Beschreibung: Dä os esu dönn, dä kann en Armbanduhr als Jüëd drare. Der Mensch ist also derart dünn, dass er eine Armbanduhr als Gürtel tragen kann. Und schließlich: Ein Kollege, den ich geärgert hatte, wünschte mir dr jlöhende Dönndreß aan dr Hals. Wehe meinem Hals! Gott sei Dank ging der seltene Wunsch nicht in Erfüllung
Dopp
Ganz allgemein ist der Dopp ein spitz zulaufender Gegenstand mit relativ breiter kreisförmiger Grundfläche, ein Kegel. Der bekannteste Dopp ist der Dilldopp (Kreisel), ein früher beliebtes einfaches Spielzeug, das mit einer kleinen Peitsche jeschmeck (gepeitscht = in Gang gehalten) wurde (siehe: Dilldopp). In Anlehnung an die flinken Bewegungen des Kreisels, gab es eine Redewendung für eine gut von der Hand gehende Arbeit: Dat jeht wie e Döppche. Im Eifeler Alltag gab es unterdessen noch einen weiteren Dopp: Wenn Mutti Klein-Albertchen vom „Töpfchen“ hob, stellte sie zufrieden fest: Dä Jong hät e Döppche fabriziert und das war immer ein gutes Zeichen. Wir Kinder mussten üblicherweise vor dem Zubettgehen noch unser Bedürfnis erledigen und Mam (Mutter) befahl: Nu jö, dr Dopp jeschmeck on dann de Trapp erop. Aber auch die Erwachsenen selber bedienten sich dieser Redensart. Bei der Waldarbeit beispielsweise lehnte Fränz sein Schällmetz (Schäleisen zum Entrinden) an den nächsten Baum, meinte zu seinem Spannmann: Ech moß ens ene Dopp schmecke john und verschwand im Gebüsch. Eine gleichartige Bezeichnung für Dopp schmecke in diesem Zusammenhang war Ei läje (Ei legen).
Döppe (weiches ö)
Unsere Mundart kennt gelegentlich mehrere Bezeichnungen für ein und denselben Gegenstand, unter anderem Döppe und Pott für den hochdeutschen „Topf“ in all seinen Variationen. Der Kochtopf beispielsweise ist unser Kauchdöppe, heißt aber ebenso Kauchpott. Der große Keramiktopf, in dem unser Suërekappes (Sauerkraut) angesetzt wurde, war et Stejndöppe oder dr Stejnpott (Steintopf), ein drittes Wort war Enmaachsdöppe (Einmachtopf). Es gibt aber auch spezielle Namen: Die Kaffeekanne heißt Kaffepott, die Bezeichnung Kaffedöppe wäre geradezu unmöglich. Der gute alte Nachttopf war der Kamerpott, etwas hintergründig auch Brölldöppe (Brülltopf) genannt, oder ganz einfach et Döppe. Wer beispielsweise nachts aus dem Bett musste, der moot op et Döppe (musste auf den Topf). Lissje hatte lange mit der Nachbarin getratscht und plötzlich fiel ihr ein: Oje, ech han noch nix em Döppe (ich muß noch kochen). Döppe war auch ein Wort für den Kinderpopo. Karlchen wurde ermahnt, endlich still zu sein oder et jitt jät op et Döppe (es gibt was hinten drauf). Döppe war schließlich auch eine meist gutmütige Zurechtweisung. Unser Musiklehrer am Gymnasium Steinfeld, der hünenhafte Pater Lothar Buchholz, quittierte zum Beispiel eine falsche Schülerantwort unwillig mit Du Düppen.
Dörf
Während in der Nord- und Westeifel allgemein Dörp als Dialektwort für „Dorf“ üblich ist, macht die Oberahr mit Dörf eine Ausnahme von dieser Regel. Et Dörf (das Dorf) ist sogar ein fester Begriff: Die allgemein übliche Abkürzung für „Blankenheimerdorf.“ In der alltäglichen Umgangssprache ist die fünfsilbige Ortsbezeichnung viel zu umständlich, auch das hiervon abgeleitete viersilbige Blangemerdörf ist noch zu aufwendig. Das fanden auch unsere Vorfahren und führten bereits vor Urzeiten et Dörf als gängigen Ortsnamen ein. Viele Nonnenbacher beispielsweise gingen sonntags nohm Dörf en de Kirch, und nach dem Tod von Ohm Mattes mussten meine Eltern en et Dörf ömzeeje (nach Blankenheimerdorf umziehen). Der Spitzname für die Bewohner von Blankenheimerdorf war Dörfer Wendböggele (Windbeutel, im örtlichen Dialekt „Wondböggele“). Et Dörf war die Letzte von 17 Ortschaften, die bei der kommunalen Neugliederung 1969/70 der Großgemeinde Blankenheim beitrat. Die Dörfer unter Bürgermeister Johann Schang Leyendecker wehrten sich bis zum Gehtnichtmehr: Ihre Ortschaft war selbständig, stand auf solider finanzieller Grundlage, kannte den Kommunalen Ausgleichsstock nur vom Hörensagen und war absolut ohne fremde Hilfe existenzfähig. Ihren Beitritt zur Großgemeinde machten die Dörfer von der Versicherung abhängig, dass der geplante neue Sportplatz realisiert werde.
Döüf
Unser Wort für „Taufe,“ das Tätigkeitswort ist döüfe (taufen). Unsere Eltern legten Wert auf eine möglichst baldige Taufe des Kindes nach der Geburt, ein Grundsatz, den auch der Pfarrer wärmstens befürwortete. Ich selber bin in der zweiten Januarhälfte in Schlemmershof geboren, es muss dickster Winter gewesen sein. Aus den Erzählungen meiner Eltern weiß ich, dass bei meiner Döüf meterhoher Schnee lag. Sie haben mich mit einem schweren Gespannschlitten nach Blankenheimerdorf gefahren, dreieinhalb Kilometer im Schneegestöber, bei zugewehter Fahrbahn. Der Schlitten war praktisch ein Ackerwagen, dessen Räder durch breite Holzkufen ersetzt waren. Mit solchen Fahrzeugen holten die Leute früher ihr Brennholz aus dem Wald. Die Taufe ist in unserer Eifel allenthalben ein wichtiger Bestandteil der Kirmes: Das Hüserdöüfe (Häusertaufen), in dessen Verlauf die Neubauten des vergangenen Jahres jedöüf (getauft) werden und einen Namen bekommen. Das Häusertaufen ist immer eine unverzichtbare feuchtfröhliche Angelegenheit. Feuchtfröhlich geht es auch in Blankenheim zu, wenn der Karnevalsverein an der Ahrquelle die Neubürger mit Ahrwasser „tauft.“
döüje
Ein Alltagsausdruck, der bei den verschiedensten Anlässen zur Anwendung kommt: Drücken, drängeln, schieben, stoßen, pressen, quetschen. Ein klassisches Beispiel ist die Redewendung dr Naache döüje (wörtlich = den Nachen schieben, siehe „Naache“) als Alternative zum bekannten Götz-Zitat. En de Fongere döüje (In die Finger drücken)ist eine Umschreibung für das Aufschwatzen einer minderwertigen Ware. En de Hand döüje bezeichnen wir dagegen das Trinkgeld für den Friseurgesellen oder den Postboten. Jemandem etwas önner de Wess döüje (unter die Weste schieben) bedeutet „einen Bären aufbinden.“ Wer eine Sache nicht sofort begreift, der muss mot dr Nas drop jedout (mit dr Nase drauf gestoßen) werden. Wenn beim Heueinfahren die Sonne vom Himmel brannte und der Schweiß in Strömen floss, stöhnte die Erntemannschaft: Dr Steere döüjt äwwer noch ens wie jeck (Der Stern drückt wieder mal enorm). Jemandem unter dem Siegel der Verschwiegenheit etwas mitteilen heißt ejnem jät döüje (jemandem etwas stecken, verraten). Das Substantiv von döüje ist der Döü, verhochdeutscht gelegentlich „Däu“ in der Bedeutung von „Anlauf nehmen, Anstoß geben.“ Dem Langschläfer wurde beispielsweise nahe gelegt: Jeff dir enen Döü on stand endlich op (Gib dir einen Ruck und steh endlich auf). Die Schub- oder Schiebkarre, bei uns Schupkaar genannt, heißt regional Döükaar.
draan
Ein Allerweltswort mit der gleichen Bedeutung wie das hochdeutsche „dran“ in seinen zahllosen Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Betonung oder Wortverbindung ändert sich die Bedeutung des Umstandswörtchens. So bedeutet beispielsweise jevv dech draan (gib dich dran) soviel wie „fang an,“ jevv et draan (gib es dran) dagegen heißt „hör auf.“ Draanjoohn (drangehen) ist das Mundartwort für „stibitzen, naschen.“ Mattes warnte vorsorglich den Nachbarsjungen: Jank bloß net aan meng Äppel, wenn ech dech dobij erwische, dann boste draan (Geh nur nicht an meine Äpfel, wenn ich dabei erwische, dann bist du dran). Boste draan bedeutet in diesem Fall „fällig, reif“ (für eine Tracht Prügel). Ech sen höck jarnet esu richtich draan bringt zu Ausdruck, dass man sich nicht wohlfühlt, und mot dem wejß mr net wo mr draan os besagt, dass dieser Mensch „mit Vorsicht zu genießen“ ist. Dat os e joot-draan Mensch ist eine Eifeler Umschreibung für eine „gute Partie“ und draan jlöüve mosse bedeutet schlicht und einfach „sterben.“ Aan dat Loder os nix draan ze kreje ärgert sich der Bauer über seine magere Kuh, und dä han ech äwwer joot draankrijje (übers Ohr gehauen) bedauerte er später insgeheim den Käufer, dem er das magere Tier zu einem annehmbaren Preis aanjedräht (angedreht, aufgeschwatzt, untergejubelt) hatte.
Dräjer
In unseren Eifeldörfern ist es auch heute noch Brauch und Sitte, dass bei einer Beerdigung die Männer aus der Nachbarschaft den Verstorbenen „zu Grabe tragen.“ Dabei werden meistens sechs (sonst vier) Dräjer (Träger) benötigt, die Übernahme dieser Aufgabe ist Ehrensache. Von Drare (Tragen) kann heute eigentlich keine Rede mehr sein: Der Sargwagen wird von der Leichenhalle bis ans Grab gefahren. Noch nach dem Krieg wurde der Verstorbene daheim aufgebahrt, der Sarg wurde dort zur Beerdigung abgeholt und im Sinne des Wortes zum Friedhof jedrohn (getragen). Das war für die Dräjer je nach Entfernung oft ein hartes Stück Arbeit. Auf dem Weg zum Friedhof standen etwa alle 60 bis 80 Meter zwei Stühle auf der Straße, auf die der Sarg abgestellt wurde, damit die Dräjer die Seiten wechseln und die schmerzenden Arme entlasten konnten. Früher mussten die Dräjer auch den Sarg mittels starker Seile ins Grab hinab senken, ich selber habe das einmal in Nettersheim bei der Beerdigung eines Bahnkollegen mit gemacht. Dieser Brauch ist vereinzelt auch heute noch anzutreffen. Beim abschließenden Bejräfniskaffee (Leichenschmaus) im Dorfgasthaus, wurde und wird ein besonderer Dräjerdesch (Trägertisch) reserviert.
Dränk
Im Eifeldorf oder am Ortsrand gab es früher die Dränk (Tränke), häufig auch Veehdränk (Viehtränke) genannt, die der Versorgung der Stalltiere mit Trinkwasser diente. Im Ort war das in der Regel ein großer Trog, der aus irgend einem Bächlein gespeist wurde. Der Pötz (Pütz = Brunnen) in Nonnenbach beispielsweise bezog sein Wasser in natürlichem Gefälle von der Quelle im „Schenkelchen“ (Bereich nahe der früheren Schule). Die Dränk am Ortsrand war meistens eine geeignete Stelle im Bach. Bei uns daheim wurde die seichte Furt im Nonnenbach als Dränk genutzt. Zweimal täglich zu gewohnter Stunde wurden unsere Tiere im Stall losgebunden und mit der Aufforderung Nu jö, aan de Baach (Auf geht´s, zum Bach) auf den Weg geschickt. Problemlos trabten dann die Kühe unbeaufsichtigt zur 100 Meter entfernten Dränk, tranken sich satt und kamen wieder in ihren Stall zurück. Das funktionierte selbst im dicksten Winter. Da es bei uns keine Wasserleitung gab, war die „Selbstversorgung“ der Tiere unabdingbar und ersparte den Leuten das tägliche Heranschleppen größerer Wassermengen. In vielen Ortschaften, beispielsweise in Ripsdorf, erinnert noch die „Tränkgasse“ an frühere Zeiten. Dränk ist nicht zuletzt ein Scherzwort für die Theke im Gasthaus.
Dreckbüësch
Was im modernen Haushalt als Schuhputzset gebräuchlich ist, das war zur Zeit unserer Eltern der Schohkaaste (Schuhkasten), eine aus dünnen Brettchen selbst gezimmerte kleine Holzkiste zur Aufnahme der Schuhputzutensilien. Ein solches Utensil war die Dreckbüësch (Dreckbürste), die heute etwas vornehmer „Schmutzbürste“ genannt wird. Die Alltagsschuhe des Bauern trugen meist deutliche Spuren der Stall- und Feldarbeit, und dieser grobe Schmutz wurde mit der Dreckbüësch beseitigt. Das war in der Regel eine sehr rauhe Wuëzelsbüësch (Wurzelbürste), wie sie auch gelegentlich bei stark verschmutzter Wäsche zur Anwendung kam. Insbesondere bei Stallschmutz reichte die Bürste allein nicht aus, da musste noch mit Wasser nachgeholfen werden. Dann allerdings mussten die Schuhe op de Drüch (wörtlich = auf die Trocknung), bevor sie mit dem Schmeerbüëschelche (kleine spitze Schmier-, Auftragsbürste) bearbeitet werden konnten. Für die, in der Regel wenig verschmutzten empfindlichen Sonnesschoh (Sonntagsschuhe) gab es eine wesentlich weichere Dreckbüësch. Das war in der Regel eine zweite, für diesen Zweck reservierte Wichsbüësch (Glanzbürste).
Dreckschnöss (weiches ö)
Was in irgendeiner Weise mit „Dreck“ in Verbindung gebracht wird, hat naturgemäß einen negativen „Beigeschmack.“ Im vorliegenden Fall kommt mit Schnöss als abwertendes Wort für „Mund“ noch ein zweites Negativum hinzu, und daraus entstand dann ein sehr übles Schimpfwort. Dreckschnöss bedeutet „Dreckschnauze“ oder bösartig und gemein „Schandmaul.“ Während im Dörfer Platt seit eh und je Schnöss gebräuchlich ist, wird in den übrigen Blankenheimer Gemeindeorten meist der aus dem Kölner Dialekt entnommene Begriff Schnüss angewandt. „Halt dein ungewaschenes Maul“ ist im Hochdeutschen eine böse Zurechtweisung, bei uns heißt das Halt deng Dreckschnöss. Artverwandt, aber nicht so gnadenlos bösartig, ist die Schlabberschnöss. Damit bezeichnen wir in erster Linie einen Muulräppeler oder Schwaadlappe (Schwätzer, Plappermaul), der sich selber gern reden hört. Eine mit Dreckschnöss vergleichbare Bezeichnung für das Schandmaul ist Joff- oder Jeffschleuder (weiches o und e). Eine solche „Giftschleuder“ findet hauptsächlich bei weiblichen Schandmäulern Anwendung.
dreische
Ursprünglich unser Wort für das Ausdreschen von Getreide in Handarbeit mit dem Fläjel (Flegel). Mit dem Aufkommen der Dreischmaschin wurde es auch auf diese maschinelle Tätigkeit übertragen. Dreische findet sich heute nur noch halb versteckt im „Mähdrescher,“ dessen Arbeit wir mit mähdreschere definieren. De nääks Wuch wiëd jedreische kündigte bei uns Ohm Mattes das Arbeitsprogramm für die kommende Woche an. Flegeldreschen war eine Winterarbeit. Bei angemessener Witterung konnte das Scheunentor geöffnet und damit die Dreschtenne belüftet werden. Wenn an mehreren Stellen jedreische (gedroschen) wurde, hallte das Dorf wider vor lauter Flegelschlägen. Früher gab es Dreschmannschaften, die von Ort zu Ort zogen und für ein paar Groschen bei freier Kost und Unterkunft den Bauern die Kornstapel in der Scheune „niederdroschen.“ Fläjele (Flegeln, Flegeldreschen) machte durstig, die Bäuerin erschien in bestimmten Zeitabständen und kredenzte eine Runde „Flegelwasser.“ Dreische ist auch heute noch eine Umschreibung für „prügeln,“ übrigens auch im Hochdeutschen: „Der hat Dresche bezogen.“ Und aus dem Fußballsport kennen wir die Elfmetersituation Hä hollt sechs Meter Aanlouf on droosch dr Ball en et Tor.
Dreischkaaste
Dreschkasten, das landläufige Wort für die mechanische Dreschmaschine, deren äußere Erscheinung tatsächlich einem hohen rechteckigen Kasten glich. Bei uns im Dörf steht heute noch an der Einmündung der Buppersgasse in den Zollstock der Kasseschopp (Kassenschuppen), in dem die Raiffeisenkasse nach dem Krieg eine große Dreschanlage eingerichtet hatte, die natürlich nicht mehr existiert. Am Kasseschopp oder auch Am Dreischkaaste sind heute noch gängige Ortsbezeichnungen für die längst in Privatbesitz befindliche Halle. Wenn im Ähr (Erntemonat, August) die Bauern die hochbeladenen Erntewagen vom Feld heran karrten, war am Dreischkaaste bis spät in die Nacht Betrieb. Beim Dreschen wurde die Kaaf (Spreu) über ein dickes Rohr nach draußen zur Giebelseite der Halle geblasen, wo sich mit der Zeit ein mächtiger Kaafberg auftürmte. Ein Dreischkaaste im Miniformat war der „Stiftendrescher,“ der in jede Scheune hinein passte und den sich auch der weniger begüterte Bauersmann leisten konnte. Einen Stiftendrescher gab es bei unserem Nachbarn Peter Rütz, die Maschine wurde durch ein von zwei Ochsen gezogenes Göpelwerk angetrieben.
Driekönninge (weiches ö)
Dreikönigen, das Fest der Heiligen Drei Könige am 06. Januar, vielfach auch einfach Könningdaach genannt. Driekönninge zählt zu den „Lostagen“ und war früher ein Stichtag für mancherlei Bauernregeln, eine davon: „Dreikönigabend hell und klar, verspricht ein gutes Erntejahr.“ Der Volksmund weiß auch, dass ab Dreikönigen de Daach wier länge (die Tage wieder länger werden), und zwar täglich „um einen Hahnenschrei.“ Tatsächlich stellen wir mit fortschreitendem Januar ein längeres Hellbleiben fest. Der kürzeste Tag des Jahres ist bekanntlich der 21. Dezember. Driekönninge wurde daheim von uns Kindern herbeigesehnt: Wenn die drei Heiligen in der Nacht in unsere Weihnachtskrippe kamen, brachten sie stets einen frischen Schnöüsteller (Naschwerk) mit. Das war umso erfreulicher, als der Vorrat vom Fest meistens arg geschrumpft war. Könningdaach ist auch heute noch in vielen Familien Stichtag für den Abbau des Weihnachtsbaums, der um diese Zeit meistens auch schon deutlich nadelt. In unserer Stube daheim wurde nur wenig jestauch (geheizt), unser Christbaum „hielt sich“ länger als üblich, manchmal sogar bis Liëchtemoss (Maria Lichtmeß) am 02. Februar.
Drieschlaach
Drieschlaach, regional auch Drejschlaach, bedeutet „Dreischlag“ und ist ein Begriff aus der Zeit des Flegeldreschens auf der Schüerendenn (Scheunentenne). Je nach Anzahl der Drescher gab es den Zwei-, Drei-, Vier- oder sogar den Fünfschlag. Ein Drescher allein und damit der „Einschlag“ wurde nur im Notfall, etwa im Krieg, praktiziert, da hat beispielsweise meine Mutter stunden- und tagelang im Einschlag dreschen müssen. Ich war damals acht oder neun Jahre alt und musste beim Fläjele (Flegeldreschen) „helfen.“ Ich besaß einen eigenen kleinen Flegel. Der Fönnefschlaach (Fünfschlag) war nur bei ausreichendem Platz möglich: Die gängige Eifeler Tenne war so bemessen, dass gerade mal ein beladener Heu- oder Getreidewagen hinein passte. Auf diesem begrenzen Raum standen sich fünf Drescher sozusagen gegenseitig op de Ziëne (auf den Zehen) und mussten aufpassen, dass sie sich nicht die Köpfe einschlugen. Am gängigsten und auch am einfachsten zu handhaben war der Drieschlaach. Klapp-klapp-klapp, das ging im Dreivierteltakt, sozusagen im „Walzerschritt“ über die Garben, beim Dreischlagrhythmus wurden auch die Armmuskeln am wenigsten strapaziert.
Drießhüüsje
Das ist ein etwas derbes, nichtsdestoweniger aber alltägliches, kerniges und keineswegs beleidigendes Eifeler Wort für den früheren Abort, den wir heute vornehm mit „Toilette“ umschreiben. Drießhüüsje bedeutet wörtlich Scheißhäuschen, die Namensgebung ist auf die frühere Abortanlage in Gestalt des außerhalb des Hauses errichteten Herzhäuschens zurückzuführen. Du Drießhüüsje ist eine abwertende, aber nicht so besonders ernst zu nehmende Behauptung, die aber weniger als Beleidigung, vielmehr als humorig empfunden wird. Bei uns daheim stand das Häuschen im Garten, es war aus rohen, nicht gehobelten Brettern zusammengenagelt, durch deren breite Ritzen eiskalt der Winterwind pfiff und den „Inhalt“ hart gefrieren ließ. Als im März 1945 die Amerikaner Nonnenbach besetzten, war auch unser Drießhüüsje fast rund um die Uhr besetzt, in der Produktion organischer Abfälle waren Bill und Jimmy kaum zu schlagen. Schon am dritten Tag war die kleine Anlage randvoll und mußte durch einen metertiefen Freiluft-Donnergraben mit Apfelsinenkisten-Sitz ersetzt werden. Mattes (Matthias) hatte die Angewohnheit, nach dem Abendessen noch das Hüüsje im Garten aufzusuchen, dabei schlief er nicht selten ein. Einmal wachte er auf und konnte nicht mehr hinaus: Lausebengels hatten ein Seil um die gesamte Anlage gewickelt und die Tür versperrt. Noch gut in Erinnerung sind mir aus meiner Gymnasiumzeit die Dritter-Klasse-Wagen der Bundesbahn mit ihren winzigen Toilettenkabinen. Hier fiel das Abfallprodukt auf die unter dem „Abfluss“ vorbeiflitzenden Schwellenköpfe, - eine wirksame automatische Entsorgung. Und die Burgherren (und –Damen) erfreuten sich einer kostenlosen „Kühlung,“ wenn sie im Erker in luftiger Höhe an der Burgmauer zur „Entlastung“ schritten. Im Burggraben darunter durfte sich derweil allerdings niemand aufhalten.
Drinche (gedehntes i)
Das Wort war früher die Koseform von Drin und das wiederum war einer von mehreren Mundartausdrücken für „Katharina.“ Unserer Standardsprache angemessener wäre „Trin“ und „Trinchen,“ das aber entspricht nicht der Eifeler Sprechweise. Ich habe Mattes on Drinche (Matthias und Katharina) willkürlich als gelegentliche Vertreter unserer Eifelheimat im Dörfer Lexikon gewählt. Vor 40 Jahren lebte im Ortsteil Keppelberch in Blankenheimerdorf Katharina Bertram, ortsüblich Lenze Drin genannt. Sie war die geborene Karnevalistin und ein Ass als Büttenrednerin. In den Dörfer Karnevalssitzungen stieg sie als Katharina van Lenze auf die Bühne und begeisterte ihr Publikum mit urigen Mundartvorträgen. Ihren „Künstlernamen“ hatten ihr die „Gemötliche Dörfer“ (Karnevalsverein) in Anlehnung an die Schlagersängerin Catherina Valente verliehen. Ihre Söhne Helmut und Arthur waren in ihrer Jugend Tanzmajore in der Dörfer Funkengarde. Lenze Drin starb im Februar 1978, auch Helmut und Arthur sind nicht mehr unter uns.
drop on drwiër
Mit der hochdeutschen Übersetzung „drauf und dawider“ ist wenig anzufangen, mit dem wortverwandten Ausdruck „drauf und dran“ besteht kein Zusammenhang. In unserer Mundart dagegen ist drop on drwiër ein Ausdruck für „außerordentlich, nach Leibeskräften, ungehemmt, ungewöhnlich.“ Ein klassisches Beispiel ist die Redewendung et räänt drop on drwiër (es regnet ununterbrochen). Von einem Menschen, der ungewöhnlich intensiv arbeitet und sich abrackert, sagen wir dä ärbed drop on drwiër. Das Kleinkind schreit und plärrt ununterbrochen, auf Dörfer Platt sagt man in diesem Fall dä Balech schreit drop on drwiër. Wintertags musste der Kanonenofen drop on drwiër jestauch (ununterbrochen geheizt) werden, damit man sich en dr Stovv ophale (in der Stube aufhalten) konnte. Und wenn das Schlachtschwein trotz guter Fütterung bis zur Kirmes nicht fett geworden war, stellte der Besitzer grimmig fest: Ech han jefoodert drop on drwiër, mejnste äwwer, dat Loder hääf jät op de Reppe krijje! Etwas auf die Rippen kriegen, das war ein gängiger Ausdruck für die Zunahme an Körpergewicht.
drüch
Bei großer Sommerhitze trocknete das Heu entsprechend schnell und intensiv und der Bauersmann meinte ärgerlich: Dat Heu os esu drüch dat et stöpp (Das Heu ist so trocken, dass es staubt). „Trocken“ in all seinen Anwendungen ist im Dialekt drüch, das Zeitwort „trocknen“ heißt bei uns drüjje, das davon abgeleitete Substantiv ist de Drüch (Trocknung, Trockenheit) oder auch et Drüjje (das Trockene). Wer beispielsweise om Drüjje setz (auf dem Trockenen sitzt), der hat kein Geld mehr. Et Schööfje em Drüjje han bedeutet „sichergestellt, gesichert.“ Einen humorlosen und nüchternen Realisten nennt man drüjje Pitter (wörtlich = trockener Peter) und ein einsilbiger, langweiliger oder uninteressierter Mensch ist ein Drüchliëch (wörtlich = Trockenlicht). Den vorlauten Jugendlichen staucht der „erfahrene“ Erwachsene gelegentlich zurecht: Du jonge Lällbeck bos jo noch net drüch honner de Uhre (…noch nicht trocken hinter den Ohren). Und am Waschtag wurden die Wäschestücke für ze drüjje op de Drüch jehange bos se knauchendrüch wore (zum Trocknen ausgehängt bis sie knochentrocken waren) und die Hausfrau zufrieden feststellte: De Weisch hät schön jedrüch (Die Wäsche ist schön getrocknet).
Drützehn
Die Zahl 13 (Dreizehn) gilt ganz allgemein bei vielen abergläubischen Zeitgenossen als Unglückszahl und böses Vorzeichen. Es gibt Leute, die steigen am Drützehnte (Dreizehnten) eines Monats unter keinen Umständen in ihr Auto oder in einen Reisebus. Mancher Sportler wehrt sich mot Hänn on Fööß (Mit Händen und Füßen) gegen die Startnummer 13. Sehr drastisch tritt die „Dreizehnerangst“ in Erscheinung, wenn zufällig der Dreizehnte auch noch ein Freitag ist. Diese Angst hat sogar einen wissenschaftlichen Namen, wie ich bei „Google“ herausfand: Paraskavedekatriaphobie, ein wahrer Zungenbrecher. Der Freitag gilt bei den Christen seit jeher als Trauertag, weil Jesus an einem Freitag gekreuzigt wurde (Karfreitag). Bei uns daheim war früher der Friddech (Freitag) ein Abstinenztag: Es gab kein Fleisch zu essen, Zuwiderhandlungen waren zwar „lässliche Sünden“ (keine „Todsünden“), wir Kinder mussten sie aber dem Pastor beichten. Für mich selber scheint die Drützehn eher eine Glückszahl zu sein. Im Juli 1986 lag ich drei Wochen lang im Zimmer 213 der Chirurgie im Krankenhaus Mechernich, wurde dort zwar mannigfach „gepiesackt,“ wurde dort aber auch wieder gesund. Und am Freitag, dem 13. Dezember 1996, stellte ich im Waldcafé Maus in Nonnenbach mein Buch „So war´s bei uns“ vor, – Das Buch wurde ein Erfolg.
Duëdezeddel
Der Totenzettel, verschiedentlich auch Duëdebreefje (Totenbriefchen) genannt, ist heutzutage ein bei vielen Genealogen und Archivaren begehrtes Objekt der Familien- und Ahnenforschung. Je älter das Datum, desto wertvoller ist das Objekt. Noch zur Zeit unserer Eltern war bei einer Beerdigung im Dorf der Duëdezeddel nicht nur üblich, sondern beinahe Pflicht: Das Faltblatt im DIN-Format A6 enthielt die wichtigsten Daten aus dem Leben des Verstorbenen, und die wollten die Leute erfahren. Den Datenschutz gab es früher nicht, also auch keine Geheimhaltung. Im Gegenteil: Je mehr Daten der Zettel enthielt, desto wertvoller war er, auch für die Angehörigen, als Andenken an den Verstorbenen. Die Totenzettel der Soldaten enthielten meist ein Foto des Gefallenen. Dafür sorgte Dechant Hermann Lux, der in der Regel auch die Erstellung und Gestaltung übernahm und die Zettel in der Druckerei von Josef Kirstgen in Blankenheim herstellen ließ. Dechant Lux selber fertigte Fotos der Soldaten an, wenn sie auf Urlaub kamen, – seltsamerweise fehlt mein Vater in der Sammlung. Die Duëdezeddele (Mehrzahl) wurden, wie auch Heiligenbildchen und Gebetssprüche, ins Jebeddbooch gelegt, manch ein Gebetbuch enthielt beinahe mehr Zettelbeilagen als Seiten. Alte Gebetbücher aus Omas Zeiten sind eine wahre Fundgrube für Sammler.
Duëdsünd
Für uns Kinder war die Todsünde der Inbegriff alles Bösen, es gab gar nichts Schlimmeres als die Duëdsünd, wer eine solche auf dem Gewissen hatte und eines plötzlichen Todes starb, dem war die Hölle sicher. Das lernten wir bei Dechant Lux im Religionsunterricht, und unsere Eltern rieten uns dringend: En Duëdsünd moß mr esu schnell wie müjelich bichte (Eine Todsünde muß man möglichst schnell beichten). Das war freilich ein guter Rat, es steckte aber auch ein wenig Elternlist dahinter: Allgemein üblich war die Monatsbeichte, wenn nun der Filius plötzlich zwischendurch und sogar freiwillig von bichte john (wörtlich = beichten gehen) redete, war das ein Beweis für eine geheime Übeltat, der es nachzuspüren galt. Dabei wussten wir Pänz nicht einmal so genau, was eigentlich alles unter den Begriff Duëdsünd fiel. Mord, Raub, Brandstiftung selbstverständlich, aber damit kamen wir absolut nicht in Berührung. Kritischer war da schon das sechste Gebot, man betrachtete schon mal ein „unschamhaftes“ Bild, – und beichtete es vorsichtshalber, für alle Fälle, vielleicht war es ja eine Duëdsünd. Und der Pastor war über seine Schäflein im Bilde. Für uns war auch die Missachtung des Nüchternheitsgebotes vor dem Empfang der Kommunion eine Todsünde.
Duffes
Die Endsilbe „es“ (stimmloses e) ersetzt im Dialekt in manchen Fällen die Silbe „haus,“ ein paar Beispiele: Schlaachtes (Schlachthaus), Backes (Backhaus), Kauches (Kochhaus = Küche), Stauches (Stochhaus = Heizraum), Kruches („Kriechhaus“ = Hütte) oder auch das unfeine Wort Sekkes (weiches e) für die Toilette. Das Duffes ist somit das Taubenhaus oder der Duuveschlaach (Taubenschlag). Früher gab es in ländlichen Gegenden häufig private Taubenfreunde, die einen Taubenschlag nicht aus Zuchtgründen, vielmehr sozusagen „aus Liebhaberei“ (als Hobby) unterhielten. Unser Nachbar Schlemmesch Köbes (Jakob Schlemmer) beispielsweise hatte für seine Düüvjer (Täubchen) am Giebel der Scheune ein Duffes eingerichtet. Vor etlichen Jahren flog uns eine fremde Brieftaube zu, und weil wir sie fütterten, kam sie immer wieder. Ein Täuberich gesellte sich hinzu und bald bauten die Zwei auf einem Mauervorsprung eifrig an einem Nest. Ich zimmerte aus ein paar Spanplatten ein provisorisches Duffes, und nach einer gewissen Zeit starteten zwei Jungtauben ihre ersten Flugversuche vom Mauervorsprung herab. Eine von ihnen war schneeweiß eine „Paloma blanca“ sozusagen. Die Weiße fanden wir wenig später, offensichtlich von einer Katze oder einem Marder zerrissen. Die drei anderen waren eines Tages verschwunden, unser Duffes hatte ausgedient.
Düvelskall
In unserem Dialekt ist die Kall eine Röhre oder auch eine offene Rinne, beispielsweise die Daachkall (Dachrinne). Am „Wasserschenkel“ des Eifeler Fensters gab es früher die Wasserkall zum Auffangen und Ableiten des Schwitz- oder Eiswassers. Die Düvelskall (Teufelsrohr, Teufelsrinne) war und ist eine, inzwischen beinahe „versunkene“ Sandsteinhöhle im Waldbereich „Ripsdorfer Eichholz“ in der Nähe des Waldcafé Maus in Nonnenbach. En dr Urbaach (In der Urbach) heißt der Flurbereich im Volksmund. Zu meiner Kinderzeit war die Höhle etwa vier Meter tief und im vorderen Bereich so hoch, dass wie Pänz darin beinahe stehen konnten. Inzwischen ist sie nur noch ein meterhohes „Loch,“ eine „Grotte“ sozusagen. Es heißt, im Krieg hätten einige Nonnenbacher in der Düvelskall Unterschlupf vor den Bomben gesucht. Das mag im Einzelfall und für kurze Zeit der Fall gewesen sein, für einen längeren Aufenthalt und etwa auch noch für mehrere Personen war auch damals die Düvelskall viel zu klein. Wir Pänz liefen sonntags in die Urbaach, stochten ein Feuerchen in der Höhle und spielten „Robinson.“ Der Ursprung des Namens Düvelskall lässt sich nur vermuten: Der Sandsteinfelsen lag früher in einem, inzwischen längst abgeholzten finsteren und unheimlichen Fichtenhochwald, darin ein finsterer Felsen und in diesem eine finstere Höhle, - da konnten abergläubische Zeitgenossen gar leicht auf den Namen „Teufelsrohr“ verfallen. Ähnliches gilt für den „Römerkanal,“ der im Volksmund auch Düvelsooder (Teufelsader) heißt.
nach oben
zurück
|