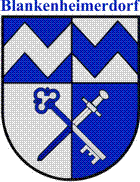|
Chreß (weiches e)
Abkürzung für den Eigennamen Christian. Artverwandt sind Chris und dessen Koseform Chrisi, die aber eigentlich für den Eigennamen Christoph verwendet werden. Christian und Christoph waren früher häufige Namen, heute sind sie weitgehend „aus der Mode“ geraten. Wenn früher, etwa zur Kirmes, viel Besuch im Haus war und damit die Schlafgelegenheiten knapp wurden, gab es eine Faustregel: Wenn et net annesch es, schläf de Maad bejm Chreß, die Magd wurde also zum Chreß ins Bett gesteckt, damit eine Schlafstelle frei wurde, - eine etwas ungewöhnliche Notlösung. Es gab einen bei Tanzveranstaltungen häufig gespielten Rheinländer in Kölner Mundart: Saad hat ihr minge Mann nit jesinn, dä Zillekovens Chreß? Dä hät sich durch de Kood jemaad, wejß kejner wo hä es? Zillekovens Christian hatte sich also davon gemacht und wurde gesucht. Chreß ist auch unser Wort für „Christ,“ ene laue Chreß beispielsweise ist ein Mensch, der es mit der Frömmigkeit nicht so besonders genau nimmt. Es gibt ein geflügeltes Wort: Je nooher aan Rom, desto lauer dr Chreß, und das bedeutet nach Ansicht spitzfindiger Zeitgenossen, dass man die besten Christen weitab von Rom antrifft.
Chreßboum
Gesprochen: Chreßbo-um. Der Christ- oder Weihnachtsbaum, unser Weihnachts-Festsymbol schlechthin. In meiner aktiven Dienstzeit gab es Kollegen, für die Weihnachten antiquierter Blödsinn war. Auf den Chreßboum verzichteten sie aber auf gar keinen Fall, und für den „gläubigen“ Kollegen die Spätschicht an Heiligabend übernehmen, dazu waren sie absolut nicht bereit. Warum nicht, wo ihnen Weihnachten doch nichts bedeutete? Nur der geklaute Chreßboum sei ein guter Christbaum, lautete früher ein Standpunkt, der auch heute noch nicht ganz vergessen ist. Der Grund war eigentlich plausibel: Der Baum wurde erst an Heiligabend geklaut (im Wald stibitzt) und war somit frisch und langlebig. Das war auch erforderlich, der Eifeler Chreßboum nämlich musste wenigstens bis Köningsdaach (Dreikönigen) halten, oft aber sogar bis Liëchtemoss (Maria Lichtmess, 02. Februar). Das war beispielsweise bei uns daheim üblich. Solange sich das Klauen auf Wildwuchs beschränkte, drückte der Forstbeamte in der Regel beide Augen zu. Wenn aber in Fichtenkulturen „gewildert“ wurde, konnte die friedlichste Försterseele wild werden, und das mit Recht. In Laubholzaufforstungen gab es Fichten-Wildwuchs, der ohnehin entfernt werden musste, warum also in Kulturen Schaden stiften! Wer heute als Chreßboumkläuert (…dieb) erwischt wird, hat mit deftigen Geldbußen zu rechnen.
Chreßdaach
Christtag, landläufige Bezeichnung des Weihnachtsfestes allgemein: Öwwer Chreßdaach kött Tant Liss op Besuch (Über Weihnachten kommt Tante Lisbeth zu Besuch). Wenn die Feiertage insgesamt gemeint sind, wird Daach mit kurzem gedehntem a gesprochen (Beispiel: Saat): Aan denne Chreßdaach hät et düchtich jeschnejt (An den Weihnachtstagen hat es kräftig geschneit). Die Weihnachtstage zählen zu den „Lostagen“ und nehmen unter den Bauernregeln breiten Raum ein. Ein paar Beispiele: „Wer sein Holz um Christmett fällt, dem sein Haus wohl zehnfach hält; Ist es grün zur Weihnachtsfeier, fällt der Schnee auf Ostereier; Wenn Christkindlein Regen weint, vier Wochen keine Sonne scheint.“ Es gibt auch „sinnige“ Christtagssprüche, beispielsweise: „Wenn´s an Heiligabend schneit, ist das Weihnachtsfest nicht weit.“ Chreßdaach 1944 bleibt unvergessen: Ardennenschlacht, Christmette in Blankenheimerdorf, in der Kirche nur ein paar Kerzen, Stille Nacht, heilige Nacht, das eindrucksvolle Lied übertönt das Donnern der Tiefflieger über dem Dorf, für einen Augenblick sind Krieg und Bomben vergessen. Vater hat Weihnachtsurlaub, am Neujahrstag muss er wieder fort. Besonnene Dorfbewohner und sogar die deutschen Soldaten raten ihm, sich in unserem Wald zu verstecken und nicht mehr in den Krieg zu gehen, dessen Ende sich schon abzeichnet. Er fährt doch zurück, nicht aus „Führertreue,“ vielmehr aus Sorge um uns, die wir mit Sicherheit größten Repressalien ausgesetzt worden wären.
Chreßkindche
Ein Wort mit mehrfacher Bedeutung. Mit Chreßkindche bezeichnen wir in erster Linie das Jesuskind, das als unser „Weihnachtsgeschenk“ in der Krippe liegt. In Anlehnung daran übertragen wir unterdessen Chreßkindche auch auf alle übrigen Weihnachtsgaben. Häßte et Chreßkindche ad parat (Hast du die Geschenke schon bereit) ist eine gängige Frage in der Vorweihnachtszeit, und wie wor et Chreßkindche erkundigt man sich später nach Art und Umfang der Geschenke. Bei uns daheim „kam“ das Christkind an Heiligabend. Wir Pänz (Kinder) wurden frühzeitig ins Bett gesteckt, gegen 23 Uhr nämlich hieß es „Abmarsch zur Christmette nach Blankenheimerdorf,“ da mussten wir wieder munter sein. Der mitternächtliche Kirchgang war Pflicht, auch bei Eiseskälte und Schneegestöber wurden uns die drei Kilometer Fußmarsch mit den Eltern nicht erlassen, auch nicht bei Tieffliegern und Ardennenkrieg. Pflicht war ebenso der Empfang der Kommunion in der Christmette, und das wiederum bedeutete drei Stunden vorher nichts essen und trinken, gemäß dem Nüchternheitsgebot. Selbst der kirchlich erlaubte Schluck Wasser war bei uns daheim untersagt. Wenn wir gegen 23 Uhr „geweckt“ wurden, – keiner von uns hatte vor Aufregung ein Auge zugetan – war et Chreßkindche da gewesen, der Lichterbaum strahlte, auf den Weihnachtstellern lockten Plätzchen und selbstgebrannte Kamelle, damals im Krieg eine köstliche Rarität, - und mussten unberührt bleiben, bis wir gegen 02 Uhr morgens wieder vom Dörf zurück waren. Eine besonders gescheite „Bescherung“ war das ganz sicher nicht.
Chreßlech Liehr
Religionsunterricht, wörtlich „christliche Lehre.“ In unserer kleinen Dorfschule in Nonnenbach war während meiner dortigen Schulzeit (1941 – 1948) das offizielle Fach „Religion“ mehr oder weniger unbekannt, gab es doch auch im Dorf keinen Geistlichen. Da kam zwei- oder dreimal im Jahr Pfarrer Josef Offermann aus Ripsdorf zu uns in die Schule, wenn er im kleinen Brigida-Kapellchen eine Messe zelebriert hatte, und prüfte unsere Religionskenntnisse. Eine ständige Redewendung bei ihm war „nicht wahr nicht,“ ich sehe ihn noch heute vor unseren langen Schulbänken stehen. Dafür, dass wir im religiösen Bereich nicht verkümmerten, sorgte unterdessen Dechant Hermann Lux in Blankenheimerdorf, zu dem wir in regelmäßigen Abständen en de chreßlich Liehr geschickt wurden. Diese Religionsstunden fanden in der Regel im Pfarrhaus statt: Dem Seelenhirten war ab 1936 der Zutritt zur Schule „wegen politischer Unzulässigkeit“ untersagt. Im Dörf (kurz für „Blankenheimerdorf“) herrschte damals eine seltsame Gepflogenheit, deren Ursprung bis heute nicht geklärt ist: Am Dorfeingang wurden wir Nonnenbacher von etlichen Dörfer Burschen „empfangen“ und kurzerhand verdroschen, und da wir sehr in der Unterzahl waren, stand der Sieger von vornherein fest. Oft hielt der Dechant seine Christenlehre auch im Anschluss an die sonntägliche Andacht in der Kirche ab. Da waren dann auch die Erwachsenen dabei und konnten sich über die christlichen Kenntnisse ihrer Sprösslinge „vor Ort“ informieren.
Chreßmett
On wenn et Heujaffele schnejt, en de Chreßmett wiëd jejange! Das heißt übersetzt: „Und wenn es Heugabeln schneit, in die Christmette wird gegangen“. Mit diesem Machtwort beendete Mam unseren Kinderprotest gegen den Gang zur Christmette im heftigen Schneegestöber oder bei eisigem Wind in der Weihnachtsnacht. Der nächtliche Talep (Fußmarsch) über drei Kilometer nach Blankenheimerdorf zur Weihnachtsmette war für uns ganz einfach Pflicht, nach dem Wetter wurde da gar nicht lange gefragt. Einen Räumdienst gab es zu meiner Kinderzeit daheim noch nicht, manchmal wateten wir bos aan dr Buch (bis an den Bauch) durch den Schnee, die Beinkleider waren steif gefroren, wenn wir in der Kirche ankamen, tauten in der spärlichen Wärme langsam auf und verströmten wenig angenehme Dünste und Gerüche. Insgeheim waren wir Pänz ja eigentlich durchaus angetan vom mitternächtlichen Kirchenbesuch, bedeutete er doch mehr oder weniger ein nicht alltägliches Abenteuer. Außerdem ersetzte die Mette den sonst vorgeschriebenen Kirchgang am Weihnachtsmorgen, man konnte ein wenig länger im Bett bleiben. Am zweiten Feiertag hieß es aber wieder unerbittlich: De Maiheck erop und das war bei uns eine Umschreibung für „Auf nach Blankenheimerdorf“. Unser Kirchenbesuch im Dörf bedeutete jedes Mal einen Fußmarsch von insgesamt gut sechs Kilometern. An Sonn- und Feiertagen war es Pflicht, zu jeder Tageszeit, bei jedem Wetter.
Chrestoffel
Das Wort wurde auch früher nur selten angewandt und ist inzwischen so gut wie unbekannt: Mundartlich für „Christophorus“. Häufiger war dagegen die Abkürzung Stoffel, die regional auch heute noch gelegentlich auftaucht. Die standardsprachliche Abkürzung ist „Christoph.“ Der heilige Christophorus zählt zu den Nothelfern und ist heute der Schutzheilige der Reisenden und besonders der Autofahrer, an zahlreichen Armaturenbrettern gibt es die Plakette mit dem „Christusträger“ als Amulett gegen Unfall und Gefahr. Den Namen des Nothelfers hat auch die deutsche Luftrettung übernommen: Die Rettungshubschrauber tragen den Namen „Christoph“ und zusätzlich eine Nummer. Mein zweiter Vorname, der aber eigentlich nur in der Geburtsurkunde und auf dem Ausweis erscheint, lautet ebenfalls „Christoph.“ Das geht auf meinen Taufpaten zurück, Christoph Vossen, der Bruder meines Vaters, von uns allgemein nur Onkel Stoffel genannt. Er war Anstreicher von Beruf und wohnte in Esch (bei Jünkerath, Rheinland-Pfalz). Mangels Fahrgelegenheit hielten sich die gegenseitigen Besuche unserer Familien in Grenzen, trotzdem sehe ich Onkel Stoffel noch deutlich vor mir: Er war ein wenig „braungefärbt“ und trug nach höchstem Vorbild auf der Oberlippe ein „Schnäuzerchen.“
Christin
Mit diesem Wort bezeichnete der Eifeler nicht etwa eine fromme gottgläubige Frau, die nämlich würde Chreßtin tituliert. Vielmehr war und ist Christin die übliche Form von „Christine“. Die Betonung liegt dabei auf „Chris“, das zweite i wird lang gesprochen, wie etwa in „Tina“. Diese mundartliche Namensnennung wurde unterdessen nur bei älteren Frauen angewandt, bei Kindern und Jugendlichen war „Christel“ üblich, eine oft lebenslang beibehaltene Koseform. Den offiziellen Mädchennamen „Christine“ oder gar „Christina“ hörte man in der Eifeler Umgangssprache so gut wie nie. Neben Christin gab es noch die Abkürzungen Stin, Stina oder Steng (weiches e), die aber verhältnismäßig selten gebraucht wurden und einen etwas „rustikalen“ Beigeschmack besaßen. Aus meiner Kinderzeit ist mir noch eine Christin in Erinnerung: Hejneres Christin, Christine Schwarz, die Mutter meines Spiel- und Schulkameraden Werner Schwarz. Eine Frau wie Hejneres Christin mit Christel anzureden, wäre geradezu ein Unding gewesen.
Cillche
Gesprochen Zillche, früher ein häufig anzutreffendes Kosewort für „Cäcilia,“ heute eher aus der Mode gekommen. Der Frauenname Cäcilia ist insgesamt „rar“ geworden, Cäcilia war eine römische Heilige und Märtyrin, und das passt offensichtlich nicht mehr so recht in unsere moderne Zeit. „In“ ist dagegen in unseren Tagen Silke, und das ist die friesische Kurzform von Cäcilia, daneben auch die deutsche Kurzform von Celia oder Gisela (Quelle: Wikipedia). Unser heutiges Kosewort für Cäcilia ist Cilli (Zilli), Cilla oder auch Cilia. Sankt Cäcilia ist die Schutzheilige der Kirchenmusik, zahllose Kirchenchöre und Gesangvereine tragen ihren Namen, unter anderem auch unser in 1882 gegründeter Cäcilienchor. Aus meiner Kinderzeit sind mir noch zwei Cillcher (Plural) gut in Erinnerung: Krengs Cillche (Cäcilia Manstein), die im Krieg die kleine Poststelle in Nonnenbach führte, und Kaue Cillche (Cäcilia Klinkhammer), unsere Nachbarin. Bei Krengs Cillche holte einer von uns Schülern morgens die Post für unseren Lehrer Josef Gottschalk ab, Kaue Cillche steckte mir gelegentlich ein paar Süßigkeiten zu und war somit meine liebste Nachbarin. Sie hat in der elterlichen Landwirtschaft schwer arbeiten müssen, blieb ledig und starb im Oktober 1977 mit nur 63 Jahren.
nach oben
|