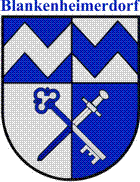|
Baach
Eins der zahlreichen Hauptwörter, die im Eifeler Dialekt eine „Geschlechtsumwandlung“ über sich ergehen lassen müssen: Der Bach wird in unserer Mundart die Baach. Ähnliche Beispiele: Die Knauch (Knochen), die Schonk (Schinken). Ein kleiner Bach ist ein Bäächelche oder ein Flössje (von „fließen“ = Rinnsal). Wo der Bach einen Ort durchfloss, war er von besonderer Bedeutung für die Bewohner und war als de Baach ein Zentralbegriff. In Schlemmershof markierte bis zur Kommunalreform 1969 de Baach (der Nonnenbach) die Gemeindegrenze zwischen Blankenheimerdorf und Ripsdorf. Auch eine kleine Wassermenge konnte ein Bach sein: Wenn ein Loch im Wassereimer war, lief da en richtich Baach erüß, und wenn bei Klein-Willi die Windeln nass wurden, hatte das Kind e Bäächelche jemääch (ein Bächlein gemacht). Aus dr Baach bezogen wir daheim unser Trinkwasser, - heute ein geradezu sträfliches Abenteuer. Und mit den Worten Nu jö, aan de Baach schickten wir unsere drei Kühe zur Tränke am Lohrbach.
Baales
Baales ist ein Familienname in Blankenheimerdorf, der aber aus dem benachbarten Ort Nonnenbach „zugewandert“ ist. Dr Baales (Der Baales) war ein feststehender Begriff im Dorf und nach seinem Berufswunsch gefragt, meinte dieser oder jener Schulbub begeistert: Ech were Baales (ich werde Baales). Dr Baales hieß Theodor, stammte aus Nonnenbach und wurde dort Baalesse Thuëres genannt. Für die „Dörfer“ war er manchmal Baalesse Theo, meistens aber einfach dr Baales. Er war Metzger von Beruf und als Hausschlachter über die Dorfgrenzen hinaus ein Begriff. Die Hausschlachtung war damals an der Tagesordnung. Wenn ein Schuljunge Gefallen am Metzgerberuf fand, verkündete er stolz: Wenn ech jrueß sen, weren ech Baales. Theodor Baales starb im Dezember 1975 im Alter von 83 Jahren. Er ging in unserer Werkstatt ein und aus und schärfte sich gelegentlich seine Schlachtmesser auf Vaters handbedientem Nass-Wellstein, auf dem es kein „Verbrennen“ der empfindlichen Messerschneide gab.
Backes
Durch Anfügen von „es“ an einen Wortstamm entsteht im Dialekt häufig ein Hauptwort: Röüches (Räucherhaus), Schlaachtes (Schlachthaus), Kruches (niedriges Häuschen, Hütte, regional auch Kruffes genannt), Duffes (Taubenhaus). Das Backes ist somit das Backhaus, das in vielen Dörfern früher eine Gemeinschaftseinrichtung für diejenigen war, die selber keinen Hausbackofen besaßen. Die heutige moderne Backstube wird vielfach auch noch Backes genannt, Bells Backes beispielsweise. Das gebräuchliche Zitat noch net aan Schmitz Backes vorbie datiert in die Zeit zurück, als in Köln das Spießrutenlaufen der gefangenen Verbrecher vom Frankenturm bis zum Severinstor noch üblich war: Die Prozedur endete am Backhaus Schmitz kurz vor dem Tor (Quelle: Google). Ein „Schmitz Backes“ gab es noch nach dem Krieg direkt vor unserer Haustür in Blankenheimerdorf: Am Haus Nikolaus Schmitz, (ortüblich Juëne), heute Dehart, gab es rechts von der Haustür einen kleinen Anbau, in dem der Backofen untergebracht war. Juëne Backes wurde in den 1960er Jahren abgerissen. Juene Tant, die alte Frau Katharina Schmitz, habe ich noch gekannt, sie starb im Jahr 1952.
bähe
Ein etwas seltsames Wort, das mit „baden“ verwandt ist und soviel wie „durch Erwärmen und Baden weich machen“ bedeutet. Vermutlich wegen der unzureichenden Ernährung im Krieg, hatten wir Kinder ständig unter Schwäre (Geschwüre, Furunkel) zu leiden. Diese äußerst schmerzhaften Eiterbeulen saßen gewöhnlich an Nacken und Hinterkopf, manchmal aber auch am Hinterteil und das war besonders peinvoll. Tagelang mussten wir daheim die Schwäre in heißem Kamillentee bähe oder mit schwazz Sejf (Schwarze Seife = Schmierseife) behandeln. Das zog tatsächlich nach einiger Zeit den Eiter aus der Wunde und die Schmerzen waren weg. Einmal ging das Geschwür an meinem Hinterkopf während der Rechenstunde von selber auf und ich suchte voller Scham, den austretenden Eiter mit dem Taschentuch aufzufangen. Lehrer Gottschalk bemerkte meine Not und meinte: „Ist er auf gegangen? Lauf heim und lass es dir von Jött sauber machen.“ Jebäht wurden bei uns auch neue Reichelsfurke (Holzstiele mit gabelförmigem Ende für den Heurechen): Unter ständigem Drehen wurden sie intensiv im offenen Feuer erhitzt, dadurch löste sich die Schale vom Holz und der Stiel wurde tadellos glatt, außerdem erhielt er durch die Hitze eine schöne braune Farbe. Das klappte allerdings nur bei ganz frisch geschnittenem Holz, das noch nicht getrocknet war.
Bähne
Unser Mundartwort für „Wiese, Grasland,“ wobei die Schreibweise auch Bääne sein kann. Der Ausdruck bezeichnet meistens ein einzelnes Stück Land, beispielsweise besaß Pitterjuësep (Peterjosef) an der Maiheck (Flurname) eine Wiese: Ose Bähne an dr Maiheck. Oft bezieht sich Bähne aber auch auf einen ganzen Flurbereich, bei uns daheim gab es beispielsweise den Hohnerbähne (Hühnerwiese) und weiter bachaufwärts den Steere- und den Wejerbähne (Sternen- und Weiherwiese). Die mundartliche Wiese ist männlich: Der Bähne. In der Gemarkung Blankenheimerdorf gibt es unter anderem die Flur Lenzebähne an der Gemarkungsgrenze zu Blankenheim, Vurrelsbähne hinter der Weiherbergbrücke, oder auch Sengertsbähne unterhalb des Feuerlöschteichs Stahlbuschseifen. Das Hochdeutsche Wort für Bähne war „Benden,“ es wurde in erster Linie auf Feuchtwiesen angewendet.“ In Flurkarten oder Ortsnamen hat es sich bis heute erhalten: Malsbenden (Ortsteil von Gemünd) beispielsweise, oder Breitenbenden (Stadtteil von Mechernich). Breitenbenden heißt im Volksmund auch Brejdebähne
Bahnemänn
Der früher übliche Ausdruck für die Gesamtheit der Eisenbahner, der Einzelne von ihnen war ein Bahnemann. Ebenso gab es Possmänn (Postler) oder Böschmänn (Waldarbeiter). Speziell in Blankenheimerdorf kannte man die Melzemänn (Belegschaft des Sägewerks Milz in Blankenheim-Wald) und auch die Kaastenholzmänn (die Zimmerleute Paul und Heinrich Kastenholz). Zur Zeit unserer Eltern war die Bahn ein bedeutender Wirtschafsfaktor und Arbeitgeber, wenigstens ein Drittel aller Erwerbstätigen aus Blankenheimerdorf waren Bahnemänn und trugen stolz die blaue Uniform mit den goldenen Knöpfen und Kragenspiegeln, die allerdings in den Wirtschaftswunderjahren nach dem Krieg ziemlich ins Hinterreffen geriet. Da nämlich war man nur noch der ärme Iesebähner (arme Eisenbahner), dem der Handlanger vom Bau gönnerhaft ein Bier spendierte. Das änderte sich schlagartig mit dem Eintritt von Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit. Da nämlich beneidete nicht nur der Handlanger die Bahnbeamten um ihren krisensicheren Arbeitsplatz.
Bahnereich
Ein schräger Geländeanstieg, ein Abhang oder eine Böschung wurde und wird regional Reich genannt. Bei uns daheim gab es früher das Dichreich und das Jassereich, In Blankenheimerdorf gibt es heute noch das Bahnereich, und damit ist der tiefe Einschnitt der früheren Ahrtalbahn gemeint, speziell dessen schräge Böschung. In der alten Bahntrasse ist heute die Entsorgungsleitung zur Kläranlage Blankenheim verlegt. Bis März 1961 verkehrte noch an bestimmten Tagen ein Dampf-Güterzug zwischen Blankenheim (Wald) und Ahrdorf, es war ein eigenartiger Anblick, wenn über dem Bahnereich der Dampf einer unsichtbaren Lokomotive aufstieg. Die oberen Ränder des Einschnitts waren mit massiven dichten Dornenhecken bepflanz, die alljährlich durch die Bahnmeisterei gewartet werden mussten: Heckeschnegge (Heckenschneiden) war bei den Rottenarbeitern eine mehr oder weniger beliebte Arbeit. Auf einem Gewannweg hinter der heutigen Straßenmeisterei ging anfangs der 1950er Jahre das Pferdegespann von Hans-Georg Romanowski durch und raste auf das Bahnereich zu, wo der Weg abrupt endete. „Schorsch“ rettete sich durch einen Absprung vom Wagen, eins der Pferde durchbrach die Hecke, stürzte etwa 20 Meter tief die Böschung hinab und musste notgeschlachtet werden.
Bähneschlejf
Ein landwirtschaftliches Gerät zur Pflege von Wiesen- und Weideflächen, offiziell „Wiesenschleppe“ oder „Wiesenhobel“ genannt. Wie schon aus der Bezeichnung ersichtlich ist, ebnet und glättet die Bähneschlejf die Grasfläche, indem sie Monthövvele (Maulwurfshügel) oder Seckoomessehöüf (Ameisennester) zerstreut und trockenes Gras oder Moos beseitigt. Das fördert den Graswuchs, eine Pflegemaschine also. Der moderne Grashobel ist eine Art „leichte Egge,“ die aber der Grasnarbe nicht schadet. Unsere Eltern behalfen sich mit möglichst schweren „halbierten“ alten Auto- oder Traktorreifen, die mehrfach neben- und hintereinander gebunden und mit den Schnittflächen über die Wiese gezogen wurden, - ein sehr einfacher, billiger und wirksamer Behelf. Mit einer solchen Bähneschlejf versuchte unser damaliger Bürgermeister Toni Wolff im Jahr 1989 das durch eine Schafherde „versaute“ Wiesenfestgelände auf dem Stein zu „planieren,“ – umsonst, Matsch und Gestank verstärkten sich noch. Die Urform der Bähneschlejf war ein einfacher starker Balken, an dem drei kleinere, verschieden lange Hölzer schräg befestigt waren.
Balech
In der generellen Übersetzung ist der Balg bezeichnet, beispielsweise der Blasebalg beim Schmied oder der mechanische Winderzeuger in der Kirchenorgel. Balech steht unterdessen auch für etliche weitere Begriffe, unter anderem für „Bauch, Körper, Kind.“ Mit dem Balech ist eine ganze Anzahl von Redewendungen verbunden. Sech dr Balech vollfresse (sich den Bauch vollschlagen) ist die derbe Beschreibung des Hungergefühls. Et Metz en dr Balech renne (Das Messer in den Bauch stechen) kommt einer Morddrohung gleich. Dr Düvel em Balech han (Den Teufel im Leib haben) trifft auf einen Taugenichts zu. Ene Balech wie en Koh (Bauch wie eine Kuh) ist die Folge zu umfangreichen Essens. Nix am Balech (Nichts am Leib) markiert einen armen Menschen. Balechpeng sind Bauchschmerzen. Bliev mir vam Balech (Bleib mir vom Leib) ist die Warnung vor körperlichem Kontakt. Jemanden öm dr Balech haue bedeutet verprügeln. Wem sin dann die Bälech doo bedeutet „Wessen Kinder sind das da.“ Nu kick dir ens dä freche Balech aan entrüsten sich die Erwachsenen über einen ungezogenen Jungen. Wir Messdiener mussten früher bei Gottesdienst und Andacht in unserer Kirche dr Balech tredde (den Balg treten), das bedeutete den Blasebalg der Orgel in Betrieb halten. Das Tretbrett befand sich direkt neben dem Organisten, und Karels Mechel konnte recht ungnädig werden, wenn der „Betriebsdruck“ zu niedrig wurde und die Orgelpfeifen zu „jammern“ begannen (siehe Karels Mechel). Von Balech abgeleitet ist auch das mundartliche Zeitwort baleje, was soviel wie „wüst spielen, rangeln, raufen“ bedeutet. Dabei wird in der Regel „sich“ beigefügt: Sech ens, wie die Bälech sech wier baleje (Sieh mal, wie die Kerle wieder raufen).
Ball
Hier handelt es sich nicht um ein spezielles Mundartwort. Der Ball bezeichnet hier wie im Hochdeutschen sowohl das Kinderspielzeug als auch die Tanzveranstaltung. Besonders Letztere spielte aber in unserem früheren Dorfleben eine bedeutende Rolle, darum soll im Dörfer Lexikon ein wenig näher darauf eingegangen werden. Der Ball als Sportgerät und Spielzeug wurde regional auch Boll genannt, beispielsweise in Nonnenbach. Das war auf das Niederländische bol (Kugel) zurückzuführen. Das Tanzvergnügen war und ist auch in der Mundart allenthalben der Ball. Zum Ball gehört der Ausschank von Getränken, also ist in der Regel der Tanzsaal mit einer Gaststätte verbunden. Noch nach dem Krieg gab es in Blankenheimerdorf sage und schreibe vier Lokale: Friesen, Schmitz/Cremer, Buhl und Treppchen (ehemals Eisdiele Schröder). Bei Friesen und Buhl gab es einen großen Tanzsaal, Schmitz und Treppchen boten Tanzgelegenheit in kleinerem Umfang. Und alle Vier hatten, etwa zur Kirmes, an allen Tagen Hochbetrieb. Als später die Ballbesucher spärlicher kamen, führte der veranstaltende Kirmesreih versuchsweise kombinierte Eintrittskarten für die beiden Säle ein, doch hat sich das als wenig erfolgreich erwiesen. Die Besucherzahlen sanken drastisch, auch der Gaststättenbetrieb wurde unrentabel. Stück für Stück wurden die Lokale aufgegeben. Der Landgasthof Schmitz (Krämesch) hielt sich noch eine Zeitlang, wurde aber nach dem Tod des Besitzers ebenfalls geschlossen. Seitdem gibt es bei uns keine Gaststätte mehr, geschweige denn einen Tanzsaal. Zwar wurde inzwischen das Bürgerhaus gebaut, doch ist die Einrichtung für größere Veranstaltungen zu klein. Die Kirmesveranstalter beispielsweise organisieren zusätzlich alljährlich ein großes Tanzzelt.
bang
Gleichlautend und auch gleichbedeutend mit dem hochdeutschen „bang“ in der Bedeutung von „ängstlich, furchtsam.“ In der Mundart existieren unterdessen Formulierungen und Anwendungen, die in der Standardsprache nicht üblich sind. Beispielsweise nach einem Unfall: Et os mir hart bang, dat dä noch ens op de Bejn kött (Ich fürchte der kommt nicht mehr auf die Beine). Vor einer Prüfung: Et os mir für dä net bang, datte bestejt (Keine Sorge, der besteht die Prüfung). Ein arbeitsamer Mensch: Dä määch sech vüër dr Ärbed net bang (Der scheut keine Arbeit). Gretchen fürchtet die Finsternis: Dat Jret os ze bang für em Düüstere op de Strooß ze john (Gretchen geht im Dunkeln nicht auf die Straße). Zwei Streithähne trennen sich: Bos net bang, dat ech dir noch ens de Daachszitt sohn (Erwarte nicht, dass ich dich noch mal grüße). Dass bei großer Angst häufig etwas en de Botz jeht (in die Hose geht), ist eine natürliche Körperreaktion, das hat mir sogar einmal ein altgedienter Frontsoldat bestätigt. Immerhin ist von dieser Tatsache der Ausdruck Bangbotz (Angsthose) hergeleitet, und auch Bangdreßer (Angstscheißer) dürfte dazu zählen. Unter diese Kategorie fällt schließlich auch der Begriff Scheß han (Schiß haben).
Bänkelche
Ein „Bänkchen“ ist eine kleine Bank, das Bänkelche ist auch eine kleine Bank, aber eine ganz spezielle, nämlich ein Fußbänkchen. Unser Dialekt macht da einen ganz klaren Unterschied. Holl mir ens et Bänkelche sagte der Opa zum Enkel, wenn er die Schluffe (Hausschuhe) anzuziehen gedachte. „Bänkchen“ wäre hier völlig fehl am Platz gewesen. Das Bänkelche gab es früher in jedem Haus, das bastelten sich die Leute aus ein paar Brettchen selber zusammen. Das Gerät entsprach zwar keiner Prüfnorm, es erfüllte trotzdem, aus stabilem Eifelholz gebaut, spielend alle Anforderungen. Es stand in der Stovv (Stube, Wohnzimmer) hinter dem Ofen, und wintertags wurden darauf die vom Schlittenfahren nassen Kinderschuhe getrocknet. Das Eifeler Bänkelche war so massiv konstruiert, dass es auch Zentnergewichte zu tragen vermochte. Beim Tapezieren wurde es beispielsweise als Trittstufe genutzt und im Huus (Küche) wurde der Wassereimer darauf abgestellt. Ein aus der Gegend von Cheb (Tschechien) stammender Bekannter bezeichnete unser Bänkelche als Schapell, wobei er selber diesen Namen nicht zu deuten wusste. Das zeitgemäße Fußbänkchen unserer Tage ist aus starken Plastikteilen hergestellt und kann Platz sparend zusammengeklappt werden.
Bankknäech
Der „Bankknecht“ fehlte früher in keiner Dorfschreinerwerkstatt, in modernisierter Form ist er auch heute noch in der Schreinerei unentbehrlich. Ich selber besitze noch Vaters hölzernen „Bankgehilfen,“ den er selber angefertigt hat und der nach mehr als 65 „Dienstjahren“ immer noch einsatzklar ist. Der Bankknäëch ist eine Hilfe beim Bearbeiten langer oder schwerer Holzteile auf der Hobelbank, früher vor allem beim „Strecken“ langer Bretter mit der Rauhbank (Langhobel). Das Werkstück wird an einem Ende mit der „Vorderzange“ an der Hobelbank befestigt, das andere Ende hängt mehr oder weniger „frei in der Luft,“ verursacht ein ständiges Wippen des Werkstücks und macht dadurch das akkurate Bearbeiten mit dem Langhobel unmöglich. Der Bankknecht ist eine tischhohe senkrechte Stütze mit einer in der Höhe verstellbaren waagerechten Auflage für das zu bearbeitende Brett, das so zusätzlich stabilisiert wird. Der Bankknecht steht in der Regel auf einem ziemlich massiven Kreuzfuß, der dem Ungeübten bei der Arbeit an der Hobelbank hinderlich sein kann.
Bärb
Der allgemein übliche Name für „Barbara,“ meistens in der mundartlichen Koseform angewendet: Bärbche oder allgemein Bärbel. Regional sind auch Bäbb und Bäbbche im Gebrauch. Den Senioren in unserem Dorf ist noch der Hausname Bärpe ein Begriff, das frühere Anwesen Friederichs am Denkmalplatz. Die Mutter unseres verstorbenen Bürgermeisters Toni Wolff hieß Barbara und wurde im Dorf allgemein Wolefs Bärb genannt. Die heilige Barbara ist Patronin unter anderem der Bergleute und Dachdecker, sie zählt zu den 14 Nothelfern und wird bei Gewittern und Feuersnot angerufen. Ihr Namensfest ist der 04. Dezember, im Volksmund Bärbendaach oder Bärpendaach (Barbaratag) genannt. Bärpendaach war früher daheim für uns Kinder ein ganz besonderer Tag, fing doch damit für uns eigentlich die Zeit der weihnachtlichen Vorfreuden an, die uns inzwischen längst durch unendliche Kauf- und Lichteraktionen der Warenhäuser schon Monate vor dem Fest „versaut“ werden. Ein echter Un-, Wider-, Irr- und Wahnsinn: Ab Oktober gibt es im Supermarkt Weihnachtssachen. Bei uns daheim wurden am Bärpenoovend (Barbara-Abend) die intensiv blankgewienerten Kinderschuhe aufs Fensterbrett gestellt, und am nächsten Morgen steckten ein paar Äpfel und Plätzchen darin: Die Bärb hatte uns beschenkt, wie sie es alljährlich tat. Sie hatte dafür sogar Äpfel aus unserem eigenen Garten gesammelt, das machte sie uns besonders sympathisch. Zwei Tage später beschenkte uns Sankt Nikolaus noch einmal, und dann kamen knapp drei Wochen Warten auf das Christkind. Der Dezember war für uns d e r Jahresmonat. Bekannt ist die Gepflogenheit, einen an Bärpendaach geschnittenen Obstbaumzweig in der Hauswärme in Wasser zu stellen, damit er an Weihnachten blühe. Ich habe mehrfach den Versuch gemacht, der Zweig vertrocknete generell, geblüht hat er nie.
baschte
Ein heute noch gültiges Mundartwort. Baschte bedeutet „reißen, aufbrechen, platzen, zerspringen“ oder ganz allgemein kapott john (kaputt gehen). Beim Basteln mit dünnen Brettchen in Vaters Werkstatt wurde ich beispielsweise ermahnt: Bos vüersichtich, dat Holz kann liëch baschte (Vorsicht, das Holz kann leicht reißen). Wenn der Schneeball unglücklicherweise die Fensterscheibe traf, gab es einen Basch (Riss) im Glas, schlimmstenfalls war die Scheibe sogar total zerbasch (zerplatzt). Ze baschte (zum Bersten) ist unser Ausdruck für „viel, massenhaft, im Überfluss,“ das klassische Beispiel hierfür ist Dies Johr jitt et Jrompere ze baschte (heuer gibt´s massenhaft Kartoffeln). Ein Wunschtraum des Kleinen Mannes ist Jeld ze baschte (Geld im Überfluss). Anstelle von ze baschte sagen wir oft auch satt on jenooch (satt und genug). Baschte war und ist schließlich auch ein Kraftausdruck: Et os en Hetz für ze baschte (große Hitze), oder Dä Nool jeht en de Wand on wenn et basch (Ärger beim Nageleinschlagen). Große Wut im Bauch drückt der Eifeler so aus: Ech han en Woot em Balech, ech meen ech mööt baschte. Ein rüdes Schimpfwort lautet jebasch Loder (Luder).
Bass
Die korrektere Schreibweise wäre Bas, doch würde dabei das a gedehnt gesprochen wie etwa in „Nase.“ Obiger Bass muss unterdessen mit scharfem s gesprochen werden, obwohl es sich nicht etwa um das bekannte Musikinstrument handelt. Unser Bass ist die mundartliche Abkürzung des Namens Sebastian. Dieser wohlklingende Männername war zur Zeit unserer Großeltern recht häufig, geriet dann aber, wie viele andere „antiquierte“ Namen, leicht ins Hintertreffen, bis er um 1980 wieder zu den Beliebtesten zählte. Johann Sebastian Bach und Sebastian Kneipp waren Große Deutsche Männer, Sebastian Vettel und Bastian Schweinsteiger sind Deutsche Sportgrößen der Gegenwart. Basti, Bastin oder Bastl sind weitere regionale Koseformen, in Süddeutschland ist Wastl gebräuchlich, bei uns wurde eben Bass daraus. Der heilige Sebastian war ein Märtyrer, wurde mit Pfeilen erschossen und galt früher als Schutzheiliger gegen die Pest, er ist der Patron unter anderem der Schützen, viele Bruderschaften sind nach ihm benannt. Es gibt einige Bauerregeln, bei denen Sebastian zur Geltung kommt, eine davon: „An Fabian und Sebastian fängt der rechte Winter an.“ Sebastianstag ist der 20. Januar. Bei uns daheim gab es zu meiner Kinderzeit einen lustigen Mundartreim, an den sich heute keiner mehr erinnert: Ech wejß ene Spass van Benze Bass. Dä sooß op enem Ass on schess en e Fass. Do brooch dä Ass; do feel dä Bass en dat bedresse Fass. In freier Übersetzung: Benze (Hausname) Bass schiss von einem Ast herab in ein Fass. Der Ast brach und Bass fiel in das bekleckerte Fass.
bätsche
Ein Ausdruck mit verschiedenartiger Anwendung. Bätsch net esu, dat jehüet sech net (Schmatz nicht so, das gehört sich nicht) wiesen uns die Eltern zurecht, wenn wir Kinder etwas geräuschvoll unser Essen mampften. Hiervon abgeleitet war die Bätsch, ein etwas abfälliges Wort für „Mund.“ Einem Plappermaul wurde der Mund verboten: Halt endlich die Bätsch, und eine verbale Beleidigung wurde nicht selten mit einer Maulschelle quittiert: So, dofür kreßte ejne op deng Bätsch (So, dafür kriegst du einen aufs Maul). Generell hatte bätsche die Bedeutung von „quetschen, zerdrücken, kaputt machen.“ Karlchen hatte die Hühnernester visitiert und kam mit dem Resultat zurück: Dä, sebbe Eier han ech, zwei sin er zerbätsch. Von sieben Eier zwei zerquetscht, - eine bedrohliche Situation! Im Teller de Jrompere zerbätsche (die Kartoffeln zerquetschen) war eine unfeine Essmanier, die feste Babynahrung wurde unterdessen möndchesmooß jebätsch (mundgerecht zerkleinert).
Bätscheler
Obwohl die Aussprache gleichlautend ist, wurde mit diesem Wort auf gar keinen Fall der heute so häufig zitierte „Bachelor“ bezeichnet, den die Hochschulen als akademischen Abschlussgrad vergeben. Einen Bachelor kannten unsere Eltern noch gar nicht, wohl aber den mundartlichen Bätscheler, mit dem sie ein Plappermaul bezeichneten, einen Schwätzer, der sich gern reden hörte, im Übrigen aber nur sinnloses Zeug von sich gab. Eine andere Umschreibung war Quatschkopp. Wer im Dorf als Dummredner bekannt war, vor dem warnte man den Uneingeweihten: Jlöüv dem nix, dat os ene Bätscheler (Glaub dem nichts, das ist ein Schwätzer). Wir Pänz (Kinder) gingen den Eltern häufig mit unserem Gequengel (bohrendes Fragen) auf den Geist, bis Mam der Geduldsfaden riss: Hüer endlich op mot dengem Jebätschel (Hör endlich auf mit deinem Geschwätz). Bätscheler ist unverkennbar von Bätsch hergeleitet (siehe bätsche). Dem Wort haftet ein gewisser negativer Beigeschmack an, was beispielsweise bei Schimpfwörtern offenkundig wird: Bätschmuul oder Bätschschnöss kann man getrost mit „Lügen- oder Schandmaul“ übersetzen.
Bees
Die offizielle Bezeichnung ist „Biestmilch“ und bezeichnet die erste Milch der Kuh nach der Geburt eines Kälbchens. Sie ist äußerst fett- und vitaminreich und enthält alle für das Gedeihen des Neugeborenen erforderlichen Aufbaustoffe. Bees ist gelblich gefärbt und sieht nicht unbedingt appetitlich aus, aus Bees selbstgefertigter Klatschkäs (Quark) war aber für unsere Eltern eine Delikatesse, die ich allerdings ob ihrer Färbung verschmähte. Die dickflüssige fette Bees war bei uns daheim ein Heilmittel bei kleineren Wunden, die man sich im Alltag zuzog. Tatsächlich half sie sehr gut bei Schronne (Schrunden, rissige Hände), leider konnte man sie aber nicht so lange aufbewahren wie etwa ungesalzenes weißes Schweineschmalz, das gleichermaßen bei rauhen Händen half. Bees wurde nicht zuletzt zur Fußbodenpflege benutzt und war tatsächlich ein brauchbarer Ersatz für teure Holzpflegemittel. Die begrenzte Haltbarkeit der Milch fiel auch hier naturgemäß nachteilig ins Gewicht: Die frisch mit Bees „gewienerten“ Bodenbretter glänzten zwar ganz ordentlich, doch war dieser Jlanz nur von kurzer Dauer.
Beißem
Andere Sprechweisen sind Bessem, Bössem oder in der Südeifel Bääßem, gemeint ist in jedem Fall der Besen in seinen verschiedensten Gestalten mit langen Borsten und langem Stiel. Das Gegenteil ist der Stöüwer (Handfeger) mit kurzen Borsten und Handgriff, den die Aachener Quispel nennen. Unser Beißem ist unverkennbar eng mit dem holländischen „bezem“ (gesprochen: Besem) verwandt. Vom Besen sind mancherlei Redewendungen hergeleitet: „Neue Besen kehren gut“ oder ene Bessem freiße (einen Besen fressen). Der Beißemsstel (Besenstil) soll dem Vernehmen nach problemlos eine Hieb-, Stich- oder Schlagwaffe ersetzen können, und ein weibliches Wesen mit einem Beißem zu vergleichen, kann unliebsame Folgen haben. Bekannt ist unterdessen das Fortbewegungsmittel der Zauberinnen: Der Hexenbesen. Den gab es früher in jedem Eifelhaus, der Bauer stellte ihn selber aus Birkenreisern her, die der Wald massenweise und kostenlos lieferte. Solch ein Birkebeißem eignete sich hervorragend für die grobe Stall- und Hofreinigung, ihm wurde der Vorzug vor dem Strooßebeißem (Straßenbesen) gegeben, den es im Dorfladen gab und für den man gute Groschen blechen musste. Ein überregional bekannter Hersteller von Eifeler Hexenbesen war Josef Franzen, der allenthalben als der Besenbinder von Reetz ein Begriff in Fachkreisen war.
Bejßel
Das früher gebräuchliche Wort für „Meißel, Beitel, Stemmeisen.“ Beitel ist übrigens das holländische Wort für den Meißel. Zum Handwerkszeug von Zimmermann, Stellmacher oder Schreiner gehörten Bejßele (Mehrzahl von B.) aller möglichen Größen und Formen, häufig auch Steichiese (Stecheisen) genannt. Eine besondere Form war der Kaltbejßel, - ein massives Stemmeisen mit besonders gehärteter Stahlschneide zum Bearbeiten von Metall. In erster Linie war bei uns der Bejßel ein eiserner Spaltkeil zum Rieße (Reißen, Spalten) von Brennholz. Wenn die Holzbreefjer (Losnummern der Holzklafter) vergeben waren, schulterten die Männer Axt, Vorschlaghammer und Bejßele und marschierten zur Einschlagstelle im Wald. Die schweren Rollen der Meterstücke mussten fürs Aufladen jerosse (gerissen) werden. Das war je nach Anzahl der Knödde (Knoten, Astansätze) harte Knochenarbeit und der Schweiß floss in Strömen. Mindestens zwei Spaltkeile verschiedener Größe waren erforderlich, sie steckten in Seilschlaufen und wurden zum Tragen über die Schulter gehängt. Dazu kamen der Zehnpönner (Zehnpfünder, Vorschlaghammer) und die Axt, - das Gewicht machte sich beim kilometerweiten Fußmarsch nachhaltig bemerkbar. Kein Mensch besaß damals einen entsprechend gewichtigen Holzhammer und schon gar keinen Alu- oder Kunststoffhammer. Die Eisenkeile wurden mit dem Eisenhammer bearbeitet und bekamen mit der Zeit scharfkantige gezackte Ränder, die nicht ganz ungefährlich waren. Manchmal nämlich platzte beim Zuschlagen ein Teil davon ab und sauste durch die Gegend. Einmal traf ein solches Stück mein Schienbein, es gab eine zentimetergroße schmerzhafte Wunde, die nur langsam abheilte.
besejwere
Ein etwas unfeines Wort mit unerquicklichem Hintergrund, besabbele ist ein ähnlicher Ausdruck. Sejwer nämlich ist unsere Bezeichnung für eine meist unansehnliche Flüssigkeit wie etwa Speichel oder Piefesejwer (Sotte der Tabakspfeife). Besejwere bedeutet also, irgend etwas mit einer solchen Flüssigkeit bekleckern. Das Kleinkind beispielsweise verschlabbert ein paar Tropfen aus der Nuckelflasche und wird deshalb mit dem Schlabberlätzje ausgestattet, das früher verschiedentlich auch Sejwerläppche genannt wurde. Jemandem einen Bären aufbinden wird mundartlich häufig auch als besejwere bezeichnet: Du kanns mech net besejwere. Ein Muulräppeler (Maulheld), der dummes Zeug daherredet, ist ein Sejwerdönes. Besonders ältere Menschen besejwern sich (Alterserscheinung) beim Essen, dazu fällt mir eine Geschichte aus unserem Volksschul-Lesebuch ein, die nachdenklich stimmen dürfte. Der alte Opa besabbelte beim Essen das Tischtuch und wurde deshalb von Sohn und Schwiegertochter in die hinterste Küchenecke an einen kleinen Tisch verbannt. Und weil er auch schon mal einen Teller zerbrochen hatte, musste er aus einer Holzschüssel essen. Der vierjährige Enkel spielte mit ein paar Brettchen herum, auf Opas Frage, was er denn da mache, erklärte das Kind: „Ich baue ein Holztröglein, daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.“
bestronze
Das Substantiv Stronz ließe sich mit „mehr scheinen als sein“ umschreiben, Stronz bedeutet „Angeberei, Prahlerei, trügerischer Schein.“ Der Kölner sagt „Strunz“ und der Aachener „Stronks.“ Dasselbe trifft naturgemäß auch auf das Verb stronze zu, das regional oft in stronkse abgewandelt wird. Den Angeber und Prahlhans nennt man bei uns Stronzböggel (Böggel = Beutel). Bestronze bedeutet also, eine Person oder Sache zum Schein belobigen, ohne der ehrlichen Meinung zu sein: Lobhudelei. Es gibt Ereignisse oder Gelegenheiten, bei denen das Bestronze einfach unabdingbar ist. Wenn beispielsweise der Chef einen Vorschlag macht, so findet ihn die Belegschaft hervorragend, auch wenn es Blödsinn war. Oder wenn der Blumentopf plötzlich vom Fensterbrett aufs Eckschränkchen wandert, so findet unsereiner diese Neuerung tunlichst ausgezeichnet, - auch wenn man den Topf da in der Ecke kaum noch sieht. Eigenlob ist so etwas wie Selbstbestronzung. Wenn da beispielsweise der heimgekehrte Urlauber am Stammtisch allzu gewaltig von seinen Erlebnissen und Heldentaten berichtet, kommt aus irgendeiner Ecke der Hinweis: Jaja, bestronz dech selever ad jät, annesch dejt nämlich kejner dat (lobe dich nur selber, andere nämlich tun es nicht).
bichte
Zwei Dinge gab es für uns Kinder, die nicht nur unbeliebt waren, die wir vielmehr hassten, wobei wir uns unterdessen hüteten, diesen Hass offenkundig werden zu lassen: Hoor schnegge (Haare schneiden) und bichte (beichten). Beides war aber unabdingbar einmal im Monat fällig, Abweichungen von dieser elterlichen Regel waren indiskutabel, auch wenn das vierte Kirchengebot vorschrieb dass man nur „wenigstens einmal im Jahr“ seine Sünden zu beichten habe. „Wenigstens,“ das war der Haken, den die Eltern, auch im Sinne des Pfarrers, beliebig zurecht bogen. Ein Bichzeddel (Beichtzettel) mit der Auflistung der Sünden wurde uns angeraten, damit wir im Bichstohl (Beichtstuhl) nur ja nichts vergessen könnten. Der Zettel kam ins Jebettbooch (Gebetbuch), wo er manchmal vergessen und von den Eltern gefunden wurde. Ich selber habe nie einen Bichzeddel geschrieben. Ich erinnere mich an die eine oder andere „Volksmission,“ in deren ein- oder zweiwöchigem Verlauf selbst wir Kinder derart „bearbeitet“ wurden, dass wie zum Schluss dankbar dafür waren, unsere paar Sündchen überhaupt beichten zu dürfen.
Bierth
Das Waldgebiet Bierth liegt etwa 500 Meter südöstlich von Olbrück in Richtung Nonnenbach, bis 1912 stand hier der Bierther Hof, auf drei Seiten von ausgedehnten Wiesen umgeben. Op Bierth war unsere Bezeichnung für das Gelände, das mir aus meiner Kinder- und Jugendzeit noch als Hofwüstung bestens in Erinnerung ist. Um 1960 wurde das Wiesengelände aufgeforstet und ist heute vollständig bewaldet: Heiliges Jagdrevier, das niemand mehr zu betreten wagt, ein Stück Kultur unserer Vorfahren ist für immer verschwunden. Der letzte Hausbesitzer hieß Peter Joisten, als Bierther Pitter meinen Eltern noch sehr gut bekannt. Mein Onkel Johann Plützer (Plötzer-Schäng) hat als Fünfzehnjähriger auf Bierther Hoff bei der Arbeit ausgeholfen. Aus dieser Zeit ist ein Ereignis bekannt, das unser früherer Pastor Ewald Dümmer aufgeschrieben hat: Es war am 18. Februar 1912, im Bierther Hof setzte man sich gerade zum Abendbrot, als an der Haustür geklopft wurde und eine verstellte Stimme „ich will 20 Mark oder ich schlage euch alle tot“ schrie. Peter Joisten nahm eine Laterne, Johann Plützer bewaffnete sich mit einer Axt, gemeinsam stiegen sie ins Oberschoß, konnten aber in der Finsternis draußen nichts entdecken. Joisten feuerte einen Pistolenschuss in die Nacht, worauf unten das Küchenfenster eingeschlagen wurde und eine Gestalt davonlief. Pastor Dümmer schrieb: „Die Fußtritte waren groß, als wenn einer Plattfüße habe.“ Der Unbekannte wurde nie ermittelt, Bierther Hoff wurde wenige Monate später aufgegeben.
biese john
Was beim Pferdegespann durch john (durchgehen) genant wurde, das war bei den Rindern das biese john. Beides bedeutete, dass die Tiere panikartig und sozusagen „kopflos“ in wilder Flucht davon stoben. Es kam selten vor, wenn aber doch einmal eins der Weidetiere biese jing, so war das für den Hütejungen der reinste Horror. Nicht selten waren ein aufziehendes Gewitter und ein plötzlicher Donnerschlag die Ursache für die Panik der Tiere. Oder die Bedrohung durch Insekten, Wespen beispielsweise oder Dasselfliegen. Letztere konnten besonders beim Heueinfahren gefährlich werden: Wenn plötzlich so ein dicker Brummer den Gespanntieren drohend um die Köpfe kreiste, konnten sie in Panik mit den Heuwagen biese john und das gab dann ein Unglück. Deshalb musste stets einer von und Pänz mit einem belaubten Zweig die Brummer von den Tieren fernhalten, Fleeje jaare (Fliegen jagen) nannten wir das. Auf einem noch nicht aufgeforsteten Kahlschlag in der Hardt hütete ich unsere vier Kühe, - das Abgrasen solcher Flächen war damals üblich. Unsere Brong (Tiername: Die Braune), ein ohnehin stets aufgeregtes Vieh, geriet an ein Wespennest, galoppierte mit hochgerecktem Schwanz querwaldein davon und blieb unauffindbar, alles Suchen war vergeblich. Heulend und voller Angst trieb ich die übrigen drei Tiere heim, - und da stand Brong auf ihrem angestammten Platz im sicheren Stall, wo es keine Wespen gab.
Bilderboum
Der Bilderbaum, eine etwa 300-jährige Buche, stand bis Mitte der 1970er Jahre auf der Höhe der Nonnenbacher Hardt unweit vom Russenkreuz am Fußweg nach Blankenheim. Dort sprach man erstaunlicherweise stets vom Bilderbäumchen, das Riesengewächs war unterdessen alles andere als ein Bäumchen. Der meterdicke Stamm war doppelt mannshoch ausgehöhlt und zur Wegseite hin gut einen halben Meter breit offen, in der Baumhöhle fanden zur Not zwei Erwachsene Platz. Viele Jahre lang stand das Oberteil eines Steinkreuzes vom alten Blankenheimer Friedhof in der Höhlung, es verschwand mit dem Bilderboum, der vom Sturm umgeworfen wurde. Uns Kindern war der Baum damals unheimlich, weil es angeblich dort spuken sollte. Viel später beobachtete ich selber spätabends einmal eine seltsame Lichterscheinung im Bilderboum, die sich dann als brennendes Windlicht vor dem Steinkreuz entpuppte, daneben ein Strauß frischer Feldblumen in einer mit Wasser gefüllten Konservendose. Ein ähnlicher Riesenbaum war der Üleboum (Eulenbaum) am Standort der heutigen Hubertusbuche bei Blankenheimerdorf, der im Mai 1970 vom Sturm umgeworfen wurde.
Birrebunnes
Ein spezielles Eifeler Obstgebäck, einfach und billig herzustellen, aber ungewöhnlich lecker. Birre ist der Plural von Biër (Birne), und Bunnes ist ein Eifeler Wort für „Mus,“ Birrebunnes war also Birnenmus. Es gab zwei Arten von Birrebunnes: das aus frischen Früchten hergestellte Mus, ein „Sommerprodukt“ also, und den speziellen Bunnes aus getrockneten Birnen, der zu jeder Jahreszeit auf den Tisch kam. Das Trocknen und damit Haltbarmachen von Obst für den Winter – Pflaumen, Äpfel, Birnen – war für unsere Eltern eine Notwendigkeit. In manchen Hausgärten gibt es heute noch die alten Obstbäume, am Haus Schumacher beispielsweise und nicht weit davon beim alten Haus Plützer an der Ortsdurchfahrt, stehen mächtige Birnbäume direkt an der Straße. Für den echten Birrebunnes wurden die trockenen Früchte über Nacht eingeweicht. Am nächsten Tag wurden sie grob püriert und dick auf einen Boden aus süßem Hefeteig aufgetragen. Dazu kamen spezielle Gewürze wie Zimt und Koriander, je nach Geschmack auch Anis, in jedem Fall aber Röbekrutt (Rübenkraut, Rübensirup) als unverzichtbare Zutat. Röbekrutt war früher in jedem Eifelhaus zu finden, als beliebter Brotaufstrich beispielsweise und nicht zuletzt als Koch- und Backzutat. Es klingt unwahrscheinlich: Der Eifeler Sauerbraten erhielt seine besondere Geschmacksnote durch die Zugabe von Rübenkraut. Der „Rohbunnes“ kam dann in den Backofen, die Hausfrau kannte, auch ohne Uhr, genau die erforderliche Backzeit, und wenn das fertige Produkt dann dampfend und duftend aus dem Backofen kam, leckte sich die Hausgemeinschaft die Finger danach. Für den Birrebunnes galt die Faustregel dönn jelapp on deck jeflapp und das bedeutete, dass der Teigboden möglichst dünn, die Fruchtschicht dagegen wesentlich dicker sein musste.
Blangem
Das mundartliche „em“ als Endung eines Ortsnamens bedeutet immer „heim,“ Möllem (Mülheim) beispielsweise, Schmeddem (Schmidtheim) oder Neddeschem (Nettersheim). Blangem ist somit Blankenheim, früher Marktflecken an der Ahrquelle und seit der Kommunalreform 1969 namensgebender Zentralort der Großgemeinde. Blangem war schon immer so etwas wie ein „Mittelpunkt“ an unserer Oberahr. Hier konnte man Waren einkaufen, die es im dörflichen Allerweltsladen nicht gab, Bekleidung beispielsweise oder Schuhe. Wir Pänz pilgerten sonntags nach Blangem, um im Laden von Hermann Schumacher „ein Eis zu zehn“ zu erstehen. Wir sparten ein ganzes Jahr hindurch Groschen und Pfennige, um im August auf der Blangemer Kirmes ein paar Fahrten mit dem Ketten- und Pferdekarussell erleben und an der Kirmesbude Veilchenpastillen und Lakritzspiralen erstehen zu können. Der Blangemer Maad (Blankenheimer Markt), wie die Kirmes auch genannt wurde, war ein Höhepunkt im Jahresablauf an der Oberahr. Zwischen Blangem und Blangemerdörf (Blankenheimerdorf) hat alten Erzählungen zufolge früher eine langdauernde „Fehde“ bestanden, deren Ursache nicht mehr zu ergründen ist, die aber nicht selten in handgreifliche Auseinandersetzungen ausartete. Die Blankenheimer nannten uns Dörfer Wendböggele (Dörfer Windbeutel), wir konterten mit Blangemer Lennerte. Die Lennerte, oft auch Linnerte genannt, waren in Blankenheim ansässige Leinenweber, deren Ruf in der Umgebung nicht unbedingt der beste war, daher das Spottwort. Der Blankenheimer Karnevalsruf ist Blangem Juh Jah.
Blangemer
Unser landläufiger allgemeiner Ausdruck für die Bewohner Blankenheims, die „Blankenheimer“ also. Zumindest bei uns daheim in Nonnenbach hatte das Wort allerdings auch eine weitere Bedeutung. Es gab besonders auf feuchten Grünflächen die Bähnedestele (Wiesendisteln), die nicht selten meterhoch werden und ganz ekelhaft „stechen“ können. Das machte sich beim Heueinfahren für den „Lader“ auf dem Leiterwagen unliebsam bemerkbar, der das angereichte Heu von Hand auf dem Wagen verteilen und in Loore (Lagen) aufschichten musste. Diese Disteln hießen bei uns aus unerfindlichen Gründen Blangemer. Die Stachelgewächse, die natürlich auch als Viehfutter ungeeignet waren, wurden zwar beim Mähen mit der Sense nach Möglichkeit aussortiert, das eine oder andere Stück verblieb jedoch trotzdem im Heu, und beim Hochgabeln auf den Heuwagen warnte Ohm Mattes vorsichtshalber den Lader: Paß op, do sin noch jät Blangemer dren (Vorsicht, da sind noch ein paar Blankenheimer drin). Heute (im Jahr 2015) sind Blangem und Blangemerdörf durch die Bebauung im Schladerberg bereits zu einer Einheit zusammengewachsen, die Dörfer werden unterdessen niemals Blangemer werden, ebenso wenig wie die Lennerte sich den Wendböggele anschließen dürften. Das drückt sich unter anderem auch im Dialekt aus: Strenge Winterkälte beschreiben die Blangemer mit et es spetz (es ist spitz), bei uns im Dörf heißt das dagegen zumindest bei der älteren Generation et os spotz.
Bläu
Mundartwort für „Bläue,“ abgeleitet vom französischen „bleu“ (blau), speziell angewandt für „Wäscheblau.“ Als Kind begriff ich nicht, warum Mam beim Waschen stets eine kleine Portion Bläu in den letzten Spülgang tat, sie kannte genau die erforderliche Menge, die sich am Gewicht der Wäsche orientierte. Bläu kaufte man beim Dorfkrämer, ein Achtelpfund reichte eine halbe Ewigkeit. In vielen dörflichen Allerweltsläden gab es früher ein Holzregal, dessen diverse Schubladen alle gängigen Trockenfarben enthielten, darunter neben Ocker, Moosgrün und Umbra auch Bläu, die Verkaufsmengen wurden nach Gramm berechnet. Bläu wird auch heute in der modernen Waschmittelindustrie als Weißmacher verwendet, im Chemieunterricht lernten wir, warum das so ist. Als es nach dem Krieg keine Seife gab, wurde daheim sogar mit fein gesiebter Holzasche aus dem Küchenherd gewaschen. In Vaters Werkstatt gab es eine kleine, dicht verschließbare Holzkiste, in der er einen mäßigen Vorrat der gängigsten Trockenfarben verwahrte. Unter den diversen Dosen und Gläsern gab es auch ein Tütchen mit Bläu – bis heute weiß ich nicht, wann und wo Vater jemals Bläu gebraucht hätte. Das dreieckige Tütchen wurde hundertmal in der Kiste hin und her geschoben, platzte schließlich auf und verstreute seinen Inhalt. Das war äußerst unangenehm, mit Bläu verschmierte Finger nämlich waren nur durch intensives Schrubben – und auch dann nur notdürftig, sauber zu kriegen. Bläu haftete an der Haut wie die Fliege auf dem Leimstreifen.
Blaulenge (weiches e)
Blaulenge heißt auf Hochdeutsch „Blauleinen“ und bezeichnet den Arbeitsanzug aus blauem Leinenstoff, heute allgemein als „Blaumann“ bekannt. Der Blaulenge war früher wie heute aus strapazierfähigem Leinen gefertigt (Lenge = Leinen) und d i e Arbeitskleidung des Kleinen Mannes schlechthin, wobei Blau die dominierende Farbe war. Aber auch der grüne Overall oder die schwarze Jacke und Hose, wie sie beispielsweise bei den Rottenarbeitern der Bundesbahn üblich waren, fielen unter die Kategorie Blaulenge. Alternativ gab es vielfach die Manschesterbotz (Manchesterhose = Cordhose), die ob ihrer Strapazierfähigkeit gleichermaßen beliebt war. Ich weiß noch, dass Ohm Mattes (mein Onkel) im Alltag ausschließlich Manchesterbotze trug, einen Blaulenge besaß er gar nicht. Es war 1986 im Krankenhaus Mechernich, ich wurde zum Labor beordert und marschierte im hellblauen Pyjama durch den Flur. Just zu diesem Zeitpunkt besuchte mich mein Kollege Werner, fand mich nicht im Zimmer und fragte meinen Zimmernachbarn Wellem (Wilhelm) nach meinem Verbleib. Wellem war mir auf meinem Weg ins Labor begegnet und erklärte, ich sei an die Heizung gerufen worden, er habe mich eben im Blaulenge auf dem Flur gesehen.
Blausteff (weiches e)
Ein Schreibmittel früherer Jahre: der Blaustift, wegen seiner Dokumentenechtheit auch „Kopierstift“ genannt. Zum Schreiben feuchtete man üblicherweise die Spitze ein wenig an. Dadurch wurde die Farbe kräftiger, allerdings hinterließ die Prozedur auch deutliche dunkelviolette Spuren an Lippen und Zunge, die nur schwer zu beseitigen waren. Die Kopierstiftminen waren dem Vernehmen nach gesundheitsschädlich, Blaustifte waren bei uns in der Schule nicht zugelassen. Im Gegensatz zum Bleistift, lässt sich Blaustiftschrift nicht ausradieren, zumindest nicht ohne Beschädigung des Papiers. Noch in den 1960er Jahren führte bei der Iesebahn (Eisenbahn) der Fahrdienstleiter sein Zugmeldebuch mit Blaustift, aus Sicherheitsgründen: Ein einmal gemachter Eintrag konnte nicht wieder unsichtbar gemacht werden, und das konnte in bestimmten Fällen von Bedeutung sein. Später wurde der Kugelschreiber zugelassen, der ja auch dokumentenecht ist. In Vaters Schreinerwerkstatt gab es stets zwei Schreibstifte: Den dicken Schrengersteff (Schreinerstift) zum Anreißen der Werkstücke, und einen Blausteff für Einträge in die Arbeitsunterlagen.
nach oben
Blejch
Was heutzutage moderne Waschmittel „in einem Aufwaschen“ in der Maschine erledigen, bedurfte früher vieler Stunden und guter Witterung: Das Bleichen der Wäsche. Eine „Grasbleiche“ etwa im Garten ist heute nicht mehr erforderlich und angesichts von Straßenverkehr und Luftverschmutzung wohl auch nicht mehr ratsam. Früher warnte Mam uns Kinder: Blievt mir vam Peisch, do litt de Weisch op dr Blejch (Bleibt mir von der Wiese vor dem Haus, da liegt die Wäsche auf der Bleiche). Die mit einer Lauge aus Holzasche behandelte Wäsche wurde durch die Einwirkung des Sonnenlichts tatsächlich weiß wie der Schnee. Unsere Hühner hatten daheim freien Auslauf und manchmal zeterte Mutter: De Hohner sin ad wier öwwer de Blejch jeloufe, was naturgemäß äußerst ärgerlich war. Neben der Blejch kannten wir unterdessen auch das Mundartwort Bleich, damit war aber das hochdeutsche „Blech“ gemeint. Das Eigenschaftswort „bleich“ wurde meistens mit „blass“ umschrieben. Moderne Weißmacher in der Waschmaschine greifen nicht selten das Gewebe an. Das war bei Großmutters Jrasblejch (Rasenbleiche) nicht der Fall (siehe auch Bläu).
Blooder (hartes o)
Himmel Dunnerkiel, wetterte Pap (Vater) und schlenkerte heftig die linke Hand, dat jitt en Blooder! Der Hammer war vom Nagel abgerutscht und hatte den Zeigefinger gestreift. Das schadenfrohe Grinsen verging mir auf der Stelle: Vaters hammerbewehrte Rechte vollführte eine ausholende Bewegung und ich ging blitzschnell hinter dem Mäuerchen in Deckung. Blooder war unser Wort für die schmerzhafte Blutblase, die man sich meistens durch Unachtsamkeit selber zufügt. Mam, ech han mir jrad dr Fonger jepetsch (den Finger gequetscht), heulte Hännesje. Mam drückte rasch die kalte Klinge des Brotmessers auf die entstehende Blooder. Das tat zwar jämmerlich weh, sollte aber wenigstens zum Teil das Ansammeln von Blut verhindern und damit eine dicke und lästige Blooder gar nicht erst aufkommen lassen. Eine solche „Behandlung“ kam unterdessen meistens zu spät, weil sich die Blase bereits mit Blut gefüllt hatte. Äußerst schmerzhaft war auch die Blooder, die man sich häufig bei neuem und noch nicht „eingelaufenem“ Schuhwerk an den Füßen zuzog.
Blöötz (hartes ö)
Einen heftigen Aufschrei bezeichnet der Eifeler als Blöötz oder regional auch als Bröll, beispielsweise Hä doot ene Bröll on koom op mech aan (Mit einem Wutschrei griff er mich an). Der Blöötz ist eigentlich eher ein Ausdruck des Erschreckens oder der Angst: Hä doot ene Blöötz on jing stifte (Er schrie auf und ergriff die Flucht). Wenn auf der Baustelle der Polier herum schrie und wetterte, hieß es hinter vorgehaltener Hand Jung, dä hät äwwer noch ens en Blöötzerej am Liev (…eine Brüllerei am Leib). Das Zeitwort blöötze kommt ebenfalls ziemlich häufig zur Anwendung, es bezeichnet unter anderem auch Kindergeschrei oder lautes Weinen: Hüer op ze blöötze oder et jitt Uhrwatsche (Hör auf zu schreien oder es setzt Ohrfeigen). Mit Blöötz mech net esu aan verwahrt man sich gegen das Anschreien, und wer unnötig herum brüllt, macht sich als Blöötzpitter unbeliebt. Ein solcher Mensch wird gelegentlich auch Brölles genannt. Es gibt ein paar Redewendungen: Wä blöötz hät Onräech (Wer schreit ist im Unrecht), Mot Blöötze erreich mr nix (Schreien führt zu nichts) oder auch Blöötze wie en Kooh (Brüllen wie ein Kuh).
Böggel (weiches ö)
Im Kölner Karneval finden sich Liedtexte wie „…dä ejne hät dr Büggel, dä andere et Jeld“ oder auch „…nix em Büggel, äwwer all joot drop.“ Der Kölsche Büggel ist der Eifeler Böggel, beide bezeichnen denselben Gegenstand, nämlich den Beutel, und hierbei in erster Linie den Jeldböggel (Geldbeutel). Der Klingelböggel ist der bekannte Sammelbehälter für Opfergaben vornehmlich in den Kirchen. Die Dörfer Senioren allerdings erinnern sich noch an den alten Herrn Nikolaus Brück, den Dörfer Kirchenrendanten, der bei der Opferung in der Kirche das Körfje (offenes flaches Körbchen) von Bank zu Bank reichte. Der Klingelbeutel war bei uns nicht üblich. Vom Jeldböggel hergeleitet ist der Kniesböggel, unser Wort für den Geizhals, den wir oft auch als Kniesuhr (Geizohr) bezeichnen. Aale Böggel ist eine fast schon beleidigende Bezeichnung für einen älteren Mann. Ohm Mattes fertigte sich aus einer Schweinsblase einen Tabaksbeutel und schwor, dass es keinen besseren Tubaksböggel gäbe als die Söüsbloos. Der Halsabschneider oder Taschendieb ist ein Böggelschnegger (Beutelschneider) und der Angeber oder Prahlhans ist ein Stronzböggel. Einen leichtfertigen Luftikus nannte man in Blankenheimerdorf Wondböggel (Windbeutel), und die Verpflegung für unterwegs wurde und wird im Bruëtböggel (Brotbeutel) mitgeführt.
Bolzaasch
Der heute unbekannte seltsame Ausdruck wurde stets in Verbindung mit schlohn (schlagen) gebraucht, beispielsweise Ech langen dir ejne, datste Bolzaasch schlejs (Ich verpasse dir eine, dass du dich überschlägst). Bolzaasch könnte man mit „Rundumschlag“ übersetzen, mit „Radschlag“ oder besser noch mit „Purzelbaum.“ Allerdings gab es für den Purzelbaum auch die Bezeichnung Kuckeleboum. Die Herkunft von Bolzaasch kann nur vermutet werden: „Bol“ ist das holländische Wort für Ball, wer Bolzaasch (Bolsaasch?) schlug, rollte wie ein Ball mit Kopf und Hinterteil sich überschlagend über die Erde. Für diese „Ball-Bol-Version“ spricht auch der frühere Ausdruck bolzen als Umschreibung für das Balltreten beim Fußballspiel: Losse mir jät bolze john (Lasst uns ein wenig Fußball spielen). Zum Bolzaasch schlohn trafen wir Pänz uns mit Gleichaltrigen auf der leicht abfallenden Wiese hinter unserem Haus im Bongert. Wer die meisten Purzelbäume schlug und damit die längste Bolzaaschbahn erreichte, der war Sieger und wurde mit einem Apfel belohnt, den wir mit oder ohne – meist ohne – Erlaubnis der Eltern vom eigenen Baum „naschten.“
Bolzeblader
Die wörtliche Übersetzung lautet „Bolzenblätter.“ Das war unser Wort für ungewöhnlich große, rundliche und besonders auch hufeisenförmige Pflanzenblätter. Ein markantes Beispiel sind die bis zu 40 Zentimeter breiten Blätter der Gemeinen Pestwurz, die vorwiegend an Gewässern gedeiht und auch bei uns an der Ahr und ihren Nebenbächen zu finden ist. Diese Bolzeblader waren manchmal größer als wir Pänz und dienten uns als Versteck beim Söökespelle (Suchenspielen = Versteckspiel). Eine andere Art von Bolzeblader war der Huflattich, dessen Blätter aber kleiner sind als die der Pestwurz. Die kleinen gelben Blüten des Huflattichs sind bei uns bereits im Februar erste Frühlingsboten, die großen Blätter entwickeln sich erst nach dem Abblühen. Im Krieg mussten wir Schulkinder Heilkräuter sammeln, und dazu zählten unter anderem auch die Huflattichblätter, die ein altes Heilmittel gegen Husten sind. Interessanterweise fiel der Rhabarber, trotz seiner riesenhaften Blätter, nicht unter die Kategorie Bolzeblader. Als Kind konnte ich lange Zeit das Wort Bolzeblader nicht richtig aussprechen und änderte es in Bonzeblader ab, was unsere Jött beinahe zur Verzweiflung trieb.
Bönnbrett (weiches ö)
Ein Fußboden aus Holzdielen war bei unseren Eltern ein Jebönn, daheim in Nonnenbach sagten wir Jebünn. Der Ausdruck ist möglicherweise von dem Verb bonne oder benne hergeleitet, was „binden“ bedeutet: Beim Jebönn sind viele Einzelbretter miteinander verbunden. Eine einzelne Diele war somit ein Bönnbrett. Gängiges Bönnmatrial (Material) waren zehn Zentimeter breite Fichtenbretter mit angefräster Nut on Fedder (Nut und Feder). Zum fugenfreien Verlegen mussten die Bretter entsprechend aneinander gefügt werden. Hierfür gab es so genannte Dielenpressen, die durch Hebelwirkung einen enormen Pressdruck erzeugten. Gewöhnlich musste ich meinem Vater beim Verlegen von Fußböden zur Hand gehen. Eine Dielenpresse besaßen wir nicht, wir behalfen uns auf althergebrachte Weise mit „Bauklammern“ und Holzkeilen. Die echten Eifeler Bönnbredder aus der Zeit unserer Eltern waren aus unverwüstlichem Eichenholz geschnitten. Sie waren unterschiedlich breit, besaßen weder Nut noch Feder und waren kaum fugenlos aneinander zu fügen.
Bonnezupp (weiches o)
In den südlichen Ortschaften unserer Gemeinde Blankenheim heißt das Suppengericht überwiegend Bunnezupp. Bohnensuppe, wie sie zu meiner Kinderzeit daheim auf den Mittagstisch kam, mit einfachen Mitteln aus der Eigenproduktion hergestellt, - hmmh! Bei uns daheim wurde die Suppe mit Milch angemacht, wie übrigens alle Gemüsespeisen. Unsere Jött tat auch eine gute Portion gekochte und durch die Wuëschmaschin (Wurstmaschine = handbedienter Fleischwolf) gedrehte Schweineschwarte hinzu. Das ergab eine ganz spezielle Geschmacksnote und außerdem konnte dadurch an Fleisch- oder Wurstzutaten gespart werden. Trotz ihres Wohlgeschmacks war die Bonnezupp bei mir persönlich weniger beliebt, wegen der zähen Fäddem (Fäden), die trotz sorgfältigen Putzens beim Schnippeln manchmal übersehen wurden. Bonne fitsche war anfangs noch eine langwierige Handarbeit mit dem Küchenmesser, später gab es ein mechanisches Fitschmaschinchen. Wie alle Hülsenfrüchte, so fördert auch die Bohnenmahlzeit die Aktivität unserer Verdauungsorgane, und so gab es bei uns den weisen Spruch: Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen.
Booch
Aus dem standardsprachlichen „Buch“ wird in unserem Dialekt das klangverwandte Booch. Dessen Mehrzahl waren früher die Boocher (Bücher), die unterdessen inzwischen aus der Mode gekommen sind und dem moderneren Bööcher Platz gemacht haben. Den Senioren von Blankenheimerdorf ist noch gut das Boocherstöffje (Bücherstübchen) im Turmzimmer hinter der Orgel in Erinnerung, wo sonntags nach dem Hochamt die Leseratten aus dem Ort sich unter Aufsicht des alten Herrn Nikolaus Brück aus der kleinen Borromäus-Bücherei ihre Wochenlektüre auswählten. Für uns Schollpänz (Schulkinder) war das Lessebooch (Lesebuch) von Bedeutung, das uns in altersmäßig orientierter Ausstattung durch alle acht Volksschuljahre begleitete und sowohl spannende als auch lehrreiche Geschichten und Gedichte enthielt. Dass es nebenbei auch ein wenig „bräunlich“ gefärbt war, lag an der damaligen Zeit, war im Übrigen aber für uns Pänz ziemlich belanglos. Ein wichtiges Geschenk zur Erstkommunion war das Jebettbooch (Gebetbuch), auf dessen Vorsatz der Besitzer seinen Namen schrieb und das man beim sonntäglichen Kirchenbesuch unter allen Umständen mitzuführen hatte. Damals wie heute war das Sparbooch eines der wichtigsten Bücher, nur besaß längst nicht jeder Eifeler eins: Die wenigen vorhandenen Groschen brauchte man zum Leben, fürs Sparen blieb da wenig übrig. Von einem unzufriedenen Griesgram hieß es: Dä määch e Jesiëch wie e Booch mot leddije Blader (Der macht ein Gesicht wie ein Buch mit leeren Blättern).
Bööch
Vor den Eichen sollst du weichen, doch die Buchen sollst du suchen. Viele von uns kennen noch diese uralte Faustregel zum Verhalten im Freien beim Gewitter. Die Experten haben längst herausgefunden, dass diese „Regel“ jeder Grundlage entbehrt. Unserem Haus direkt gegenüber stand daheim in der Hardt eine hundertjährige Buche, an deren Stamm der Blitz von halber Höhe bis in die Wurzeln eine breite, schwarz und braun verbrannte Spur gezogen hatte. Der Baum hieß bei uns de Bletzbööch (die Blitzbuche), wir Kinder waren von den Erwachsenen angewiesen, beim Gewitter von allen Bäumen möglichst weit weg zu bleiben und besser unter Gebüsch zu kriechen. Die Buche, ganz allgemein die Rotbuche, heißt bei uns Bööch, und das ist direkt mit dem Niederländischen beuk verwandt, das nämlich wird böök gesprochen. Der Bööchebösch ist der Buchenwald, und der Bööcheboum ist der Buchenbaum. In der Volksschule bei Josef Gottschalk lernten wir ein Gedicht: „Die Gäste der Buche,“ ich kann es heute noch auswendig. Der Anfang: „Mietegäste vier im Haus hat die alte Buche; tief im Keller wohnt die Maus, nagt am Hungertuche…“ Im ersten Stock wohnte das Eichhörnchen, darüber der Specht und oben im Wipfel pfiff „ein winzig kleiner Musikante froh im Nest,“ der Verfasser kam zu dem Schluss: „Miete zahlt nicht einer.“ Bööcheholz ist hart, elastisch und bruchfest, läßt sich hervorragend bearbeiten oder zu Furnierplatten schälen und ist somit in der Holzindustrie, besonders im Möbelbau und beim Stellmacher, sehr beliebt, auch als Heiz- und Brennholz hat es einen hohen Stellenwert. Die Bööch wurde früher „mit Stumpf und Stiel“ verwertet: Der astfreie Stamm war Industrie- oder Nutzholz, die Krone und das starke Geäst kam zum Brennholz, das dünne Astwerk und Reisig wurde zu armlangen Schanzen gebündelt, zum Stochen des Hausbackofens. Bis in die 1970-er Jahre gab es bei uns zwei markante, etwa 300-jährige Buchen, die irgendwann vom Eifelsturm gefällt wurden: Den Bilderboum auf der Nonnenbacher Hardt, und den Kindches- oder Üüleboum am Nordrand von Olbrück bei Blankenheimerdorf. Eine dritte markante, naturgeschützte und weithin bekannte Bööch ist heute noch die Süntelbuche im Flurbereich Katzekuhl an der Kreisstraße K70 nach Nonnenbach. Mit ihren bis zur Erde hängenden Ästen ist die Buche ein wahres Naturwunder.
Booch drohn (hartes o)
Ein Ausdruck aus unserer Messdienerzeit unter Dechant Hermann Lux, der von 1936 bis 1952 Seelsorger in Blankenheimerdorf war. Et Booch drohn (Das Buch tragen) war ein fester Begriff und bezog sich auf das Umtragen des gewichtigen Messbuches von der Epistelseite des Altars (rechte Seite) zur Evangelienseite und umgekehrt. Wie der Altar, so war auch das Kirchenschiff geordnet: Rechts war die Mannslöckssit (Männerseite), links die Fraulöckssit (Frauenseite). Diese Ordnung wurde früher von den Kirchenbesuchern streng eingehalten. Dechant Lux legte größten Wert auf akkuraten Altardienst, wir Messdiener wurden geschult und gedrillt bis zum Gehtnichtmehr. Beim Booch drohn hatte man als Altarneuling einige Probleme: Man trug das große Messbuch samt Lesepult vor dem Bauch, konnte also nicht vor sich auf den Boden schauen und musste trotzdem die Altarstufen bewältigen. Da half nur intensives „Training“ vor dem ersten Diensteinsatz. Später talpte man die Stufen mit geschlossenen Augen. Das damals noch gebräuchliche mundartliche drohn für „tragen“ ist inzwischen längst durch das lautmäßig treffendere drare ersetzt worden.
Bookert (hartes o)
Das Wort bezeichnete die Vogelscheuche und war möglicherweise vom holländischen „bok“ abgeleitet, was „Bock“ bedeutet. Ein anderes Wort für die aus Holzlatten und alten Kleidern gebastelte menschenähnliche Figur ist Möscheschreck (Spatzenschreck). Die Vogelscheuche steht starr und unbeweglich auf ihrem Platz, daraus leitete man früher die Bezeichnung Bookert für einen starrköpfigen Menschen ab. Das hölzerne „Gerippe“ der Scheuche war mit alten und zerlumpten Kleidungsstücken behangen, daraus entstand die Redewendung zerlomp wie ene Bookert (zerlumpt wie eine Vogelscheuche). Die Wirksamkeit der Scheuche war ziemlich begrenzt, weil sich die Tiere sehr schnell an den „Fremdling“ gewöhnten. Das traf auch auf die Wildschweine zu, die in den Nachkriegsjahren in Scharen die Eifelwälder bevölkerten und nächtlicherweile die Kartoffelfelder der Bauern umpflügten. Der Bookert konnte sie nicht erschrecken, den warfen sie einfach um, auch wenn die Lumpen mit Menschengeruch aus dem „Herzhäuschen“ behaftet waren. Mit Karbid betriebene automatische Schreckschussanlagen waren da schon wirksamer, doch wurden diese Geräte bald aus dem Verkehr gezogen. Enorm wirksam, aber auch lebensgefährlich für den Menschen, waren schließlich die selbstgebauten Elektrozäune, die 220 Volt Netzspannung führten.
Böschbreefje
Das „Waldbriefchen,“ ein Begriff aus der Zeit, als es im Eifelhaus noch keine Heizung gab und die Leute sich mit dem gusseisernen Kanonenofen und dem Küchenherd „durch den Winter stochten.“ Heizmaterial war naturgemäß Holz, das man im eigenen Wald schlug oder bei der Gemeinde bestellte. Das ist auch heute noch (2015) längst nicht aus der Mode, Brennholz nämlich ist immer noch ein kostengünstiger und somit in einschlägigen Kreisen beliebter Heizstoff. Die Gemeinde Blankenheim verkauft beispielsweise alljährlich noch Brennholz an einen mehr oder weniger festen Kundenkreis. Die benötigte Menge in Festmetern wird im Spätherbst angemeldet, im Winter geschlagen und im Frühjahr als Stammholz gerückt am Waldweg zum Abfahren bereitgestellt. Früher wurde das Holz auf Meterlängen geschnitten und in Raummetermengen verkauft (Klafterholz). Die Vergabe der einzelnen Klafter geschah in Form einer Verlosung, bei der die Kunden ihr Böschbreefje in Empfang nahmen. (Siehe auch Holzbreefjer). Noch nach dem Krieg bezogen viele Eifeler von ihrer Gemeinde das so genannte Deputatholz, – lebenslang jährlich zwei Raummeter kostenloses Brennholz, für das sie sich mit einem bestimmten Betrag bei der Gemeinde „eingekauft“ hatten.
Botterfass (weiches o)
Ein Gerät, das in seiner ursprünglichen Form heute allerhöchstens noch für Präsentationszwecke hergestellt wird: Das Butterfass, der Vorläufer der modernen Butterungsmaschine in der Molkerei. Ein Botterfass gab es früher in jedem Eifelhaus, ich selber besitze noch eine dieser plumpen Holzkonstruktionen, deren Drehflügel ich als Kind bis zur Verzweiflung habe bedienen müssen. Dabei sang man gewöhnlich ein Kinderliedchen vor sich hin, um im Takt zu bleiben: Rääne rääne Tröppche, fall net op me Köppche, fall net op me Botterfass, sons wiëd de Botter van oëwe nass, - der Regen möge also nicht aufs Köpfchen und auch nicht aufs Butterfass fallen, weil sonst die Butter „von oben nass“ würde. Es gab die unterschiedlichsten Bauarten und Funktionen fürs Buttermachen, Geräte zu Drehen, Schlagen, Stampfen und Rühren. In jedem Fall musste der Rahm so lange „behandelt“ werden, bis sich das Butterkorn bildete und die Buttermilch sich absetzte. Das konnte je nach Witterung langwierig werden, bei bevorstehendem Gewitter beispielsweise dauerte es oft Ewigkeiten. Übrigens Buttermilch: Ich habe das säuerliche Schlabberwässerchen nie gemocht und verschmähe es auch heute noch. Mein Vater Heinrich hat als junger Bursche längere Zeit in der Schreinerei der Escher Mühle bei Jünkerath gearbeitet, wo Meister Josef Reiferscheid damals als Botterfass-Fachmann galt. Diese recht umfangreiche Kunst hat Vater nie so ganz erlernt. Als später einer seiner Kunden ein Butterfass orderte, ließ er seinerseits das Gerät in der Eischer Müll anfertigen, zumal dabei auch ein spezieller Metallbeschlag erforderlich war. Im Krieg war das private Buttermachen verboten, die Zubehörteile der Geräte – bei unserem Botterfass die Drehflügel – wurden beschlagnahmt, ebenso die Entrahmungstrommel der handbedienten Zentrifuge. Trotzdem butterten die Leute weiter: Der Rahm wurde durch natürliches Absetzen auf den Melechpött (Milchtöpfe, meistens Keramikgefäße) gewonnen, die Butter wurde mit dem Briebeißem (Breibesen, handlicher Quirl aus geschälten Weiden- oder Haselruten) gerührt und ins Geheimversteck gebracht.
Botzebröck (weiches o)
Die Botzebröck ist eins von insgesamt fünf Brückenbauwerken der ehemaligen Ahrtalbahn auf Blankenheimerdorfer Hoheitsgebiet. Die Bogenbrücke im Bereich Eisenkaul ist stillgelegt, das Viadukt über die Ortsdurchfahrt ist längst abgerissen worden. Noch in Betrieb sind die Weiherberg-, die Schossen- und die Hohentalbrücke, die alle drei den bis zu 25 Meter tiefen Einschnitt in Richtung Blankenheim überqueren. Die Schossenbrücke wird unter dieser Bezeichnung in den amtlichen Unterlagen geführt, im Volksmund heißt sie allgemein Schaussebröck, überwiegend aber Botzebröck in Anlehnung an den hier üblichen Flurnamen Om Botze (auf dem Botzen), wobei die Formulierung Botze nicht zu deuten ist. Über die Weiherberg- und Schossenbrücke führen Hauptwirtschaftswege in nördlicher Richtung, die Hohentalbrücke verbindet einen Wirtschaftsweg mit dem verlängerten Dörfer Weg in der ehemaligen belgischen Siedlung. Um 2008 sollte die Schossenbrücke wegen baulicher Mängel abgerissen und der Verkehr im Bereich der Weiherbergbrücke über die Bahntrasse geführt werden. Dabei hätte im Ort auch die eng bebaute Ovverbaach in Anspruch genommen werden müssen, das Teilstück des Kippelberg vom ehemaligen Transformator bis auf die Ortsdurchfahrt. Für die Schwerfahrzeuge der beiden Aussiedlerhöfe hätte sich das nachteilig auswirken müssen, nicht zuletzt auch etwa für Feuerwehr oder andere Hilfsfahrzeuge. Im Dorf hagelte es Proteste gegen den Abriss der Schossenbrücke, eine Bürgerinitiative wurde ins Leben gerufen, die letztendlich auch erfolgreich agierte: Die Brücke blieb erhalten und wurde grundlegend restauriert, heute ist sie ein Schmuckstück. Noch gut in Erinnerung ist das Brückenfest vom 20. August 2010 anlässlich der Wiederinbetriebnahme der Botzebröck.
Botzendresser (weiches o und e)
Auf den ersten Blick scheint es sich hier um ein etwas „anrüchiges“ oder sogar unanständiges Wort zu handeln, heißt es doch übersetzt Hosenscheisser. Der Eifeler Botzendresser ist unterdessen eine ganz und gar alltägliche Erscheinung, das Wort gehört einfach zu unserem Wortschatz, es beschreibt und konkretisiert Situationen, die wir ohne den Botzendresser nicht halb so „treffend“ auszumalen vermöchten. Der Botzendresser ist in erster Linie ein Angsthase, ein Feigling und Drückeberger, der sich vor lauter Angst en de Botz määch (in die Hose macht). Das ist besonders bei Kindern eine sehr natürliche Körperreaktion in bedrohlichen Situationen, verschont aber auch den Erwachsenen nicht. Ein erfahrener Frontkämpfer hat mir einmal freimütig erzählt, dass er nach einem schweren Angriff de Botz voll hatte (siehe Schladerbotz). Als Kinder wurden wir tagtäglich als Botzendresser eingestuft, wer beispielsweise Angst vor dem Hund hatte oder wer nicht allein in den Keller ging, war kurzerhand ein Botzendresser. Für derartige Fälle kannten wir damals noch ein weiteres Wort: Bangbotz, was wörtlich „Angsthose“ bedeutete. Als im Januar 1945 ein amerikanisches Jagdflugzeug auf uns drei Geschwister beim Schlittenfahren schoss, machte die Todesangst echte Botzendresser aus uns. Ob auch der mit uns rodelnde deutsche Soldat anschließend seine Unterwäsche wechseln musste, entzieht sich meiner Kenntnis. Als seinerzeit Ewe Hein uns verfolgte, einen Strick schwang und mich ophange (aufhängen) wollte, wurde ich ebenfalls zum Botzendresser im Sinne des Wortes (siehe Kluuster). Meine Angst vor Hein war größer als die vor dem Ami-Jabo.
Botzepetsch (weiches o und e)
Die Botz ist bekanntlich der allenthalben übliche Ausdruck für „Hose,“ die Petsch war und ist unser Wort für „Klammer,“ die Botzepetsch ist somit eine „Hosenklammer“ und war zu Zeiten des Fahrrads als Fortbewegungsmittel des Kleinen Mannes, ein ungemein nützliches Instrument. An Opas Drahtesel waren Tretrad und Antriebskette nicht verkleidet, einen Kettenschutz gab es nur am Damenfahrrad, an dessen Hinterrad auch das „Fahrradnetz“ dafür sorgte, dass die langen Röcke der Fahrerin nicht in die Speichen gerieten. Zu meiner Jugendzeit nach dem Krieg, waren lange Hosen mit möglichst weiten Beinkleidern modern, die am unteren Rand mit einem breiten „Aufschlag“ ausgestattet waren. Auf den legte der Träger besonderen Wert, obwohl er manchem Radfahrer zum Verhängnis wurde: Der breite Hosenrand geriet zwischen Zahnrad und Kette, nicht selten kam es zum Sturz. Außerdem war der schöne Hosenaufschlag durch Kettenfett „versaut,“ manchmal stanzten sogar die Tretradzähne Löcher in den Hosenstoff, und dann stürzte beinahe die Welt ein. Dem abzuhelfen, war Sinn und Zweck der Botzepetsch, indem sie den Hosenrand stramm um das Bein spannte und somit vor dem Kettenrad bewahrte.
Bouklötz
Zu unserer Kinderzeit war Bouklötz staune eine gängige Formulierung für eine ungewöhnliche Überraschung oder großes Erstaunen. Beispielsweise staunten wir Kinder an Heiligabend Bouklötz beim Anblick des strahlenden Lichterbaums, unter dessen ausladenden Zweigen sich gar nicht so selten echte Bouklötz versteckten: Ein Holzbaukasten für mich aus Vaters Schreinerwerkstatt. Das war beinahe die Regel: Jedes Jahr bastelte Vater einen neuen Baukasten, mit mehr Bouklötzen als im Vorjahr und nach Möglichkeit auch „feiner“ lackiert. Die Fabrikfarben der eventuell gekauften Kästen nämlich waren von Hand nicht zufriedenstellend zu ersetzen. Auch die bei der Fabrikware üblichen bunten Deckelbilder – in der Regel Bauvorlagen – fehlten naturgemäß bei Vaters „Eigenbau.“ Trotzdem war dieser beliebt: Die Kästen konnten nach Größe und Inhalt beliebig gestaltet werden, die Fabrikkästen dagegen waren genormt. Gelegentlich fabrizierten Vaters Kunden in der Adventszeit in unserer Werkstatt selber Baukästen für den Weihnachtstisch, an einen ganz speziellen Bastler erinnere ich mich noch genau. Das Kastengehäuse hatte Vater fachmännisch hergestellt, mit gezinkten Eckverbindungen und Schiebedeckel, die Bouklötz sägte, raspelte und hobelte sich der Mann selber zurecht und passte deren Abmessungen einfach dem Platz im Kasten an, auf Paarigkeit der Bauteile legte er keinen Wert. Dieser Boukste war mit Sicherheit ein Unikat. Weihnachten 1941 bekam ich vom Christkind einen Holzbaukasten „Matador 3“ geschenkt, Vater hatte ihn in Brüssel gekauft, er war dort dienstverpflichtet. Das waren nun original genormte „Korbuly“-Fertigteile aus astfreiem glattem Natur-Buchenholz mit Steckverbindungen und zugehörigem Werkzeug. Als dazu noch ein kleiner Elektromotor für den Antrieb der Modellmaschinen kam, hatten die alten Bouklötz endgültig ausgedient.
Brämele
Zu meiner Kinderzeit gab es kaum einen Feld- oder Wirtschaftsweg, keine Böschung und keine Rodungsfläche, die nicht von Brämelshecke eingerahmt gewesen wäre. Die heutige Kreisstraße K.70 beispielsweise, von der Maar (frühere B.51) bis nach Nonnenbach, wies fast durchgehend beiderseits in Graben und Böschungen Brämelshecke auf, heute sind auf der ganzen Strecke gerade noch drei kümmerliche Areale vorhanden, die nur noch ebenso kümmerliche Früchte hervorbringen. Brämele, regional auch Bromele oder Brömele genannt, das sind die Brombeeren, deren schwarz-blaue Früchte den Himbeeren ähneln und von uns Kindern früher für schwazz Ombere (schwarze Himbeeren) gehalten wurden. Brämele sind nicht weniger köstlich als ihre roten Schwestern, Brämelsschelee und Brämelssaff (Gelee und Saft) waren und sind für den Kenner ein Begriff. Auch in der Medizin finden besonders die Blätter der Pflanze Verwendung beispielsweise als Mittel gegen Durchfall. Im Krieg mussten wir Schulkinder Brämelsblader (Brombeerblätter) als Heilkräuter sammeln, trocknen und in der Schule abliefern. Das war eine höchst unbeliebte Beschäftigung. Zum Sammeln nämlich musste man mitten ins dichte Areal hinein, und das war wegen der meterlangen verfilzten und dornenreichen Ranken mit erheblicher Pein für die Haut von Kinderbeinen verbunden: Blutende Brämelsratsche (Hautrisse) musste man notgedrungen in Kauf nehmen. Trotzdem zogen wir im September, gelegentlich auch noch im Oktober, eimerbewehrt en de Brämele (in die Brombeeren) und sammelten die bis zu gut zwei Zentimeter dicken schwarzen Köstlichkeiten, für eine leckere, kostenlose und sogar gesunde Konfitüre zur Winterszeit. Damals ergab die Strecke an der K.70 entlang von der Maiheck (Flurbezeichnung, dort steht heute das Pumpenhaus der Wasserversorgung) bis Schlemmershof einen ganzen Eimer voll Brämele, heute sind Böschungen und Seitengräben blank, glatt und steril, die wenigen, noch vorhandenen Brämelshecke bringen nur noch grün-rote winzige Früchte hervor, die nicht mehr geerntet werden, weil sie nicht schmecken. Die Ernte an dem längst geteerten Weg mit seinen benzin- und dieselverseuchten Rändern wäre wohl auch nicht mehr anzuraten.
Breichiese
Mit dem Mundartwort für „Eisen“ bildet unsere Oberahr im Vergleich mit der übrigen Eifel offensichtlich eine Ausnahme: Wir sagen Iese, eifelweit und selbst im Kölner Dialekt ist Ieser gebräuchlich. Sogar in Holland sagt man breekijzer. Es gibt unendlich zahlreiche Wortverbindungen mit Iese, anschauliche Beispiele sind unter anderem das Büjeliese (Bügeleisen), die Iesebahn (Eisenbahn), das Iesebett (Bettgestell aus Eisen), die Iesesäëch oder auch die Redewendung zum Altiese zälle (zum alten Eisen zählen). Das Breichiese ist somit ein Brecheisen, ein Werkzeug, das die Hebelwirkung für die Bewältigung großer Kraftleistung ausnutzt. Das Breichiese ist, wie der Name schon sagt, unter anderem ein Werkzeug der Einbrecher. Dieses Werkzeug bezeichnen wir auch als Nääl- oder Nooliese, weil sein Lastarm eine Einkerbung zum Greifen von Nagelköpfen besitzt. Unser Breichiese dagegen ist die Brechstange, vielfach auch Rengel oder Rängel genannt, beispielsweise bei den Rottenarbeitern der Bundesbahn. Die Abmessungen einer solchen Breichstang (Brechstange) richten sich nach dem Einsatzumfang, ein gängiges Breichiese ist etwa 150 Zentimeter lang und wiegt acht bis zehn Kilo. Das eine Ende ist zu einer zentimeterlangen Klaue ausgebildet, am anderen Ende befindet sich eine handbreit auslaufende Spitze. Mit diesem höchst einfachen Werkzeug (Hebel) lassen sich mit geringem Kraftaufwand große Lasten bewegen, das Breichiese war unter anderem für unsere Eltern im Steinbruch unentbehrlich. Unser Breichiese war nach dem Krieg beim Abtragen der Felskuppe vor unserem Haus stark beansprucht worden, Klaue und Spitze waren enorm abgenutzt und stumpf geworden. Josef Friederichs (Else Jüpp) hat mir vor Jahren das Werkzeug wieder frisch „geschärft.“
Briebeißem
Das Wort steht in absolut keinem Zusammenhang mit dem bekannten französischen Weichkäse, sonst nämlich müsste die Übersetzung „Briebesen“ lauten. Sie lautet indessen „Breibesen“ und bezeichnet ein Gerät, das in seiner ursprünglichen Form nicht mehr existiert. Der Briebeißem war früher als Werkzeug zum Anrühren von Milchbrei und ähnlichen Speisen unentbehrlich, es gibt ihn heute noch in moderner Form als Schnee- oder Rührbesen aus Metall. Der Briebeißem unserer Kinderzeit war ein echter kleiner Reisigbesen, etwa 30 Zentimeter lang und drei bis vier Zentimeter dick, den sich die Leute selber herstellten. Als Material dienten dünne, frisch geschälte und damit weiße Hasel- oder Weidenzweige, gelegentlich wurden auch geschmeidige Birkentriebe verwendet. Als natürliche Aufhängevorrichtung ragte aus dem Griffende ein fingerlanges hakenförmiges Zweigstück hervor. Das Rührgerät hatte seinen festen Platz in der Eifeler Küche, bei uns daheim hing der Briebeißem an einem Nagel an der Kopfseite vom Köcheschaaf (Küchenschrank). Als im Krieg die Zentrifugentrommeln und Butterfassflügel requiriert wurden und den Bauern die eigene Butterherstellung verboten war, rührte unsere Jött mit dem Briebeißem im Stejndöppe (Steintopf, Keramikgefäß) Butter an, – eine unendlich mühselige und obendrein damals strafbare Tätigkeit. Die Zentrifuge zum Entrahmen wurde durch mehrere, mit Vollmilch gefüllte Schmanddöppe (Rahmtöpfe) ersetzt, von denen in Abständen der sich absetzende Rahm im Sinne des Wortes abgeschöpft wurde. Als im März 1945 die Amerikaner abgezogen und für uns der Krieg aus war, holten sich die Leute als Erstes ihre Zentrifugentrommeln und Butterfassflügel vom Schulspeicher zurück.
bröhe
Ein Eifeler Wort mit zweifacher Bedeutung. Et Füer bröht schlech (Das Feuer brennt schlecht), ärgerte sich Jannespitter (Johannpeter), weil die Winterluft im Kamin „stand“ und der Küchenherd nicht „zog“. Im Nachbargarten qualmte es mächtig, dort war Köbes (Jakob) Jelöüf am verbröhe (Kartoffellaub am verbrennen), und Höppertche (Hubertchen) kam heulend ins Haus gelaufen: Mam, ech sen en de Bröhneissele jefalle. In die Brennesseln (Brennnesseln, ein Wortungetüm) gefallen, – in der Tat eine recht eklige und „brennende“ Angelegenheit, wie die eigene Erfahrung lehrt. Bröhe war also ein vielgebrauchtes Wort für „brennen“, eine zweite Bedeutung war „brühen“ und die wurde meistens im Sinne von „abbrühen“ verwendet. So war unter anderem bei der Hausschlachtung das Afbröhe (Abbrühen) der Schweineborsten mit kochendem Wasser und Schabglocke eine Alternative zum Senge (Abbrennen). Das Abbrühen wurde überall dort erforderlich, wo ein offenes Strohfeuer nicht möglich war. Das von bröhe hergeleitete Substantiv ist Brööt und damit ist die „Brühe“ gemeint, im positiven wie auch im negativen Sinn. Eine kräftige Hohnerbrööt (Hühnerbrühe) beispielsweise stärkt den Körper, und wenn die Köchin ausnahmsweise einmal de Zupp versalze hat, mault die Tischgemeinschaft: Wat häste dann do für en Brööt fabriziert!
Bröhneissel
Was auf Niederländisch brandnetel heißt, seit ewigen Zeiten im Hochdeutschen Große Brennessel hieß, nach der neuen deutschen Rechtschreibung aber Brennnessel geschrieben wird, das ist in unserer Mundart die Bröhneissel oder auch Bröhnessel. Weil sie praktisch überall wächst, gedeiht und geradezu wuchert, und nicht zuletzt wegen ihrer „Brennkraft“ auf der menschlichen Haut, wird die Pflanze als lästiges Unkraut eingestuft, das überall bekämpft wird. Dass man damit unter anderem vielen unserer schönsten Schmetterlinge das Dasein schwer und mit der Zeit unmöglich macht, übersieht man angelegentlich. Aus der Medizin ist die Bröhneissel gar nicht wegzudenken, die Liste der Anwendungsmöglichkeiten ist umfangreich, ein Tier- und Pflanzenbuch besagt: „Die Brennessel birgt eine ganze Herrgottsapotheke in sich.“ Eine der unzähligen Anwendungen sei erwähnt, weil sie bei unseren Eltern noch üblich war: Der gicht- oder rheumakranke Arm wurde in frische Bröhneissele verpackt. Diese Radikalkur, wiederholt eingesetzt, soll ebenso radikal geholfen haben, heute unterzieht sich kein Mensch mehr einer solchen peinvollen Therapie. Man kann übrigens die Bröhneissel berühren ohne sich zu „verbrennen“: Man streift die Pflanze von der Wurzel aus nach oben zur Spitze hin, dabei bleiben die Brennhaare unversehrt, der Unbedarfte staunt ob solcher „Immunität“ gegen das Bröhneisselsjeff (Brennesselgift). Einmalig ist der Wohlgeschmack der wehrhaften Pflanze, so unwahrscheinlich das dem Unkundigen auch scheinen mag. Kurzes Überbrühen mit heißem Wasser zerstört die Brennhaare und die Bröhneissel wird „lammfromm.“ Die Stengel und Blätter der jungen Pflanze eignen sich hervorragend für die Herstellung von vitamin- und eisenreichem köstlichem Bröhneisselsjemöös (Brennesselgemüse). Der Geschmack ist wild-herb und kräftig. Schmorbraten mit starker brauner Soße zum Bröhneisselsjemöös, - der Kenner leckt sich alle zehn Finger danach. Wer aus Unkenntnis oder Unachtsamkeit unverhofft in Unannehmlichkeiten gerät, der hat sich en de Bröhneissele jesatt (in die Brennesseln gesetzt).
Bröötsch (hartes ö)
Bröötsch war früher das landläufige Wort für Hautausschlag jeglicher Art, im weitesten Sinne auch für Hautschäden oder verkrustete Wunden. Als Schulkinder hatten wir alle naselang en Bröötsch an dr Muul (Ausschlag am Mund), was vermutlich auf mangelhafte Ernährung und Hygiene zurückzuführen war. Meistens entstand die Bröötsch aus den schmerzhaften Herpesbläschen. Der Ausschlag wurde mit ungesalzenem weißem Schweineschmalz behandelt, von dem für solche Zwecke immer ein Döppche (Töpfchen) voll im Köcheschaaf (Küchenschrank) aufbewahrt wurde. Das Schmalz hielt die Haut geschmeidig und verhinderte die Bildung von blutenden Schronne (Schrunden). En Bröötsch an dr Muul war im Volksmund ein Zeichen und die Strafe dafür, dass man schejf jebütz (schief geküsst) hatte oder dem Pastuur an de Jreewe wor (von des Pfarrers Grieben genascht hatte). Bröötsch ist nicht zuletzt unser Wort für Schorf oder Krusten: Die Jromper os bröötschich bedeutet beispielsweise, dass die Kartoffel vom Pilzschorf gezeichnet ist, und die Bröötsch moß vanselever afjohn besagt, dass man den Wundschorf abheilen lassen soll.
bröötschele (hartes ö)
Ein mundartliches Zeitwort, das schon allein vom Klang her seine Bedeutung offenkundig werden lässt. Bröötschele nämlich bedeutet „braten, brutzeln,“ in bestimmtem Zusammenhang auch „basteln, bauen oder zusammenstellen.“ Wat häßte dann höck ens wier Joots jebröötschelt (Was hast du heute mal wieder Gutes gekocht) erkundigte sich Mattes (Matthias) und lüftete vorsichtig den Kochtopfdeckel. Dat wiëschte noch fröh jenooch jewahr (Das erfährst du noch früh genug) ließ ihn Drinche (Katharina) im Ungewissen und klopfte ihm mit dem Rührlöffel auf die Finger. Mattes hatte sich gelegentlich auch beim Frühschoppen verspätet und wurde daheim ziemlich grob empfangen: Mr mööt dech kamesööle! Et janz Eiße os verbröötschelt! Jetz kannste mengetwäje drüch Jrompere köüje (Man sollte dich verprügeln! Das Essen ist total verbrutzelt! Jetzt kannst du meinetwegen trockene Kartoffeln kauen). Bröötschele war auch ein Ausdruck für stümperhafte Arbeit, wer des Öfteren unvollkommene Produkte produzierte, der geriet rasch in den Ruf eines Bröötschelsmanes (Brutzelhermann), den man nur im Notfall mit einer Arbeit beauftragte. Zum ersten Mal versuchte ich mich im Elektrodenschweißen, - ohne jeden Erfolg. Die Elektrode zerschmolz mir unter den Händen, eine Schweißnaht kam aber nicht zustande, nur ein Häufchen Schmelzmasse. Kollege Ludwig, Schweiß-Fachmann, lachte sich krumm: Jetz häßte ad zwei Elektrode verbröötschelt on emmer noch kejn Schwejßnoht zestand jebrääch. Er zeigte mir, wie´s gemacht wurde, die Schweißnaht „lief“ regelrecht unter seinen Händen übers Werkstück. Freilich gab er auch ehrlich zu: Wie ech aanjefangen han, jing et mir net annesch wie dir.
Bross (weiches o)
Da gibt es in unserem Sprachschatz das ziemlich bekannte Zitat von der herannahenden Schwiegermutter: „…siegesbewusst, Haare auf der Brust.“ Und da war Kollege Peter, dem unsere deutsche Rechtschreibung gelegentlich ein paar Schwierigkeiten bereitete. Peter schmetterte also …siegesbewuss, Haare auf der Bruss in den Frühlingsmorgen. Peter war der Überzeugung, Bruss sei das hochdeutsche Wort für die mundartliche Bross, dabei hätte er nur das Endungs-s von Bruss gegen ein t eintauschen müssen, um richtig zu liegen. Von einem Mitmenschen, dessen Lunge nicht so ganz in Ordnung ist, heißt es dä os schwaach op dr Bross (schwach auf der Brust), dasselbe gilt aber auch im übertragenen Sinne für einen „armen Schlucker“ mit „schwacher“ Geldbörse. Wer en Höhnerbross (Hühnerbrust) besitzt, kann sich naturgemäß nicht en de Bross werfe. Trotz aller schwachsinnigen Bestrebungen im Jahr 2018, die Ehe für alle bei uns zu legalisieren, ist dem Kond de Bross jenn (dem Kind die Brust geben) eindeutig ein Privileg der Frau. Mir dejt dr janze Brosskaaste wieh (Brustschmerzen) kann schwere Erkrankungen ankündigen, dagegen sollen manchmal Brosspolever (Brustpulver) oder en Handvoll Brosskamellcher helfen. Ganz clevere Zeitgenossen bevorzugen dagegen ene Ärbel Brosstee (einen Armvoll Brusttee). Das ist die Umschreibung für die Umarmung des weiblichen Oberkörpers, und dass ein solcher Kontakt durchaus stimulierend und sogar „heilend“ zu wirken vermag, ist in Fachkreisen unbestritten.
Bruët
Inbegriff und Sammelbezeichnung für alles, was mit Nahrung, Essen, Hunger, Sattsein oder Wohlergehen in Zusammenhang steht: Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute, - das Gebet spiegelt unseren Alltag wieder: Das Brot ist unser Haupt-Nahrungsmittel, wir verzehren es täglich und werden seiner nie überdrüssig, während uns auserlesene Speisen nach kurzer Zeit „im Hals stehen.“ Ein altes Sprichwort lässt die Bedeutung des Brotes für unser Wohlergehen erkennen: Dä os Bruët jewennt, dä kött wier zeröck (Der ist Brot gewöhnt, der kommt zurück) besagt, dass der Ausreißer zurückkommt, sobald er Hunger verspürt). Und wenn ein Verkaufsartikel besonders gut „läuft,“ stellt man zufrieden fest: Dat jeht fott wie jeschnedde Bruët (Das geht weg wie geschnittenes Brot). Bruëtbacke war im Eifelhaus meistens die Aufgabe der Hausfrau, die in der Teigherstellung ebenso fit war wie in der Bedienung des Backofens. Bei uns daheim wurden im dreiwöchigen Turnus so an die 20 Bruëder (Brote) gebacken, bei vier Erwachsenen und vier immerhungrigen Kindern reichte da so gerade hin. Die Brote wurden im kühlen Keller auf ein leiterähnliches Gestell unter der Decke aufgereiht, sie blieben dort drei Wochen lang absolut genießbar, ohne hart oder trocken zu werden. Das erste Brot einer Ofenfüllung war das Krüzbruët (Kreuzbrot), es wurde auf der Oberseite durch ein Kreuz gekennzeichnet. Bei uns „stach“ unsere Mutter mit dem Finger vier Vertiefungen in Kreuzform in den Brotlaib. beim Anschneiden eines Brotes wurde mit dem Bruëtmetz (Brotmesser) auf der Rückseite ein Kreuz eingeritzt. Beim Anschneiden standen wir Kinder nicht selten in Lauerstellung: Jeder wollte die Kosch (Krustenkuppe) erwischen, die in aller Regel schön braun und hart gebacken war und, dick mit guter Butter bestrichen, als Leckerbissen galt. Unser Bruët wurde aus Roggenmehl hergestellt und war entsprechend grau und fest. Brot aus Weizenmehl gab es kaum: Auf unseren kargen Feldern gedieh der Weizen nicht so recht, Wießbruët (Weißbrot) war bei uns eine Seltenheit.
Bruëtböggel
Der Kölner ist bekannt für seine, in allen Lebenslagen zutreffenden Zitate und Redewendungen. Dä ejne hät dr Büggel, dä andere et Jeld ist beispielsweise eine solche, dem Leben abgelauschte und den Geldbeutel betreffende Weisheit, die sich je nach Standpunkt des Anwenders positiv oder auch weniger günstig auslegen lässt. Diese Weisheit heute noch auf den hier zur Diskussion stehenden Brotbeutel zu übertragen, wäre in unserer Wohlstandsjahrhundert müßig und beinahe schon ein Fauxpas im gesellschaftlichen Leben. Heute ist man nicht mehr auf den Inhalt des Bruëtböggels angewiesen und somit auch nicht „scharf“ darauf. Nur ein paar noch lebende Kriegsveteranen erzählen, wie sie im Keller von Stalingrad gewissenhaft die letzte Brotkante unter sich aufteilten: Zwei Happen für jeden der Vier. Das steinharte Brotende war zwischen gebrauchten Socken und einer Handvoll Maiskörner in Lam- berts Brotbeutel versteckt, - wertvoller als jeder Goldschatz. Vater kam im August 1945 aus dem Krieg heim, am Riemen über der Schulter trug er den blau-grauen Brotbeutel der Luftwaffe, darin seine wenigen Habseligkeiten, unter anderem eine Handvoll Kartoffel-Winzlinge und eine halb verzehrte Koleraw (weiße Rübe), die er irgendwo auf einem Feld „organisiert“ hatte. Vaters Bruëtböggel hat uns noch lange Zeit gute Dienste getan, er wurde erst nach dem Tod seines Besitzers „ausrangiert.“ Gut zwei Jahre lang habe ich den Leinenbeutel werktäglich nach Blankenheimerdorf getragen: Vaters Mittagessen im Mitchen (Essgeschirr, Henkelmann), die beiden Alu-Töpfe und die gerippte rote Thermesflasch (Thermosflasche) passten gerade mal so in den Stoffbehälter. Vater arbeitete in seiner „neuen“ Schreinerwerkstatt, abends transportierte er mich op dr Stang (auf der Rahmenstange) seines Fahrrads heim. Der Bruëtböggel war mir auch in meinen Hütebub- Jahren recht dienlich: In ihm ließen sich bequem all die Utensilien transportieren, die man beim Viehhüten nicht entbehren kann.
Brüning
Den Familiennamen Brüning verbinden wir auf Anhieb mit dem Vornamen Heinrich und denken dabei an den Zentrumspolitiker (1885 bis 1970), der als Reichskanzler (1930 bis 1932) ein Stück deutscher Geschichte geschrieben hat. In Blankenheimerdorf gab es ebenfalls einen Brüning, der hieß aber mit gut bürgerlichem Namen Peter Friederichs und wurde ob seiner frappanten Ähnlichkeit mit dem erwähnten Politiker, allgemein eben Brüning genannt. Nach seinem Elternhaus hieß er eigentlich ortsüblich Klobbe Pitter, dem wurde aber Brüning in der Regel vorgezogen. Peters Bruder war der im Juni 2001 verstorbenen Johannes Friederichs, den man in der halben Eifel als Klobbe kannte und schätzte. Peter Brüning Friederichs fiel am 31. Mai 1944 als Flaksoldat im Alter von 28 Jahren. Er war in unserem Dorf wegen seines freundlichen und hilfsbereiten Wesens beliebt. Ich selber bin ihm in meiner Kinderzeit einmal am Kasseschopp (Dreschanlage) begegnet, wo er die Aufsicht führte. Das war in 1942, Brüning und mein Onkel (Ohm Mattes) als Landwirte, waren gleichzeitig auf Ernteurlaub in ihrem Heimatort.
Buëresackdooch
Die wörtliche Übersetzung lautet „Bauerntaschentuch“ und mutet etwas seltsam an. Auf Anhieb denken wir an das früher übliche riesige rot-geblümte Sackdooch (Taschentuch) des Eifelbauern, dessen vier Ecken mit einem Knoten versehen wurden und das dann als behelfsmäßiger Sonnenschutz auf den Kopf gestülpt werden konnte. Das war beispielsweise bei der Heuernte hilfreich, wenn der Kopf von Fliegen und Stechmücken umsummt wurden. Das Buëresackdooch war aber von völlig anderer Art. Bei der Arbeit in Feld und Wald führte der Bauersmann nicht immer ein Taschentuch mit sich, erforderlichenfalls nahm er zum Schneuzen Daumen und Zeigefinger zu Hilfe (siehe auch Sackdooch). Diese beiden Schneuzfinger waren das Buëresackdooch. Übrigens: Nicht nur der Eifeler Bauersmann schneuzte sich auf diese Art, auch beim Stadtbewohner war diese Tätigkeit zu beobachten. Der Städter zeigte sich allerdings „kultivierter,“ indem er nur die Finger der linken Hand zu Hilfe nahm, weil mit der Rechten das Essen zum Mund geführt wurde.
Büjeliese
Das elektrische Bügeleisen von heute ist superleicht, erreicht die Betriebstemperatur innerhalb weniger Sekunden, sprüht Wasserdampf und besitzt eine automatische Temperaturregelung. Das Bolzeniese (Bolzeneisen) bei uns daheim war gewichtig, brauchte eine gewisse Zeit zum Heißwerden und besaß auf der zentimeterdicken eisernen Sohle einen Hohlraum, in den hinein der im Herdfeuer zur Rotglut erhitzte kiloschwere Eisenbolzen passte. Die Arbeit mit diesem Gerät strapazierte die Armmuskeln. Dennoch wurde es dem alten Elektroeisen vorgezogen, das noch keinen Regler besaß und über einen Keramik-Gerätestecker mit der Schraubsteckdose in der Lampenfassung verbunden wurde. Es verbrauchte Liëch (Licht = Strom), kostete also Geld und war unbeliebt. Eine andere Geräteart war das Kolleniese (Kohleneisen), in dessen Heizkammer ein glühendes Brikett passte. Ein solches Gerät qualmte und stank nicht wenig, nach dem Krieg sah ich es einmal im Einsatz, bei einer Freundin meiner Schwester in Waldorf: Abends war Kirmesball, der strahlend weiße Faltenrock musste noch rasch gebügelt werden. Das Türchen am Kolleniese schloss wohl nicht dicht, ein winziges Stückchen glücklicherweise kalter Brikettasche geriet auf den Stoff, es gab einen hässlichen gelbbraunen Streifen. Der Weltuntergang hätte kaum schlimmer sein können, die Tränen flossen in Strömen. Sie versiegten erst, nachdem die Oma mit Spezialmittelchen das Weiß wieder zum Strahlen gebracht hatte. Die Kirmes war gerettet.
Büsch
Beim Flegeldreschen wurde das ausgedroschene Weerstrüh (Wirrstroh) zu „Bauschen“ zusammengebunden. Bauschen waren dicke Strohbündel, die bei uns Büsch genannt wurden. Das Gegenstück der Büsch war die Järv (Garbe aus ungedroschenem Getreide). Die relativ schweren Büsche wurden auf dem Steijer (Steiger, Balkendecke über der Tenne) gelagert und dienten im Winter als Viehfutter oder Stallstreu. Vom Dreschen abgeleitet war auch der Ausdruck büsche im Sinne von „prügeln“, beispielsweise wurde der Wirtshausstreit kommentiert: En dr Wietschaff sen se sech fies am büsche. Gelegentlich steht Büsch auch für den mundartlichen Wald. Auf die Frage des Lehrers, was er denn gestern gemacht habe, verkündete Jüppche (Josef) stolz: Gestern war ich mit meinem Pap im Büsch. In unserem Dialekt heißt der Wald Bösch, in der Schule musste man aber huhdütsch kalle (hochdeutsch sprechen) und da wurde der Bösch eben zum Büsch. Der Holländer kennt für beide Begriffe ein einziges Wort: bos, die verschiedenartige Bedeutung ergibt sich aus dem zugehörigen Artikel: De (der) bos ist ein Bund oder Bündel und damit unsere Büsch, der Wald dagegen (unser Bösch) heißt bei den Holländern het (das) bos.
büüle
Noch zur Zeit unserer Eltern kannte man büüle als Ausdruck für das gegenseitige Aufwiegen von erbrachten Leistungen. Mein Vater hatte beispielsweise einem Bauersmann aus dem Dorf ein Kellerfensterchen angefertigt, der Mann fuhr uns mit seinem Ochsengespann zwei Wagen Heu ein. Bei der gegenseitigen Abrechnung ging es dann bargeldlos zu: Losse mir büüle, Hein, und das hieß: Deine Arbeit gegen die meine, wir sind quitt. Im Eifeler Dialekt gibt es auch das Hauptwort Büüle. Das ist die Mehrzahl von Büül und bedeutet „Beulen.“ Als Kinder hatten wir beispielsweise häufig mit Frossbüüle (Frostbeulen) zu kämpfen. Wenn am Wassereimer hier und da die Emaille abgeplatzt war, so nannte man derartige Stellen verschiedentlich auch Büüle, richtiger war in diesem Fall aber der Ausdruck Blötsche, das nämlich ist das Dialektwort für „Dellen.“ Die ausgleichende Funktion von büüle wird noch deutlicher beim Begriff üßbüüle, den wir als „ausbeulen“ notwendigerweise mit der Autowerkstatt in Verbindung bringen.
zurück
nach oben
|