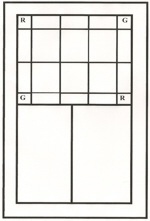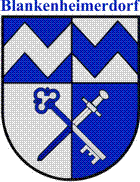 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Aktualisierung |
|||||||||||||||||||||||
|
15.03.2024 |
|||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||
|
Herzlich willkommen in Blankenheimerdorf |
||||||||||
|
Als wir ins „Dörf“ kamen Im Sommer 1949 kamen wir nach Blankenheimerdorf. Nach dem Tod von Onkel Matthias im August 1947, wurde Tante Sophie neue Hausbesitzerin. Da sie mit ihrer Familie in absehbarer Zeit nach Schlemmershof ziehen würde, mussten wir aus Mutters Elternhaus ausziehen. Im Krieg hatten meine Eltern auf Anraten von Bekannten, von der Erbengemeinschaft Breuer in Blankenheimerdorf das Haus „Muuße“ auf dem Kippelberg gekauft. Das erwies sich jetzt als segensreicher Entschluss, auch wenn Vater seinerzeit mit dem Ankauf des alten Fachwerkgebäudes zunächst nicht so ganz glücklich war. Immerhin hatte er aber nach seiner Rückkehr aus dem Krieg im August 1945, im früheren Ochsenstall von Muuße mit der Einrichtung seiner Schreinerwerkstatt begonnen.
Das Foto stammt vermutlich aus der Zeit um 1935 und lässt eine deutliche Schieflage des Giebels erkennen, der an der Spitze 40 Zentimeter aus dem Lot gerate war. Das ist bei alten Fachwerkgebäuden relativ häufig zu sehen. Schief wie die Wand, war auch das dahinter liegende Schlafzimmer meiner Eltern: Boden und Decke wichen zur Straßenseite hin knapp acht Zentimeter nach unten aus der Horizontalen ab. Das machte sich insbesondere beim Putzen fatal bemerkbar, die Feuchtigkeit nämlich zeigte das intensive Bestreben, sich an der tiefsten Bodenkante zu sammeln. In den 1960er Jahren wurde unser Haus innen und außen restauriert, dabei verschwand auch die Schieflage. Die Schrift auf der erwähnten Postkarte spricht seltsamerweise vom „Kippenberg,“ der Ortsteil heißt unterdessen seit Menschengedenken im Volksmund „Keppelberch.“ Im Krieg bewohnte zunächst eine Familie Walter (oder Walther ?) das Haus, sehr angenehme Leute, die uns öfter in Schlemmershof besuchten und Dinge beschaffen konnten, die allgemein nicht zu haben waren, beispielsweise ein Paar Kinderschuhe für mich. Die Walters waren urplötzlich spurlos verschwunden. Es hieß, der Mann sei ein Agent gewesen und von der Gestapo verhaftet worden. Tatsächlich entdeckten wir später im niedrigen Kellerchen ein paar seltsame Drähte, und in die dicke Lehmdecke war zwischen den Trägerbalken eine quadratische Höhlung geschnitten. Nach den Walters campierten vorübergehend Wehrmachtsangehörige an Muuße. Während dieser Zeit muss es auf dem Dachboden ein Feuer gegeben haben: Wir fanden einen Teil der Bodenbretter und den darunter liegenden Trägerbalken verkohlt, offensichtlich hatte man noch rechtzeitig löschen können. Der quer durchs Haus führende dicke Eichenbalken ragte etwa handbreit in den Kaminabzug hinein. Auch das war in alten Häusern oft anzutreffen und eine ständige Brandgefahr, die bei uns durch den Umbau behoben wurde.
Wo sich heute neben dem Hof die Gartenfläche befindet, gab es damals einen anderthalb Meter hohen Hügel aus „gewachsenem“ Stein. Im Straßeneinschnitt zwischen Hügel und „Keschesch Jade“ (Garten der Familie Rosen) war aus mächtigen Baumstämmen eine „Panzersperre“ mit versetztem schmalem Durchgang für Fußgänger errichtet worden. Das Hindernis musste mit viel Arbeitsaufwand nach dem Krieg beseitigt werden, Vater ließ die besten Stämme bei „Zalentengs Pitter“ (Peter Steffens) auf der schweren Kreissäge zu Brettern schneiden.
Es gab auch einen Geheimzugang zum verschlossenen Wohnhaus: Über den Heustall und durch ein Loch in der „Brandmauer,“ die aus Lehmfachwerk bestand, auf den Speicher. Den Scheunenraum beanspruchte im Krieg Wilhelm Pickartz als Winterquartier für seine Schafherde. „Pickartze Wellemche“ war in der „braunen Zeit“ Ortsbürgermeister von Blankenheimerdorf. Als er nach dem Krieg unsere Scheune räumen musste, war er ziemlich sauer auf uns. Mit „Schöpp on Hau“ (Schaufel und Hacke) haben wir damals kniehohen festgetrampelten Schafmist von unserer Scheunentenne entfernen müssen.
Ein Viertel des Küchenraums beanspruchte der Backofen, der üblicherweise an der Außenwand noch einen halben Meter heraus gebaut war. Unter dem Backofen führte eine schmale Steintreppe in den winzigen Erdkeller unter der Stov hinab. Die „Türöffnung“ war kaum einen Meter hoch, die Leute mussten echt „op Hän on Fööß“ (auf allen Vieren) rückwärts in den Keller hinab kriechen. Wie sie das mit gefüllten Kartoffelsäcken geschafft haben, ist bis heute ein Rätsel. Der Keller war und ist in den Fels gehauen, die Hausfundamente enden in halber Höhe der Wände. Auch heute kann ich in unserem Keller nicht aufrecht stehen, früher war das noch viel drastischer. Beim Umbau wollten wir tiefer ausschachten, bei 20 Zentimetern gaben wir auf: In diesem massiven Felsgestein half auch der starke Elektromeißel nicht weiter, wir hätten sprengen müssen. So winzig das Kellerchen auch ist, früher war es der denkbar beste „Kühlschrank“ und auch heute ist es ideal zum Einkellern unserer Kartoffeln.
An der Wand neben dem Backofen gab es einen einfachen Wasserhahn mit einem untergestellten Eimer, das war unsere „Zapfstelle.“ Vater baute ein Holzschränkchen mit eingesetztem Spülbecken aus Keramik. Der Abfluss führte durch einen Bretterkanal neben dem Haus in die „Kulang“ (Rinnstein, Gosse), eine Kanalisation gab es noch nicht. Die Toilette bestand aus dem bekannten Herzhäuschen, und dessen Inhalt wurde im Garten als Dünger verwendet, das war allgemein üblich.
In der Mauerhöhlung hinter dem Herd war eine jener gusseisernen „Takenplatten“ eingemauert, die der Wärmeübertragung vom Herd in den Raum nebenan dienten und für Liebhaber ein begehrtes Sammelobjekt bedeuten. Bei der Hausrenovierung wurde unter anderem die Kaminwand entfernt und auch die Takenplatte ausgebaut. Die Bedeutung der Abbildung war uns naturgemäß unbekannt, unser Hausarzt Dr. Rudolf Scholz zeigte sich unterdessen regelrecht begeistert von der gusseisernen Darstellung. Unsere Takenplatte ist heute noch an der Wand des Scholz-Hauses Unter dem Heltenbusch in Blankenheim zu sehen. Beim Abriss der Kaminmauer fanden wir Anzeichen dafür, dass es ganz früher an Muuße eine offene Feuerstelle gegeben haben muss. Der untere Teil des Kamins war offensichtlich nachträglich verändert worden, und in der Küchendecke fanden sich die Reste eines rechteckigen Rauchfangs, der den Qualm in den ursprünglich offenen Kamin ableitete. Das war allein schon für den Backofen erforderlich, dessen Rauch zunächst ins „Huus“ und weiter in den Kamin geleitet wurde. Eine solche Anlage war zu meiner Kinderzeit noch in meinem Elternhaus in Schlemmershof in Betrieb, dort war die Küchendecke kohlschwarz vom Rauch, sie wurde nie gestrichen. Das Haus Muuße hat eine Reihe von Veränderungen erfahren, es ist praktisch „rundumerneuert“ und auch im Innern gibt es nichts Ursprüngliches mehr, bis auf einen Teil der alten Balkenkonstruktion im früheren Wirtschaftstrakt. Hinter dem Fenster am linken Rand von Bild 7, noch besser erkennbar an der Fensterreihe auf Bild 6, lag früher Vaters Werkstatt, – er würde sein Haus heute nicht mehr wieder erkennen.
|
||||||||||
 |
||||||||||
|
Haus Muuße im Sommer 2008 |
||||||||||
 Wenn „Muuße Huus“ erzählen könnte! Das Alter ist nicht mehr feststellbar, nach einer alten Postkarte stammt es aus dem 14. Jahrhundert und dürfte eins der ältesten Häuser im Dorf sein. Eine Urkunde des Notars August Wilhelm Lanser aus Blankenheim besagt, dass am 06. Februar 1855 der Besitzer Joseph Maus seinem Sohn Jacob das Haus übertrug. Vater Joseph war Bauersmann („Ackerer“), ihm hat das Haus vermutlich seinen Namen „Muuße“ zu verdanken. Der neue Besitzer war Schneider von Beruf. Seine Tochter Rosa heiratete Wilhelm Breuer aus Blankenheimerdorf, das Ehepaar wurde neuer Besitzer von „Muuße.“ Das Haus blieb im Besitz der Familie Breuer, nachdem Sohn Karl es von den Eltern übernommen hatte.
Wenn „Muuße Huus“ erzählen könnte! Das Alter ist nicht mehr feststellbar, nach einer alten Postkarte stammt es aus dem 14. Jahrhundert und dürfte eins der ältesten Häuser im Dorf sein. Eine Urkunde des Notars August Wilhelm Lanser aus Blankenheim besagt, dass am 06. Februar 1855 der Besitzer Joseph Maus seinem Sohn Jacob das Haus übertrug. Vater Joseph war Bauersmann („Ackerer“), ihm hat das Haus vermutlich seinen Namen „Muuße“ zu verdanken. Der neue Besitzer war Schneider von Beruf. Seine Tochter Rosa heiratete Wilhelm Breuer aus Blankenheimerdorf, das Ehepaar wurde neuer Besitzer von „Muuße.“ Das Haus blieb im Besitz der Familie Breuer, nachdem Sohn Karl es von den Eltern übernommen hatte.