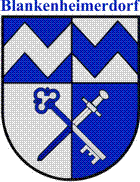|
Als wir am Lohrbach Wasser schöpften
Manchmal, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, um rasch einen Schluck zu trinken oder mal eben die Hände zu waschen, gehen die Gedanken zurück in die Kinderzeit, als wir unser Trinkwasser am Lohrbach schöpften, weil es daheim noch keine Wasserleitung gab. Damals, vor 70 Jahren, hatten wir gutes Wasser kostenlos und in beliebiger Menge zur Verfügung, mussten es aber in mühsamer Knochenarbeit ins Haus schaffen. Heute braucht niemand mehr Wasser zu schleppen. Dafür zahlen wir aber mit guten Euros, Bequemlichkeit hat eben ihren Preis. Und wenn hier und da einmal die Leitung drüch (trocken) bleibt, werden wir uns so recht der Unentbehrlichkeit des Wassers bewusst. Unsere Wasserleitung daheim funktionierte immer. Der Lohrbach floss im heißen Sommer spärlicher, ausgetrocknet ist er aber nie.
Wir wohnten in Schlemmershof, einer Ansiedlung in der heutigen Gemeinde Blankenheim. Der Weiler bestand aus nur vier Gebäuden, unsere Hausnummer war aber 154, Schlemmershof nämlich war ein Ortsteil der damals noch selbständigen Gemeinde Blankenheimerdorf, drei Kilometer von uns entfernt. Der Nonnenbach, ein rechter Zufluss der Ahr, trennte uns von dem 100-Seelen-Dorf gleichen Namens, das in Rufweite lag und zur Gemeinde Ripsdorf gehörte. Der Bach bildete die Gemeindegrenze. In Nonnenbach gab es seit 1923 eine Wasserversorgung, Schlemmershof hat noch Jahrzehnte auf diese Einrichtung warten müssen.
Die „Wurzel“ unserer kleinen Ansiedlung war der alte Schlemmers Hof, dessen strohgedecktes Wohnhaus längst einem schönen Neubau Platz gemacht hat. Wir nannten den Hof Önne Schlemmesch (Unten Schlemmers), weil er unterhalb unseres Anwesens lag. Der zweite Nachbar war Henne Schlemmesch (Hinten Schlemmers), weil er „hinter“ unserem Haus lag. Das Anwesen Klinkhammer oberhalb von uns hieß Kaue. Unser Haus Plützer, das Elternhaus meiner Mutter, wurde ortsüblich Drine genannt. Alle Familien standen in Beziehung zum alten Schlemmers Hof. So war beispielsweise meine Urgroßmutter Ursula (mütterlicherseits) eine geborene Schlemmer. Wie war´s bei uns vor 70 Jahren? Ein Blick zurück auf die Kinderzeit in Schlemmershof.
 Unsere „Wasserleitung“ war der Lohrbach, 150 Schritte vom Haus entfernt. Er heißt amtlich „Günzelbach“, wir nannten ihn aber Lohrbach, weil das von ihm durchflossene schmale Tal et Lohr ist. Die Familien Rütz (Önne Schlemmesch) und Schlemmer (Henne Schlemmesch) bezogen ihr Trinkwasser aus dem für sie näher gelegenen Nonnenbach. An Kaue gab es eine selbstgebaute „Wasserversorgung“. Gleich links neben der Haustür war im Huus (Eingangsbereich, Küche) der „Spülstein“, das aus Naturstein gemeißelte Wasserbecken mit dem blanken Messinghahn, um den wir Kaue ein wenig beneideten. Der Abfluß führte durch die Hauswand auf den mit Feldsteinen gepflasterten Hof hinaus. Ein solches Pflaster nannte man Jefei. Es gab weder eine Kanalisation noch einen Vorfluter, das Wasser versickerte auf der Wiese wenige Schritte unterhalb des Hauses. Der „Hochbehälter“ lag 100 Meter vom Haus entfernt im Waldhang der Hardt, er vermochte kaum zwei Kubikmeter Wasser zu speichern und wurde aus einer kleinen Waldquelle gespeist. Die Rohrleitung führte quer durchs Lohr zum Haus. Der Hochbehälter lag nur wenig höher als der Auslauf am Hahn, entsprechend gering war der Wasserdruck. Im heißen Sommer fiel die Versorgung gelegentlich vollständig aus, dann mussten auch Kaue am Lohrbach Wasser schöpfen. Unsere „Wasserleitung“ war der Lohrbach, 150 Schritte vom Haus entfernt. Er heißt amtlich „Günzelbach“, wir nannten ihn aber Lohrbach, weil das von ihm durchflossene schmale Tal et Lohr ist. Die Familien Rütz (Önne Schlemmesch) und Schlemmer (Henne Schlemmesch) bezogen ihr Trinkwasser aus dem für sie näher gelegenen Nonnenbach. An Kaue gab es eine selbstgebaute „Wasserversorgung“. Gleich links neben der Haustür war im Huus (Eingangsbereich, Küche) der „Spülstein“, das aus Naturstein gemeißelte Wasserbecken mit dem blanken Messinghahn, um den wir Kaue ein wenig beneideten. Der Abfluß führte durch die Hauswand auf den mit Feldsteinen gepflasterten Hof hinaus. Ein solches Pflaster nannte man Jefei. Es gab weder eine Kanalisation noch einen Vorfluter, das Wasser versickerte auf der Wiese wenige Schritte unterhalb des Hauses. Der „Hochbehälter“ lag 100 Meter vom Haus entfernt im Waldhang der Hardt, er vermochte kaum zwei Kubikmeter Wasser zu speichern und wurde aus einer kleinen Waldquelle gespeist. Die Rohrleitung führte quer durchs Lohr zum Haus. Der Hochbehälter lag nur wenig höher als der Auslauf am Hahn, entsprechend gering war der Wasserdruck. Im heißen Sommer fiel die Versorgung gelegentlich vollständig aus, dann mussten auch Kaue am Lohrbach Wasser schöpfen.
Der Wassertransport vom Pötz (Pütz, Schöpfstelle) im Lohr zu unserem Haus war mühsam. Es ging relativ steil bergan, die Steigung betrug mehr als 20 Prozent. Die beiden weiß emaillierten Wassereimer waren ungewöhnlich groß und fassten vermutlich je 15 Liter oder mehr. Die Emaille war an manchen Stellen abgeplatzt. Das sah zwar nicht schön aus, störte aber absolut nicht, vielmehr waren derartige Blötsche (Beulen, Schadstellen) typisch und geradezu ein Markenzeichen für vielbenutztes Eifeler Emaillegeschirr. Wasserholen war übrigens bei uns in der Regel Frauenarbeit.
Unser Wasserpäädche (Pfad) führte über die Wiese des Nachbarn, wurde aber geduldet, weil es der Wasserversorgung diente. Die Schöpfstelle war ein natürlicher Kömpel (Vertiefung, Tümpel) im Bachbett, der zusätzlich durch ein kleines Wehr angestaut war. Die Sperranlage wurde regelmäßig durch das Frühjahrshochwasser weggerissen und mußte erneuert werden. Ein paar flache Steine dienten als Randbefestigung. Im Sommer wuchsen Gras und Binsen weit über den Wasserspiegel hinaus. Ich entsinne mich noch, daß es am Pötz viele blaue Prachtlibellen und blaugrüne Mosaikjungfern gab. Besonders den Letzteren gingen wir wegen ihres „gefährlichen“ Aussehens aus dem Weg, wir wussten ja nicht, daß diese Insekten für den Menschen absolut harmlos sind. Beim Schöpfen wurde gelegentlich Schlamm aufgewirbelt, der zum Teil mit in den Eimer geriet. Kein Problem: Nach kurzer Zeit setzte sich dieser Zusatz am Boden ab und störte nicht weiter. Außerdem gab es ja auch die weise Behauptung, daß „Sand den Magen scheuert“. Mitgeschöpfte Bachläufer oder Grashalme waren ebenfalls bedeutungslos, man fischte sie einfach mit der Hand aus dem Eimer. Die Leute damals waren eben nicht so besonders „pingelig“ und geschadet hat es ihnen nie.
 Ein altes Eifeler Wort besagt, daß verschmutztes Bachwasser sich von selber gereinigt hat, sobald es üwwer sibbe Stejn (über sieben Steine) geflossen ist. Heute wird sich kein Mensch noch auf eine solche Behauptung verlassen. Besaßen unsere Bachsteine vor 70 Jahren mehr Reinigungskraft als heute? Oder war der Eifelbach noch sauberer? Wie dem auch sei, - etwa 500 Meter oberhalb unserer Schöpfstelle wurde einmal ein totes Reh im Bachlauf gefunden, wo es offensichtlich schon tagelang gelegen hatte. Ahnungslos tranken wir unser Lohrbachwasser, krank geworden ist niemand danach. Ein altes Eifeler Wort besagt, daß verschmutztes Bachwasser sich von selber gereinigt hat, sobald es üwwer sibbe Stejn (über sieben Steine) geflossen ist. Heute wird sich kein Mensch noch auf eine solche Behauptung verlassen. Besaßen unsere Bachsteine vor 70 Jahren mehr Reinigungskraft als heute? Oder war der Eifelbach noch sauberer? Wie dem auch sei, - etwa 500 Meter oberhalb unserer Schöpfstelle wurde einmal ein totes Reh im Bachlauf gefunden, wo es offensichtlich schon tagelang gelegen hatte. Ahnungslos tranken wir unser Lohrbachwasser, krank geworden ist niemand danach.
Spät im Herbst nahmen wir den Jrawepötz (Grabenpütz) in Betrieb. Das war eine wesentliche Erleichterung für die Wasserträger. Etwa 200 Meter talaufwärts wurde der Bachlauf durch ein provisorisches Wehr aus Steinen zum Teil in einen künstlich angelegten schmalen Graben umgeleitet. Der Graben führte am Talhang entlang und speiste 50 Schritte vom Haus entfernt den erwähnten Jrawepötz, der fast auf der Höhe des Hanges lag und mit einem Überlauf versehen war. Das Ganze funktionierte wie ein Mühlengraben. Wenige Schritte hinter dem Pötz floss das Wasser unkontrolliert über den Wiesenhang ins alte Bett zurück. Der Jrawepötz ersparte uns im Winter den steilen Pfad zum Bach. Der Weg war oft vereist und nur unter Gefahr zu begehen, besonders mit gefüllten Eimern. Morgens wurde gestreut, mit Holzasche aus dem Küchenherd, weil das rötliche Veehsalz (Viehsalz, Streusalz) zu teuer war. Das Abstreuen half nur vorübergehend, nach kurzer Zeit war die Asche überfroren.
Bei kräftigen Minustemperaturen war unser Jrawepötz morgens zugefroren, das Eis mußte aufgehackt und entfernt werden. Trotzdem gerieten beim Schöpfen sehr oft kleine Eisstücke mit in den Eimer. Das war bedeutungslos: In der Küchenwärme schmolz das Eis ziemlich rasch, der Wasserqualität tat es keinen Abbruch. Unser massiver Küchentisch besaß einen stabilen Zwischenboden, auf den die beiden Wassereimer abgestellt wurden. Wer Durst hatte, griff sich die Schepp (Schöpfe, Kelle) vom Nagel und schöpfte aus dem Eimer. Dabei war man darauf bedacht, angesichts der mühevollen Wasserbeschaffung nur ja nichts zu „verschlabbern“. Ein von uns Kindern unglücklich umgestoßener gefüllter Wassereimer war schon fast eine Sünde und zog Unheil nach sich. Sparsamkeit galt unter anderem auch fürs Händewaschen: Die Weischschepp (Waschschüssel) wurde morgens mit Wasser beschickt, der Inhalt mußte den ganzen Tag reichen.
In unserem kleinen Stall hatten drei Milch- und Gespannkühe ihr Zuhause, zusätzlich wurde eine Stirk (Färse, Jungkuh) oder ein Bäuert (Jungochse) großgezogen, für den Verkauf. Die Tiere brauchten täglich wenigstens zwei bis drei Eimer Wasser pro Kopf. Am Zusammenfluss von Nonnenbach und Lohrbach lag in Sichtweite des Hauses unsere Viehtränke und hier versorgten sich die Tiere selber, für sie brauchten wir kein Wasser zu schleppen. Täglich zweimal zu gewohnter Stunde nach der Fütterung, wurde die Stalltür geöffnet, die Kühe wurden losgekettet und mit einem leichten Klaps auf die Reise geschickt: „Nu jö, aan de Baach. Der Bach war im Eifeler Dialekt weiblichen Geschlechts: Die Baach. Willig trotteten Schwitt, Rüet und Fuss (Tiernamen) dann unbeaufsichtigt zum Bach, tranken sich satt und kehrten unaufgefordert auf ihren Platz im Stall zurück. Das klappte immer, auch im dicksten Winter, wenn das Eis auf der Tränke erst aufgehackt werden mußte. Das eisige Bachwasser hat weder Mensch noch Tier jemals geschadet.
Die Viehtränke wurde auch zum Koleraweweische (Rübenwäsche) benutzt. Die Rommele oder Kolerawe (gelbe oder weiße Futterrüben) lagerten während des Winters in der Kuhl (Erdmiete) in der Nähe des Hauses. In regelmäßigen Abständen wurde die Kuhl geöffnet und der Futterbedarf für zwei bis drei Wochen entnommen. Im fließenden Wasser der Viehtränke wurden die Rüben mit dem selbstgefertigten sperrigen Birkebeißem (Birkenbesen) von der anhaftenden Erde gereinigt. Vor dem Verfüttern wurden sogar noch von Hand mit dem Kolerawemetz (Messer) die Wurzeln entfernt, - unserem Vieh wurde das Futter appetitlich serviert. Rüben waren ein Leckerbissen fürs Vieh. Die weißen Kolerawe mundeten uns indessen nicht weniger als den Tieren. Sie kamen häufig als Gemüse auf den Mittagstisch, wir Pänz (Kinder) verzehrten sie sehr gerne roh, in dicke Scheiben geschnitten.
Im Sommer, wenn es bei der Heuernte so heiß war, daß de Krohe jappe (die Krähen nach Luft schnappen), war ein in der Nähe fließender Bach wahrhaft segensreich. In einer eigens zu diesem Zweck mitgeführten kleinen Emaillekanne wurde Frischwasser geholt, an dem sich die Erntemannschaft labte. Dabei diente der Kannendeckel als reihum gehendes Trinkgefäß. Eine unserer Heuwiesen lag im Flurbereich „Maiheck“ und im nahe gelegenen Tal sprudelte in einem kleinen Erdfall die Seidenbachquelle zu Tage, die heute erschlossen ist und die Ringleitung der Gemeinde Blankenheim versorgt. Das Wasser war herrlich frisch, kristallklar und überaus wohlschmeckend. Um einem „Vertrinken“ (jähe Abkühlung durch eiskaltes Wasser) vorzubeugen, mussten wir auf Anraten der Eltern vor dem Trinken an der Quelle die Unterarme kurz ins Wasser stecken.
Als der Eifelwald noch gesund war, war auch sein Wasser gut. Vor 70 Jahren durfte man unbeschadet und bedenkenlos aus jedem Flößje (Rinnsal) trinken. Viele Eifelbauern verdienten sich früher im Winter ein paar zusätzliche Mark mit Holzfällen. Einer von ihnen war Ohm Mattes, mein Onkel, dem ich im Mittchen (Henkelmann) das Mittagessen auf die Arbeitsstelle trug. Holzfällen macht durstig, damals mehr als heute, weil sämtliche Arbeiten von Hand getan werden mussten. Motorwerkzeuge waren bei uns noch unbekannt. Im nächsten Siefen (Waldsenke) floss mit Sicherheit ein nie versiegendes Rinnsal. Die Holzfäller gruben mit den Händen ein kleines Becken, in dem sich das Wasser sammeln konnte. Nachdem sich der Mudd (Schlamm, Verunreinigung) gesetzt hatte und das Wasser klar geworden war, legte man sich auf den Bauch und trank aus dem Becken, oder man schöpfte mit den Händen.
Im gesunden Wasser lebten gesunde Bewohner: Prächtige Bachforellen mit goldgelbem Bauch und leuchtend roten Punkten. In guter Butter gebraten, schön mit Mehl paniert, war – und ist wohl auch heute noch – die wildlebende Bachforelle geschmacklich nicht durch die stattlichste Regenbogenforelle zu übertreffen. Als Hütebuben fingen wir gelegentlich eine Forelle, die dann auf eine Haselrute gespießt und über dem Weidefeuer gebraten wurde. Zu diesem Zweck führten wir stets ein Schraubglas mit Salz bei uns.
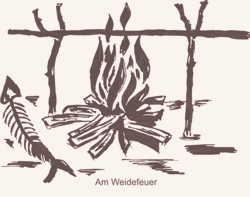 Im Herbst zogen die Forellen im Lohrbach aufwärts in ihre Laichgebiete, wo nicht selten der Rücken der Tiere aus dem flachen Wasser ragte. Man hätte sie leicht greifen können, doch das hatten uns die Eltern unnachsichtig verboten: Die Fische sorgten für Nachwuchs und dabei durften wir sie nicht stören. Anders dagegen im frühen Frühjahr, wenn die Forellen vom Laichen bachabwärts ins tiefere Wasser zurückkamen. Auf dieser „Reise“ passierten manche von ihnen unseren Jrawepötz und gerieten mit dem abfließenden Wasser auf den Wiesenhang. Wir mussten nur über die matschige Wiese stapfen und die hüpfenden Leckerbissen einsammeln, die ohnehin hier verendet wären. Den Weg zurück ins alte Bachbett fanden nur wenige der Tiere. Im Herbst zogen die Forellen im Lohrbach aufwärts in ihre Laichgebiete, wo nicht selten der Rücken der Tiere aus dem flachen Wasser ragte. Man hätte sie leicht greifen können, doch das hatten uns die Eltern unnachsichtig verboten: Die Fische sorgten für Nachwuchs und dabei durften wir sie nicht stören. Anders dagegen im frühen Frühjahr, wenn die Forellen vom Laichen bachabwärts ins tiefere Wasser zurückkamen. Auf dieser „Reise“ passierten manche von ihnen unseren Jrawepötz und gerieten mit dem abfließenden Wasser auf den Wiesenhang. Wir mussten nur über die matschige Wiese stapfen und die hüpfenden Leckerbissen einsammeln, die ohnehin hier verendet wären. Den Weg zurück ins alte Bachbett fanden nur wenige der Tiere.
Es war kurz nach meiner Erstkommunion im Jahr 1943, mitten im Krieg. Auf dem Rückweg von der Sonntagsandacht im Nonnenbacher Kapellchen, stockte mir an der Brücke der Atem: Im seichten Wasser „stand“ eine Forelle, ein unterarmlanges Prachtstück. Nach anderthalbstündigem „Kampf“ hatte ich das Tier erwischt und trug, „mit Dreck und Ruhm bedeckt“, den Leckerbissen triumphierend nach Hause. Der nagelneue Kommunionanzug, den Jäjesch Liss (ortsüblicher Name), die Nähdesch (Näherin) aus Blankenheimerdorf, angefertigt hatte, war reif für die Reinigung, die damals daheim aus Kochkessel und Waschbrett bestand.
Das befürchtete Donnerwetter blieb aus. Angesichts meiner Siegesfreude und nicht zuletzt auch angesichts der unerwarteten Mahlzeitbereicherung, übersah man angelegentlich und kopfschüttelnd, wenn auch ein wenig seufzend, die Schlammgeschichte. In jener armen Zeit zählte eben ein voller Magen mehr als ein verdreckter Kommunionanzug. Noch am gleichen Abend gab es bei uns gebratene Bachforelle, wobei selbstredend mir der größte Happen zufiel. Daß es möglicherweise Diebstahl war, was ich da angestellt hatte, war nicht von Bedeutung, das brauchte ich sogar nicht zu beichten. Es war ja Krieg und zu kaufen gab es wenig. Da bediente man sich eben dessen, was sich einem anbot.
Ein Kriegserlebnis ist mir noch in Erinnerung, das in Zusammenhang mit unserem Jrawepötz steht. Am 08. November 1944, einem Mittwoch, gab es gegen 14,30 Uhr einen Fliegerangriff auf die Bahnanlagen in Blankenheim - Wald. Es war vermutlich an diesem Tag zur angegebenen Zeit, als ich mit unserer Jött (Tante, Patin) vom Wasserschöpfen am Jrawepötz kam. Ich trug zwei kleine Fünf-Liter-Eimerchen. Über der Hardt tauchten etliche „Jabos“ auf und stürzten sich mit heulenden Motoren über „Bierther Hardt“ (Waldgebiet) auf Blankenheim - Wald hinab. Die Flugzeuge drehten nach dem Angriff ab, lediglich ein Einzelner setzte zu einem erneuten Sturzflug an, geriet aber in derart heftiges Abwehrfeuer, – wir sahen es an den zahlreichen Sprengwölkchen – daß er blitzschnell wieder nach oben stieg. Seine beiden Bomben hatte er offensichtlich nicht abwerfen können, die klinkte er beim Hochsteigen über Bierther Hardt aus und wir sahen sie direkt auf uns zu fallen. Die kostbaren Wassereimer „im Riß“ lassend, stürzten wir ins nahe Haus. Kaum an der Haustür, überfiel uns fürchterliches Krachen, es prasselte auf unser Hausdach und auf dem Peisch (Wiese vor dem Haus) lagen plötzlich dicke Erdbrocken herum.
Uns war nichts geschehen. Jött stieg aber auf den Dachboden hinauf und kehrte schreckensbleich zurück: „Die Bombe sin op os Huus jefalle, et es äwwer nix am brenne“. Zwei Jabobomben auf unser Haus, da wäre wohl nicht mehr viel übrig geblieben. Tatsächlich klafften aber zwei metergroße Löcher im Dach und der Speicherboden war mit Erdbrocken und Steinen bedeckt. Die Bomben mussten in nächster Nähe niedergegangen sein. Später entdeckten wir die beiden Trichter im Berghang der Hardt unweit von Kaue „Hochbehälter“, Luftlinie keine hundert Meter von unserem Haus entfernt.
Es war eine arme Zeit, meine Kinderzeit in Schlemmershof. Dennoch war es eine schöne Zeit, sorglos und unbeschwert trotz des Krieges, dessen Schrecken an meiner kleinen Heimat weitgehend vorüber ging. Aufgewachsen in und mit der Natur, – der Wald reichte bis auf Steinwurfweite an Schlemmershof heran und die vier Gebäude waren sämtlich von Gebüsch und Dickicht eingerahmt –, gibt es nur positive Erinnerungen an meine Kinderjahre, die ich unter gar keinen Umständen missen möchte.
|
|