|
Von Knallkorken, Karbid und anderen Krachern
Wenn in der Silvesternacht die Böller krachen und die Raketen in den Himmel steigen, gehen meine Gedanken unwillkürlich zurück in die Kinder- und Jugendzeit. Auch damals wurde das Neue Jahr „angeschossen“, mit minimalem Aufwand, weil uns die heutigen pyrotechnischen Erzeugnisse nicht zur Verfügung standen, – wir hätten sie uns ja auch gar nicht leisten können. Das Silvesterspektakel der Gegenwart scheint mir unterdessen ein wenig auszuufern angesichts der Tatsache, daß alle 3,6 Sekunden auf unserer Erde ein Mensch an Hunger stirbt und daß drei Viertel hiervon Kinder unter fünf Jahren sind. (Quelle: www.rainbowkids.de )
Noch gut in Erinnerung ist mir die Silvesternacht 1944. Unser kleines Dorf im Hinterland der Westfront war mit deutschen Truppen überbelegt. Um Mitternacht begrüßten die Soldaten das Neue Jahr mit Karabinerschüssen und Eierhandgranaten. Am Himmel dröhnten Flugmotoren, die Nachtjäger und Bomber trugen tödliche Neujahrsgrüße in die Ardennenschlacht, wo brennende Dörfer schauerliche Silvesterbeleuchtung schufen. Ich war noch nicht ganz zehn Jahre alt und verstand nicht viel vom Krieg, aus den Berichten der Landser wusste ich aber, wie es im Kampfgebiet aussah.
Kinderkram
Ein Schießgerät war und ist seltsamerweise ein unverzichtbares Kinderspielzeug. Auch in meiner Spielkiste gab es vor fast 70 Jahren die Scheeß (wörtlich: Schieße), eine Blechpistole, mit der man die roten Knallplättchen abfeuern konnte. Diese Muniziuën (Munition) gab es für ein paar Pfennige an der Kirmesbude in Blankenheim zu kaufen, 40 Stück im runden Pappdöschen. Die Blankenheimer Kirmes war aber nur einmal im Jahr und die Plättchen waren rasch verbraucht. Dann brachte Pap (Vater) Nachschub mit, wenn er von der Arbeit kam.
Das Einlegen der winzigen Munition in die Pistole war umständlich, also legte ich die Plättchen auf die Düertrapp (Treppenstein) an der Haustür und titschte (titsche = leicht anstoßen) sie mit dem Hammer an. Das war einfacher, ging schneller und knallte genau so laut. Irgendwann einmal kaufte ich mir an der Bude eine Automatikpistole, in deren Magazin vielschüssige Knallstriefe (Streifen) eingelegt wurden. Die Pistole kostete 2,60 Reichsmark, ich weiß es noch genau, weil ich insgesamt nur drei Mark Kirmesgeld besaß, der Rest reichte gerade noch für ein paar Munitionsstreifen. Aufs Karussellfahren mußte ich diesmal ganz verzichten, das war zwar bitter, aber ich wollte unter allen Umständen die „Automatik“ besitzen. An der neuen Scheeß hatte ich unterdessen nicht viel Freude, sehr schnell war nämlich der Transportmechanismus im Eimer, – er hatte ohnehin nie richtig funktioniert.
Eine weitere Möglichkeit bot das Schlösselscheeße (Schlüsselschießen). Es gab damals Kasten-Türschlösser, für die ein Hohlschlüssel erforderlich war. Unsere Kellertür besaß ein solches Schloß, den riesigen eisernen Schlüssel hätte man notfalls als Verteidigungswaffe benutzen können. In die Bohrung wurde das Knallplättchen gesteckt, ein eiserner Stift, meist ein passender Nagel, wurde aufgesetzt und gegen die Wand geschlagen. Das knallte auch, war aber umständlich, weil die Reste der Plättchen immer wieder aus dem Schlüssel heraus gestochert werden mussten. Hohlschlüssel in verkleinertem Maßstab gibt es heute noch bei Möbelschlössern.
 Knallplättchen, das war absoluter „Kinderkram“, mit zunehmendem Alter befasste man sich mit „standesgemäßem“ Schießmaterial und das waren Knallkorken. Die krachten schon ganz passabel, sie kosteten aber auch entsprechend mehr. Auch die Knallstoppe kaufte man an der Kirmesbude, es gab sie in Pappschachteln zu je 20 Stück, eingepackt in Sägemehl. Die ausgehöhlten Korken enthielten eine winzige Menge hochempfindliches Knallsalz, das auf Druck und Schlag reagierte. Es krachte schon, wenn man nur mit dem Absatz auf den Korken trat. Knallplättchen, das war absoluter „Kinderkram“, mit zunehmendem Alter befasste man sich mit „standesgemäßem“ Schießmaterial und das waren Knallkorken. Die krachten schon ganz passabel, sie kosteten aber auch entsprechend mehr. Auch die Knallstoppe kaufte man an der Kirmesbude, es gab sie in Pappschachteln zu je 20 Stück, eingepackt in Sägemehl. Die ausgehöhlten Korken enthielten eine winzige Menge hochempfindliches Knallsalz, das auf Druck und Schlag reagierte. Es krachte schon, wenn man nur mit dem Absatz auf den Korken trat.
Zum Verschießen der Korken gab es an der Bude die Stoppepistool, ein handliches kleines, aber entsprechend massives Pistölchen im Derringerformat. In die Mündung des dicken Laufes passte der Korken hinein, ein Schlagstift zündete die Ladung. Unglücklicherweise passte auch der Kinderfinger in den Lauf und das hatte gelegentlich schmerzhafte Folgen, wenn versehentlich der Abzug betätigt wurde. Ich meine mich zu entsinnen, daß eine solche Pistole die Aufschrift DRGM trug. Knallkorken sind heute als Munition für die Startpistole im Handel, sie fallen unter die Kategorie T1 des technischen Feuerwerks und werden nur noch an Personen über 18 Jahre abgegeben.
Es wurde scharf geschossen
Sportschießen war eine von Vaters Lieblingsbeschäftigungen. Er besaß als Einziger im Dorf einen alten Flobert, ein verhältnismäßig gewichtiges 6 Millimeter Kleinkalibergewehr, geeignet für das Verschießen der gängigen schwachen Einfach- und Doppelladungen, die gerade mal fürs Spatzenschießen reichten. Irgendwann gab es dann aber neue Dreifachladungen und das waren schon richtige kleine Patronen. Die ließen sich zwar mit dem alten Flobert abfeuern, mussten aber mit dem Messer aus dem Lauf jepiddelt (piddele = kratzen) werden, weil sie für den Auswerfer zu fest steckten.
Das war auf die Dauer nicht tragbar und so erschien eines Tages Vater mit einem nagelneuen Flobert und reichlich Munition. Gleich am nächsten Sonntag fanden sich Kaue Huppert (unser Nachbar Hubert Klinkhammer) und aus Nonnenbach Muletuësch Johann (Johann Plützer) ein, um das neue Gewehr gebührend einzuschießen. Die Männer waren Vaters Alters- und Schießsportgenossen, Johann nannte mich ob meiner Quisselichkeit (Lebhaftigkeit) immer nur Jummimännche (Gummimännchen).
Meistens war ich zu den Schießübungen der Männer zugelassen, sammelte die leeren Patronenhülsen auf und durfte ab und zu sogar selber schießen. Das neue Gewehrchen war federleicht und bald konnte ich recht passabel damit umgehen. Der alte Flobert war inzwischen aus dem Verkehr gezogen und „entsorgt“ worden. Es war ganz sicher nicht die beste Erziehungsmethode, dem Achtjährigen ein echtes Gewehr in die Hand zu geben. Vater war aber stolz auf meine „Schießkunst“ und im Übrigen hielten die drei Männer mich scharf im Auge, denn auf kurze Distanz war das neue Gewehr durchaus eine gefährliche Waffe. Beim Barras (Wehrmacht, Militär) war Vater übrigens der zweitbeste Schütze in seiner Kompanie.
 Als das Kriegsende in Sicht kam, wurde im Foderjang (Füttergang, Raum hinter den Futterkrippen) im Stall eine Kiste mit den wenigen Wertsachen vergraben, die es im Eifelhaus gab: Andenken, Schmuckstücke und et joot Jeschier (das gute Geschirr), Goldrand-Porzellan und geschliffene Gläser. Obenauf kam auch der Flobert und die noch vorhandene Munition. Als die Amerikaner abgezogen waren, wurde der Schatz gehoben und Mam (Mutter) nahm eine erste Amtshandlung vor. „E Jewehr kütt mir net mieh en et Huus,“ (Ein Gewehr kommt mir nicht mehr ins Haus) stellte sie energisch fest. Der hölzerne Schaft wurde im Hausbackofen verheizt, den Gewehrlauf bearbeitete sie so lange mit dem stumpfen Ende einer Axt, bis er krumm und unbrauchbar war. Als Vater aus dem Krieg kam und die Geschichte erfuhr, hätte er am liebsten geheult. Als das Kriegsende in Sicht kam, wurde im Foderjang (Füttergang, Raum hinter den Futterkrippen) im Stall eine Kiste mit den wenigen Wertsachen vergraben, die es im Eifelhaus gab: Andenken, Schmuckstücke und et joot Jeschier (das gute Geschirr), Goldrand-Porzellan und geschliffene Gläser. Obenauf kam auch der Flobert und die noch vorhandene Munition. Als die Amerikaner abgezogen waren, wurde der Schatz gehoben und Mam (Mutter) nahm eine erste Amtshandlung vor. „E Jewehr kütt mir net mieh en et Huus,“ (Ein Gewehr kommt mir nicht mehr ins Haus) stellte sie energisch fest. Der hölzerne Schaft wurde im Hausbackofen verheizt, den Gewehrlauf bearbeitete sie so lange mit dem stumpfen Ende einer Axt, bis er krumm und unbrauchbar war. Als Vater aus dem Krieg kam und die Geschichte erfuhr, hätte er am liebsten geheult.
Im Sommer 1943 kam Ohm Mattes (mein Onkel Matthias) auf Urlaub aus Norwegen, wo er Dienst bei der Kriegsmarine tat. Er brachte seinen langen norwegischen Karabiner mit und dazu 30 bis 40 Schuß „schwarze“ Munition, die bei unserem Haus verballert wurde. In unserer Abgeschiedenheit war derartiges Scharfschießen kein Problem. Schussrichtung war die nahe Hardt, wo die Geschosse keinerlei Schaden anrichten konnten. Am Waldrand, Luftlinie 40 Meter entfernt, wurde ein alter Eimer als Zielscheibe aufgestellt.
Insgeheim hatte ich darauf gehofft, war aber doch richtig erschrocken, als ich tatsächlich schießen durfte. Das für mich viel zu schwere Gewehr, das größer war als ich selber, wurde auf unseren Sägebock aufgelegt, Ohm Mattes hielt von hintern eisern fest und zielte, ich hatte nur den Abzug zu betätigen. Vier Schuß dufte ich tun, bei einem hüpfte sogar der Eimer ein wenig in die Höhe. Die Männer stimmten ein Triumphgeschrei an und ich wurde vor Stolz fast so groß wie das norwegische Gewehr, das wegen seines langen Laufes einen verhältnismäßig leichten Rückschlag verursachte. Ein Jahr später schoß ich mit einem kurzläufigen Karabiner 98 k. Den hatten wir „organisiert“ und schossen damit im Wald weitab vom Dorf, Munition lag ja massenhaft herum. Nach dem ersten Schuß saß ich am Boden und die Schulter tat mir weh, das Gewehr lag zwei Schritte hinter mir. Wir, das waren Werner und Karl, zwei ältere Schulkameraden, und ich, später kam noch Helmut hinzu, der in meinem Alter war. Mit der Zeit nannten uns die Leute im Dorf et Sprengkommando, – nicht ganz ohne Grund.
Stärkeres Geschütz
Später in Blankenheimerdorf war Karbid (Calciumcarbid) beliebtes Schießmaterial für die Silvesternacht, dessen sich auch die Erwachsenen recht intensiv bedienten und mit dem sich mächtige Donnerschläge fabrizieren ließen. Wir Jugendlichen waren zwar bei solchen Schießübungen nicht gerne gesehen und wurden fortgejagt, bald hatten wir aber trotzdem herausgefunden, wie die Sache funktionierte und bauten uns unsere eigenen Karbidkanonen.
Es gab die abenteuerlichsten Konstruktionen, deren Anwendung durchaus Gefahren in sich barg. Unser einfachstes und wirkungsvollstes Karbidgeschütz war eine alte Milchkanne mit aufsteckbarem Deckel, der beim Schuß davon flog. Man mußte stets für mindestens 30 Meter freie Schußbahn sorgen. Das Deckelgeschoß konnte bei Unachtsamkeit schlimme Verletzungen verursachen. Wir als „Fachleute“ banden den Deckel an eine doppelte Ploochleng (Pflugleine), er flog dann nicht so weit fort und konnte auch rasch wieder „eingeholt“ werden. Das war besonders in der Dunkelheit vorteilhaft. Je dichter der Deckel schloss, um so gewaltiger war der Knall und um so weiter flog das Geschoß. Wegen der enormen Unfallgefahr ist das Karbidschießen heute in Deutschland verboten.
Noch vor 50 Jahren wurde Karbid häufig als Leuchtmittel benutzt, beispielsweise in den Handlampen des Zug- und Rangierpersonals bei der Bundesbahn. Auch das uralte „hochbeinige“ Fahrrad von Ohm Mattes war mit einer Kabidlamp ausgerüstet, die heute ein begehrtes Sammlerobjekt wäre. Karbid benötigte nicht zuletzt der Dorfschmied fürs Schweißen. Bei der Verbindung von Karbid und Wasser entsteht das hochentzündliche Gas Acetylen. In unsere Milchkannenkanone kam ein angefeuchteter Brocken Karbid, durch ein kleines Loch im Boden wurde das Gas gezündet und mit Donnergetöse flog der Deckel davon.
Karbid riecht unangenehm, irgendwie nach Knoblauch, es stinkt geradezu. Vor etlichen Jahren gab es bei uns ungewöhnlich viele Wöhlmüüs (Wühlmäuse). Ich besorgte mir ein Bekämpfungsmittel, das in die Gänge der Schädlinge gegeben und zugedeckt wurde. Das Zeug roch widerlich, nach kurzer Zeit stank unser Garten und die nähere Umgebung nach Karbid, sogar noch am nächsten Morgen. Glücklicherweise hat sich die Nachbarschaft nicht beschwert. Geholfen hat diese Schädlingsbekämpfung kaum, die primitiven Eimerfallen am Beetrand waren sehr viel wirksamer.
Mancherorts wurde Karbid fürs Böllerschießen bei einer Hielich (Polterabend) oder Hochzeit gebraucht, beispielsweise in Nettersheim. Am Bahnhof hatten wir ein kleines Tönnchen Karbid für unsere Handlampe, die allerdings kaum jemals gebraucht wurde. Manchmal kam Bäckesch Röb (Robert Zimmermann), der gegenüber dem Bahnhof wohnte, zu mir herüber: „Hännes, höck Oovend es Hielich, jeff mir jät Kabid“ (...gib mir ein wenig Karbid). Später wurde in Nettersheim auch mit gasgefüllten Luftballons geballert. Ich weiß nicht, um welches Gas es sich handelte, die Donnerschläge übertönten aber in jedem Fall sogar unsere Karbidkanone. Die gefüllten Ballons wurden im Pkw transportiert, ein Funke hätte genügt und das Auto samt Fahrer wäre durch den Luftdruck zerrissen worden.
In Lebensgefahr
Noch weit gefährlicher als die Nettersheimer Luftballons, war das Sprengzeug, das uns der unselige Krieg in schweren Mengen hinterlassen hatte und dessen wir Halbwüchsige uns in den Nachkriegsjahren für Schießübungen jeglicher Art bedienten, unter anderem auch fürs Silvesterschießen. Tausendmal setzten wir unser Leben aufs Spiel und tausendmal hat ein Unsichtbarer die Hand über uns gehalten. Mit der Zeit hielten wir uns für „Fachleute“ im Umgang mit Sprengstoff. Wir ahnten ja nicht, wie bodenlos dumm wir waren, noch heute sträuben sich mir die Haare beim Gedanken an die eine oder andere „mutige Tat“ von damals.
Nichts konnte unseren unendlichen Leichtsinn bremsen, nicht einmal der Tod meines leiblichen Vetters Peter Weber aus Vaters Heimatort Wiesbaum. Peter starb kurz nach dem Krieg durch eine Gewehrgranate. In Blankenheimerdorf kam durch eine Splitterbombe Alex Rohen ums Leben, der Pächter des Gutes Altenburg. Ebenfalls im Dörf starben zwei kleine Jungen beim Spielen mit Sprengmunition. Unser Nachbar Kaue Mattes (Matthias Klinkhammer) wurde beim Viehhüten im Wald durch eine Stockmine schwer verletzt, sein Schutzengel hieß Günther Mehnert und war der Sohn des Revierförsters. Günther war in väterlichem Auftrag im Wald unterwegs und fand den Verletzten. Dessen erste Frage galt seinem Vieh: Wo sin meng Köh. Günther hat mir die Geschichte einmal erzählt. Bei uns in Nonnenbach geriet eine Kuh auf eine Tellermine und wurde zerfetzt. Die blutige Unglücksstelle bot einen schrecklichen Anblick, von unserem verbotenen Schießsport ließen wir trotzdem nicht ab. Die Eltern wussten von unserer Scheeßerej (Schießerei), mahnten ständig und warnten eindringlich, konnten uns aber nicht gut daheim anbinden. Sie wussten unterdessen nicht, was wir tatsächlich trieben, sonst hätten sie uns doch angebunden.
 Auf keinen Fall sollen an dieser Stelle unsere gefährlichen Spillcher (Spielchen) aufgelistet werden. Ein einziges Ereignis mag genügen, um unseren – im vorliegenden Fall meinen persönlichen – grenzenlosen Leichtsinn aufzuzeigen. Weder meine Eltern noch die übrigen Hausgenossen haben jemals erfahren, wie nahe ich damals dem Tod war. Auf keinen Fall sollen an dieser Stelle unsere gefährlichen Spillcher (Spielchen) aufgelistet werden. Ein einziges Ereignis mag genügen, um unseren – im vorliegenden Fall meinen persönlichen – grenzenlosen Leichtsinn aufzuzeigen. Weder meine Eltern noch die übrigen Hausgenossen haben jemals erfahren, wie nahe ich damals dem Tod war.
Es war im Frühjahr 1945, ich war gut zehn Jahre alt. Als die deutschen Soldaten Hals üwwer Kopp (Hals über Kopf) vor den anrückenden Amerikanern flüchteten, ließen sie in unserem Schopp (Holzschuppen) ein geheimnisvolles „Ding“ zurück, ein Blechgehäuse, das wie eine überdimensionale Stablampe aussah und in dem es leise schepperte. Der flache „Lampenkopf“ besaß einen abnehmbaren Deckel, dessen Schnappverschlüsse durch Plomben gesichert waren. Die „Stablampe“ mußte näher in Augenschein genommen werden, vorerst versteckte ich sie aber hinter altem Gehölz, weil die Amis kamen.
Die Amis waren abgezogen und hatten das „Ding“ nicht entdeckt. Wochenlang wagte ich nicht, es zu öffnen, denn wo Plomben waren, da mußte etwas Wichtiges verborgen sein. Endlich siegte aber die Fürwetz (Neugier). Die neue Straße nach Nonnenbach lag noch im Grundbett, der Krieg hatte den Ausbau unterbrochen. Im Einschnitt bei unserem Haus riß ich beherzt den Plombendraht ab. Unter dem Deckel kam eine runde Blechdose zum Vorschein und darin war aufgerollt ein schwarzes „Kabel“, etwa einen Meter lang. An einem Ende befand sich ein glänzendes Metallstück mit einem Ring, am anderen Ende saß ebenfalls ein Metallteil mit einem silbernen Stäbchen und einem Schraubgewinde. Das Ganze war eine Zündschnur mit Reißzünder und Sprengkapsel, aber das wusste ich damals nicht.
Im hohlen „Stiel“ der „Stablampe“ steckte eine dicke schwarze „Rolle“ mit aufgedruckten Buchstaben und Zahlen. An einem Ende war ein Gewindeloch und dahinein passte genau die Schraube am Kabel mit dem Stäbchen. Das Hineindrehen ging ganz leicht und einfach.
Irgend etwas zwang mich dazu, das Stäbchen wieder aus der Stange heraus zu schrauben, bevor ich am Ring des Kabels zog. Es zischte deutlich und schwacher Rauch stieg auf. Erschrocken warf ich das Kabel zur Seite. Da lag es und zischte eine ganze Weile vor sich hin, eine Ewigkeit, wie mir schien. Plötzlich machte es dünn und scharf „päng“, das Kabel hüpfte ein wenig hoch, das Stäbchen war verschwunden. Später entdeckte ich zwei winzige silberne Splitterchen in der Haut an meinem rechten Knie. Zwei Meter neben dem jetzt „leblosen“ Kabel lag die schwarze Rolle, genau so friedlich und harmlos. „Beste wier am scheeße“! (bist du wieder am schießen) erboste sich Jött, die mit zwei Wassereimern vom Jrawepötz (Wasserstelle) kam. Wenn es irgendwo knallte, war in der Regel „et Sprengkommando“ am Werk.
Bis heute weiß ich nicht, um welche Art von Sprengkörper es sich handelte, vermutlich war es eine Ladung für die Zerstörung eines Geschützes, denn in unserem Schuppen hatte eine Artillerieeinheit kampiert. Die hinterließ uns unter anderem auch einen Haufen leerer Kartuschen, leider kein Messing, das man später für gute D-Mark hätte verhökern können. Der Iesekrämer (Schrotthändler) lud aber auch die Stahlhülsen auf und rückte sogar noch ein paar Groschen dafür heraus. Wie dem auch sei, – wenn die schwarze Stange explodiert wäre, hätte man vergeblich nach Jött und mir gesucht. Mein Schutzengel muß wohl Sprengstoffexperte gewesen sein und ließ mich die Zündschnur weit genug zur Seite werfen.
Jahre später, in Blankenheimerdorf, hätten wir mit Sicherheit eine solche Sprengladung „fachmännisch“ zur Explosion gebracht. Da nämlich gehörte ich einem neuen „Sprengkommando“ an. Wir waren schon fast erwachsen und Kriegsmaterial reizte uns mehr denn je. Wir fühlten uns als „Fachleute“. Am Kaiserhaus (früheres Forsthaus) bei Schmidtheim gab es im Wald ein riesiges Munitionsdepot der Wehrmacht. Es war zwar durch Luftangriffe weitgehend zerstört worden, für uns aber bot es immer noch „Material“ in Mengen. Dort versorgten wir uns mit den begehrten Poleverstange (Pulverstangen, Röhren-Schießpulver) aus der 37 und 88 Millimeter Flakmunition, und mit so manchem anderen gefährlichen Zeug. Es lag ja alles in Mengen da herum und keiner kümmerte sich um das tödliche Durcheinander.
 Unser Leichtsinn kannte keine Grenzen. Längst hatten wir herausgefunden, daß der normale gelbe TNT-Sprengstoff im Feuer mit träger Flamme abbrannte und nur durch Initialzündung – das Wort kannten wir damals nicht, wohl aber die Sprengkapseln – zur Explosion gebracht werden konnte. In der Umgebung von Blankenheimerdorf waren mehrere V1-Flugbomben abgestürzt, die wegen ihrer Unzuverlässigkeit auch „Eifelschreck“ hießen. Die seltsamen „Wunderwaffen“ wurden im Wald bei Rohr gestartet und fielen nicht selten nach wenigen hundert Metern vom Himmel, ohne zu explodieren. Meist brachen sie auseinander und gaben zentnerweise Amatol-Sprengstoff frei. Den holten wir uns für unsere Experimente. Unser Leichtsinn kannte keine Grenzen. Längst hatten wir herausgefunden, daß der normale gelbe TNT-Sprengstoff im Feuer mit träger Flamme abbrannte und nur durch Initialzündung – das Wort kannten wir damals nicht, wohl aber die Sprengkapseln – zur Explosion gebracht werden konnte. In der Umgebung von Blankenheimerdorf waren mehrere V1-Flugbomben abgestürzt, die wegen ihrer Unzuverlässigkeit auch „Eifelschreck“ hießen. Die seltsamen „Wunderwaffen“ wurden im Wald bei Rohr gestartet und fielen nicht selten nach wenigen hundert Metern vom Himmel, ohne zu explodieren. Meist brachen sie auseinander und gaben zentnerweise Amatol-Sprengstoff frei. Den holten wir uns für unsere Experimente.
Das Silvesterschießen war eine Gelegenheit, bei der wir so richtig „loslegen“ konnten. Gegen unsere damaligen Donnerschläge sind die heutigen Kracher das reinste Spielzeug, kaum mehr als harmlose Knallerbsen. Die Dörfer Neujahrsgrüße waren auch im entfernten Nachbarort noch optisch und akustisch wahrnehmbar, davon konnte ich mich selber einmal überzeugen. Nie waren wir uns der Gefahr bewusst, die wir durch unseren Leichtsinn herauf beschworen. Ein glücklicher Umstand mag wohl gewesen sein, daß damals das Kriegsmaterial noch relativ neu und nur wenig verrostet war und somit nicht unkontrolliert reagierte. Gegen unsachgemäße Handhabung war das unterdessen absolut kein Schutz, und hätte nicht Sprengmeister Schutzengel seine Hand über uns gehalten, – es würde diesen Aufsatz heute wohl nicht geben.
|
|
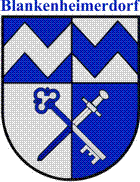




 Unser Leichtsinn kannte keine Grenzen. Längst hatten wir herausgefunden, daß der normale gelbe TNT-Sprengstoff im Feuer mit träger Flamme abbrannte und nur durch Initialzündung – das Wort kannten wir damals nicht, wohl aber die Sprengkapseln – zur Explosion gebracht werden konnte. In der Umgebung von Blankenheimerdorf waren mehrere V1-Flugbomben abgestürzt, die wegen ihrer Unzuverlässigkeit auch „Eifelschreck“ hießen. Die seltsamen „Wunderwaffen“ wurden im Wald bei Rohr gestartet und fielen nicht selten nach wenigen hundert Metern vom Himmel, ohne zu explodieren. Meist brachen sie auseinander und gaben zentnerweise Amatol-Sprengstoff frei. Den holten wir uns für unsere Experimente.
Unser Leichtsinn kannte keine Grenzen. Längst hatten wir herausgefunden, daß der normale gelbe TNT-Sprengstoff im Feuer mit träger Flamme abbrannte und nur durch Initialzündung – das Wort kannten wir damals nicht, wohl aber die Sprengkapseln – zur Explosion gebracht werden konnte. In der Umgebung von Blankenheimerdorf waren mehrere V1-Flugbomben abgestürzt, die wegen ihrer Unzuverlässigkeit auch „Eifelschreck“ hießen. Die seltsamen „Wunderwaffen“ wurden im Wald bei Rohr gestartet und fielen nicht selten nach wenigen hundert Metern vom Himmel, ohne zu explodieren. Meist brachen sie auseinander und gaben zentnerweise Amatol-Sprengstoff frei. Den holten wir uns für unsere Experimente.