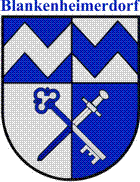 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Letzte Aktualisierung |
|||||||||||||||||||||||
|
15.03.2024 |
|||||||||||||||||||||||
 |
|||||
|
Herzlich willkommen in Blankenheimerdorf |
|||||
|
Die Werkstattrunde Die in der Regel recht beengten, dafür aber „heimeligen“ Werkstätten der dörflichen Handwerker – Schuster, Schmied, Schreiner – waren früher beliebte Treffpunkte der Dorfsenioren. Hier war im Winter immer „joot jestauch,“ man saß oder hockte „drüch on wärm“ (trocken und warm) in gemütlicher Runde beisammen und diskutierte über das aktuelle Dorfgeschehen und die Politik. Für die „innere“ Wärme sorgte ein, je nach Diskussionsthema und Gesprächseifer mehr oder weniger kräftig bemessener Schluck aus der Werkstattflasche, die bei Bedarf aus der dicken Korbflasche an „Krämesch“ nachgefüllt wurde. Ich selber habe nach dem Krieg noch gelegentlich für Vaters Werkstattrunde „ene Liter Kloore“ (Klarer) besorgen müssen, den mir meistens „Krämesch Nettche,“ die beliebte Gastwirtsfrau, aus der bauchigen Vorratsflasche auf dem „Lager“ abzapfte. Die Groschen für den „Nachschub“ wurden zusammengelegt, im günstigsten Fall stiftete einer aus der Runde anlässlich eines erfolgreich verlaufenen Kuhhandels auf dem Hillesheimer Viehmarkt, oder der Geburt von Nachwuchs im Stall, eine neue Flasche. Das „Werkstattwasser“ mit dem zugehörigen Gläschen stand bei uns hinter einem lockeren Brett in der Wandverkleidung. Ein einziges Glas für die gesamte Runde war damals üblich, es ging von Mund zu Mund und wurde alle Jubeljahre einmal gespült. Niemand nahm Anstoß daran. Vater selbst trank nur wenig Alkohol, er „vertrug“ nicht viel, und Schnaps ist ein gefährlicher Faktor bei der Arbeit mit und an Maschinen. Ein Unfall, der allerdings nicht mit Alkohol in Verbindung stand, ist mir noch gut in Erinnerung. Zum Nachschärfen seiner Kreissägen schraubte Vater eine 30 Zentimeter große und etwa 15 Millimeter dicke Schleifscheibe auf die Bohr- und Sägewelle der neuen Dreizweck-Maschine. Deren Motor machte – und macht auch heute noch – 2.850 Umdrehungen in der Minute, bei einer Antriebsübersetzung von 1:1 drehte sich also die Schleifscheibe genau so schnell. Für deren Größe und Struktur war aber die Umdrehungszahl viel zu hoch, Vater arbeitete unbewusst in ständiger Lebensgefahr. Das wurde uns klar, als eines Tages mit fürchterlichem Knall ein dreieckiges Stück aus dem „Schmirjelstejn“ (Schmirgelstein = Schleifscheibe) herausbrach, die Bretterecke durchschlug, ein Loch in das Blechdach der Werkstatt fetzte, in hohem Bogen über die Straße „Kippelberg“ flog und im Garten von Nachbar Karl-Heinz Paffrath in der Wiese stecken blieb. Dort wurde es später zufällig beim Rasenmähen gefunden, weil es in die Maschine geriet und die Messer beschädigte. Das etwa 10 Zentimeter große „Dreieck“ sauste glücklicherweise schräg nach oben gegen die Werkstattdecke, bei etwas flacherer Flugbahn hätte es Vaters Kopf zerfetzt oder seinen Körper durchschlagen. Ich stand dabei und wusste nicht, was geschehen war, während Vater den Motor ausschaltete und totenbleich zur Hobelbank wankte. Wir hatten beide einen mächtigen Schutzengel, der offensichtlich auch verhinderte, dass die unwuchtig gewordene Schleifscheibe nicht in weitere Einzelteile zersprang.
An Vaters „Werkstattrunde“ erinnere ich mich noch genau. Es waren überwiegend Senioren aus der Nachbarschaft, zum Beispiel „Schmette Jüpp“ (Josef Geusen), den wir auch „Schmette Jöüser“ nannten, ein kleiner rundlicher Mann mit einem „Schnäuzerchen“ auf der Oberlippe. Er war pensionierter Bundesbahner und Kleinlandwirt mit zwei oder drei Kühen. Im Sommer half ich ihm ab und zu in der Heuernte, besonders beim Heuabladen, das war immer rentierlich für mich. Im Krieg wurden an Schmette regelmäßig die deutschsprachigen Sendungen des „Feindsenders“ London abgehört, selbst Oma Geusen war mit von der Partie. In der Nacht zum 11. Mai 1941 meldete London unter anderem, dass Rudolf Hess, der Stellvertreter des „Führers,“ mit dem Flugzeug in Schottland gelandet sei. Am nächsten Morgen kam im allgemeinen Gespräch an Schmette die Rede auf Rudolf Hess und Oma meldete eifrig: „Dä os jo jetz en England.“ Das hätte fies ins Auge gehen können: Woher hatte Oma die Kenntnis! Zu diesem Zeitpunkt konnte das Ereignis dem deutschen Volksgenossen noch gar nicht bekannt sein! Feindsender abhören wurde schlimmstenfalls mit dem Tod bestraft. Glücklicherweise war kein unberufenes Ohr bei dem Gespräch in der Nähe. „Keschesch Lud“ (Ludwig Rosen) war ebenfalls Eisenbahner im Ruhestand. Er war im Maurer- und Putzerhandwerk ziemlich geschickt und hat auf diesem Sektor an unserem alten Muuße- Haus manche Stunde gearbeitet, besonders bei der Einrichtung von Vaters Werkstatt. Keschesch Lud hat seinerzeit auch die Bruchsteinnische ausgemauert, in der heute das Kippelbergkreuz steht. Lud ging bei uns ein und aus, von ihm erfuhren wir im Frühjahr 1953, dass die Bundesbahn neuerdings Absolventen der Mittleren Reife – damals „das Einjährige“ genannt – als Beamtenanwärter einstellte. Ein junger Mann aus Eitorf (Sieg) und ich, wir beide waren die ersten Aspiranten dieser Art im Bereich der Bundesbahndirektion Köln, sozusagen deren „Paradepferde.“ Unsere „Eignungsuntersuchung“ fand im Zimmer 126 des Hochhauses am Hansaring in Köln (heute Saturn-Hochhaus) in einem noch unverputzten kahlen Raum statt, den die DB angemietet hatte. Ich weiß es noch genau: Ich hatte die richtige Straßenbahn verpasst, kam ein paar Minuten zu spät, wurde empfindlich angeraunzt und wäre am liebsten gleich wieder abgehauen. Der Prüfer war ein unsympathischer Mann mit einer Armprothese. Durch Keschesch Lud kam ich zur Bundesbahn. „Meyesch Pitter“ (Peter Meyers), oft auch „dä ahl Meyesch“ (der alte Meyers) genannt, war ein weiterer Werkstattkunde. Er war der Vater von „Meyesch Mechel“ und wohnte damals in dem kleinen alten Haus „Jasse“ (Josef Reetz) an der Einmündung der Eppengasse in den Kippelberg. Das Haus wurde in den 1950er Jahren abgerissen, als an dieser Stelle der Neubau von Karl Heinz Reetz entstand. Meyesch Pitter stammte aus der Südeifel und sprach einen für uns völlig ungewohnten Dialekt. Wenn beispielsweise eine neue Flasche Kloore „in Betrieb genommen“ wurde, kostete er intensiv den ersten Schluck und stellte dann zufrieden fest: „Dat as en Gooden“ (das ist ein Guter), oder aber er ärgerte sich: „Dat hej as awwer keinen Gooden“ (das hier ist aber kein Guter). Der Beruf von Meyesch Pitter ist mir nicht bekannt. Die Reichs- und spätere Bundesbahn war damals ein Hauptarbeitgeber in unserer Eifel, ein Drittel der männlichen Bevölkerung von Blankenheimerdorf und beispielsweise auch Dahlem, war bei der Bahn beschäftigt. Zwei aktive Bundesbahner gehörten ebenfalls zu Vaters Werkstattrunde: Schäwejans Ött (Otto Görgens) und „Lenze Jupp“ (Josef Bertram). Ött „knommelte“ gern, das heißt er tüftelte und bastelte und befasste sich gerne mit kniffligen Arbeiten. So schärfte er beispielsweise für „Krämesch Erwin“ die diversen Brot-, Fleisch- und Küchenmesser, und für Vaters Werkstatt hat er einmal in wochenlanger Kleinarbeit einen neuen Handgriff für einen „Fuchsschwanz“ (Handsäge) angefertigt, - der existiert heute noch.
Gelegentliche Werkstatt-Kunden bei uns waren schließlich „Peische Johann“ (Johann Jentges), „Miës-Johann“ (Johann Mies) und „Klobbe Köbes“ (Jakob Friederichs). Und nicht zu vergessen „Baalesse Thuëres“ (Theodor Baales),“ unser aus Nonnenbach gebürtiger Hausschlachter. Er versorgte Vaters Werkstatt bei Bedarf mit einem frischen „Nabel“ zum Einfetten der Werkzeuge. Peische Johann, der Bruder von „Karels Mechel“ (Michael Jentges), war Landwirt, stets zu einem Späßchen aufgelegt und schmunzelte ständig. Miës-Johann, ebenfalls Landwirt, sah man nie ohne seine geliebte krumme Tabakspfeife. Zum besseren Halt hinter den Zähnen hatte Johann einen roten „Flaschejummi“ (Flaschengummi = Gummiring eines Bügel-Flaschenverschlusses) auf das Mundstück gesteckt. Klobbe Köbes besaß eine kleine Schusterwerkstatt in der Nachbarschaft. Mir war es immer rätselhaft, wieso Köbes aus dem Berg von reparierten Schuhen immer genau das richtige Stück hervorzuziehen vermochte. Manchmal gesellte sich auch noch „Berchs Mattes“ (Matthias Berg) zur Werkstattrunde. Auch er war Eisenbahner im Ruhestand. Mattes und Keschesch Lud waren unzertrennliche Freunde. Schon bald nach seiner Rückkehr aus dem Krieg im August 1945, begann Vater mit der Einrichtung seiner Werkstatt, die sich in den ersten Jahren auf den früheren Ochsenstall des Hauses Muuße beschränkte. Schon bald fanden sich auch die ersten Senioren zur Werkstattrunde ein. Es war vermutlich im Jahr 1947, als urplötzlich ein unausstehlicher „Duft“ die Luft in der kleinen Werkstatt verpestete. Tagelang forschte man vergeblich nach der Quelle des Übels, in der „Bud“ stank es unerträglich, mit jedem Tag steigerte sich die Wut der erfolglosen Fahnder. Dann entdeckte man hinter der Wandverkleidung einen Klumpen “Stinkkäse“ und hatte auch sofort einen Verdacht. Schmette Jöüser, Keschesch Lud und Vater knöpften sich den jugendlichen Tunichtgut vor; der gestand und erhielt anschließend die Prügel seines Lebens. Sein Name soll vorerst nicht genannt werden, nur so viel: Er wohnt nicht im “Dörf.“ In den 1950er Jahren hatten wir einen kleinen Hund, Straßenmischung, er sah ungefähr wie ein etwas zu groß geratener schwarzer „Spitz“ aus. „Hötter Schäng“ (Johann Kaufmann) hatte uns das Tier als jungen Welpen geschenkt, wir gaben ihm den Namen „Alli.“ Er war ein ungewöhnlich anhängliches Tier, er fraß alles, was bei uns auf den Tisch kam, sogar saure Gurken oder Äpfel, er musste nur sehen, dass auch wir die Dinge verzehrten. Auf rohe „Kolerawe“ (weiße Steckrüben) war er geradezu versessen. Ich hatte ihm einige Kunststücke beigebracht und erklärte der Werkstattrunde, dass Alli die zweieinhalb Meter hohe Leiter zum Heuboden auf der Werkstatt hochklettern könne. Schmette Jöuser, Keschesch Lud und Schäveans Ött setzten jeder eine Mark, ich hielt mit drei DM dagegen, stieg auf den Werkstattboden und lockte Alli herbei. Der arbeitete sich unter Zittern die Leiter hoch und ließ sich oben genüsslich loben. Abwärts ging es freilich nicht allein, da nahm ich ihn auf den Arm und er legte mir die Vorderpfoten um den Hals, um sich festzuhalten. Die Werkstattrunde hatte ihre Mark zu blechen, was Ött besonders hart traf: Er war als ein wenig „kniestich“ (geizig) bekannt. Alli war mehrmals tagelang verschwunden, zwei- oder dreimal brachte „Trappe Jüpp“ ihn zurück, der Jagdaufseher Josef Pickartz. Er hätte das im Wald streunende Tier sehr wohl abschießen können, tat es aber nicht. Trappe Jüpp kannte unseren Alli und brachte ihn zu uns zurück. Einmal landete Alli auf seiner „Landfahrt“ bei einer Witwe in Blankenheim. Als er nach einer guten Woche zurückgebracht wurde, war er geschniegelt und gestriegelt und duftete wie ein ganzer Parfümladen. Die Witwe ließ ihn nur höchst widerstrebend gehen. Alli erkrankte nach Jahren an der Staupe, wurde blind und musste eingeschläfert werden, da auch Tierarzt Dr. Scharrenberg keine andere Lösung wusste.
Wenn die Werkstatt erzählen könnte! Manches längst vergessene „Stöckelche“ (Anekdötchen) würde da wieder lebendig. Aus einer Werkstatthälfte ist längst unser Wohnzimmer geworden, die andere Hälfte dagegen ist noch weitestgehend so, wie sie zur Zeit der Seniorenrunde ausgesehen hat. Die Gedanken gehen zurück, 60 Jahre in die Vergangenheit. Da sitzen sie wieder auf den beiden wackeligen Stühlen oder hocken auf provisorischen Bretterbänken, Schmette Jöüser, Meyesch Pitter, Keschesch Lud, Lenze Jupp, Schäwejans Ött, Miës-Johann - und wie sie alle hießen. Der Ofen raucht und glüht, der „Liempott“ (Leimtopf) stinkt wie eh und je, das Schnapsglas macht die Runde, das „Knasterdöppe“ (Pfeife) dampft und schmurgelt. Man ist so richtig im Erzählen: „Weißt du noch, Hein, wie du vor zwei Jahren das Hausdach erneuert hast und das Gewitter kam? Und wie im Juli 1950 der schwere Hagel war und deine Kuh beinahe eingegangen ist?“ Weiß du noch? – Keiner weiß es mehr, keiner aus der Werkstattrunde ist noch unter uns. Ich bin wohl der Letzte, der sich noch erinnert. |
|||||
 Kloore (Klarer) war generell die Bezeichnung für den „Korn“ und sogar ganz speziell für den „Siegers Korn,“ die damals bei uns allgemein gängige Kornmarke, so genannt nach dem Hersteller. Andere klare Schnäpse, Steinhäger etwa, „Birre“ (Birnenschnaps), „Zwetsche“ (Pflaumenschnaps), oder Wacholder, nannte man beim Namen. Die Beliebtheit unseres Kloore wurde sogar beim Sonntagsgottesdienst in der Kirche offenkundig. Da nämlich gab es, dem Pastor zwar mächtig zum Ärgernis, eigentlich aber als Bestandteil der Messe unverzichtbar, die „Turmsteher“ beim Eingangsportal, die „Turmchristen,“ wie der Pastor sie unwillig bezeichnete. Und die schmetterten bei „Wahrer Gott, wir glauben dir“ besonders stimmgewaltig und inbrünstig den Schlussvers über die Köpfe der Gläubigen: „Sieger wie keiner, allelejua.“ Dabei schwebte vor ihrem geistigen Auge der Kloore am Stammtisch beim Frühschoppen nach der Messe. Ungeduldig erwarteten sie den Schlußsegen und die Priesterworte „Gehet hin in Frieden,“ die sie auf ihre Art umformulierten: „Gehet hin an Friesens.“ Friesens war eine der Stammkneipen in unserem Dorf, wo der Frühschoppen wartete. Den Einen oder Anderen trieb es sogar „vür`m Säjen üß dr Kirch“ (vor dem Segen aus der Kirche). Das waren dann beim Pastor die ganz besonders schwarzen Turmschafe.
Kloore (Klarer) war generell die Bezeichnung für den „Korn“ und sogar ganz speziell für den „Siegers Korn,“ die damals bei uns allgemein gängige Kornmarke, so genannt nach dem Hersteller. Andere klare Schnäpse, Steinhäger etwa, „Birre“ (Birnenschnaps), „Zwetsche“ (Pflaumenschnaps), oder Wacholder, nannte man beim Namen. Die Beliebtheit unseres Kloore wurde sogar beim Sonntagsgottesdienst in der Kirche offenkundig. Da nämlich gab es, dem Pastor zwar mächtig zum Ärgernis, eigentlich aber als Bestandteil der Messe unverzichtbar, die „Turmsteher“ beim Eingangsportal, die „Turmchristen,“ wie der Pastor sie unwillig bezeichnete. Und die schmetterten bei „Wahrer Gott, wir glauben dir“ besonders stimmgewaltig und inbrünstig den Schlussvers über die Köpfe der Gläubigen: „Sieger wie keiner, allelejua.“ Dabei schwebte vor ihrem geistigen Auge der Kloore am Stammtisch beim Frühschoppen nach der Messe. Ungeduldig erwarteten sie den Schlußsegen und die Priesterworte „Gehet hin in Frieden,“ die sie auf ihre Art umformulierten: „Gehet hin an Friesens.“ Friesens war eine der Stammkneipen in unserem Dorf, wo der Frühschoppen wartete. Den Einen oder Anderen trieb es sogar „vür`m Säjen üß dr Kirch“ (vor dem Segen aus der Kirche). Das waren dann beim Pastor die ganz besonders schwarzen Turmschafe.  Lenze Jupp konnte „brassele wie e Päed“ (arbeiten wie ein Pferd), keine Arbeit war ihm zu schwer. Als wir nach dem Krieg den felsigen Hügel vor unserem Haus abtrugen, hat Jupp unermüdlich die „Krützhau“ (Kreuzhacke, Spitzhacke) geschwungen: Maschinen standen nicht zur Verfügung, alle Arbeit geschah von Hand. Manchmal war Jupp bei der Arbeit „jät hüh“ (etwas übereifrig) und nichts ging ihm schnell genug. Da geriet ich junger Hüpfer leicht ins Schwitzen, beispielsweise mit Jupp an der langen „Trommsäch“ (Zugsäge) beim Brandholzmachen im Wald, oder beim Heueinfahren auf den Gewannwegen im Bereich der „Botzebröck“ (Schossenbrücke). Jupp hat mich x-mal zusammengestaucht, wenn er mich daheim beim Brennholzhacken antraf: „Du häuß dat Holz vell ze klejn“ (du hackst das Holz viel zu klein). Er hatte ja Recht, aber mich ärgerte es.
Lenze Jupp konnte „brassele wie e Päed“ (arbeiten wie ein Pferd), keine Arbeit war ihm zu schwer. Als wir nach dem Krieg den felsigen Hügel vor unserem Haus abtrugen, hat Jupp unermüdlich die „Krützhau“ (Kreuzhacke, Spitzhacke) geschwungen: Maschinen standen nicht zur Verfügung, alle Arbeit geschah von Hand. Manchmal war Jupp bei der Arbeit „jät hüh“ (etwas übereifrig) und nichts ging ihm schnell genug. Da geriet ich junger Hüpfer leicht ins Schwitzen, beispielsweise mit Jupp an der langen „Trommsäch“ (Zugsäge) beim Brandholzmachen im Wald, oder beim Heueinfahren auf den Gewannwegen im Bereich der „Botzebröck“ (Schossenbrücke). Jupp hat mich x-mal zusammengestaucht, wenn er mich daheim beim Brennholzhacken antraf: „Du häuß dat Holz vell ze klejn“ (du hackst das Holz viel zu klein). Er hatte ja Recht, aber mich ärgerte es. In der Schreinerwerkstatt von damals türmten sich Berge von Hobelspänen und Sägemehl, eine Absauganlage gab es nicht. Fußboden und Decke waren aus Holz, zum Teil auch die Wände, und über der Werkstatt lag unser Heustall, - alles in allem eine Anhäufung hochbrennbarer Materialien. Und an der Kaminwand stand auf einer Blechplatte der hochbeinige Kanonenofen, der mit Säge- und Hobelspänen beheizt wurde. Beim Nachfüllen schlug die Flamme aus der offenen Feuerklappe und Funken stoben zur Decke hoch, - ein geradezu strafbarer Zustand, heute absolut unmöglich. Ich erinnere mich noch, dass eines Tages unser Dorfpolizist – er hieß Drangosch und wohnte bei Peter Schlich vor der Bahnbrücke – ein Schild „Rauchen verboten“ für unsere Werkstatt anordnete. An der unmöglichen „Heizung“ fand er erstaunlicherweise nichts auszusetzen. Dass da all die Jahre kein Unglück geschah, grenzt an ein Wunder, da muss wohl Sankt Florian höchstpersönlich seine Hand über unser Haus gehalten haben.
In der Schreinerwerkstatt von damals türmten sich Berge von Hobelspänen und Sägemehl, eine Absauganlage gab es nicht. Fußboden und Decke waren aus Holz, zum Teil auch die Wände, und über der Werkstatt lag unser Heustall, - alles in allem eine Anhäufung hochbrennbarer Materialien. Und an der Kaminwand stand auf einer Blechplatte der hochbeinige Kanonenofen, der mit Säge- und Hobelspänen beheizt wurde. Beim Nachfüllen schlug die Flamme aus der offenen Feuerklappe und Funken stoben zur Decke hoch, - ein geradezu strafbarer Zustand, heute absolut unmöglich. Ich erinnere mich noch, dass eines Tages unser Dorfpolizist – er hieß Drangosch und wohnte bei Peter Schlich vor der Bahnbrücke – ein Schild „Rauchen verboten“ für unsere Werkstatt anordnete. An der unmöglichen „Heizung“ fand er erstaunlicherweise nichts auszusetzen. Dass da all die Jahre kein Unglück geschah, grenzt an ein Wunder, da muss wohl Sankt Florian höchstpersönlich seine Hand über unser Haus gehalten haben.