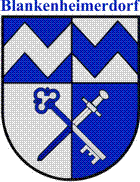|
Als wir noch mit Brandholz stochten
Jahrzehntelang war Holz als Brenn- und Heizstoff völlig aus der Mode gekommen, nur ein paar Unentwegte rackerten sich noch alljährlich mit Holzmaache (Zubereitung von Brennholz) ab, – und wurden von den fortschrittlichen Ölheizungsbesitzern mitleidig belächelt. Dann stiegen die Ölpreise und seit einigen Jahren steht Brennholz wieder hoch im Kurs, ist aber immer noch deutlich kostengünstiger als Öl, Gas oder Strom, sofern man ein wenig Knochenarbeit nicht scheut. Für den Brandholzfreund ist unterdessen Bösche (Waldarbeit) ein Hobby. Das heute übliche Wort „Brennholz“ kannten unsere Eltern und Großeltern nicht, ihr Heizstoff hieß „Brandholz“ und dessen Beschaffung war eine zeit- und arbeitsaufwendige Angelegenheit. Am Brandholz wärmp mr sech driemool (…wärmt man sich dreimal), lautete früher ein weises Zitat, das heute noch Gültigkeit besitzt. Zunächst nämlich wärmt uns die anstrengende Waldarbeit, dann schwitzen wir beim Holzsägen und Hacken, und schließlich wärmen wir uns genüsslich und behaglich an Herd und Ofen.
Behaglichkeit, – treffender ließ sich die Atmosphäre in der Eifeler Wohnstube nicht beschreiben, wenn draußen der Wintersturm ums Haus pfiff und im gusseisernen Kanonenofen die Buchenscheite knackten; wenn Opa im Prötter neben dem Küchenherd genüsslich sein Pfeifchen schmauchte oder Oma im Herdwinkel mit flinken Händen die Stricknadeln führte. Ofenwärme ist „lebendig,“ sie entspringt einer sicht- und fühlbaren Quelle, ist geradezu greifbar. Der Besucher reibt wohlig die klammen Hände über der heißen Herdplatte und stellt zufrieden fest: Bie öch oß et ens emmer jät schön wärm. Das ist ein etwas kompliziertes Eifeldeutsch und heißt wörtlich: „Bei euch ist es einmal immer etwas schön warm.“ Heizungswärme dagegen ist einfach da, sie dringt aus verborgenen Nischen oder aus dem Fußboden, sie ist trocken und sozusagen steril. Dafür ist sie aber auch wartungsfrei und bequem, – und teuer, denn Bequemlichkeit hat bekanntlich ihren Preis. 
Wer sich auskennt, der weiß den Wohlgeschmack der auf dem Kolleherd zubereiteten Speisen sehr wohl zu schätzen. Den Kohleherd gibt es auch heute noch – oder wieder – in moderner Form. Wintertags ist er bei uns durchgehend in Betrieb, als Kochstelle und Wärmespender. Zwei Klütte (Briketts) erhalten während der Nacht die Glut. Im großen Pott auf der Herdplatte ist ständig heißes Wasser vorrätig, etwa fürs Geschirrspülen. Das erspart manchen Strom-Euro für Durchlauferhitzer und Heißwasserspeicher. Das morgendliche Reinigen und Austragen der Asche ist Gewohnheitssache, wenn im Sommer nicht jestauch (gestocht, geheizt) wird, fehlt irgendetwas in meinem Alltag. Der Elektroherd erzeugt zwar keine Asche, gereinigt werden muß aber auch er und als Wärmespender ist er kaum zu gebrauchen.
Waldarbeit

Zur Zeit unserer Eltern und Großeltern war der Eifelbauer gleichzeitig Waldarbeiter. Die Leute beschafften sich den jährlichen Brennholzbedarf in der Regel selber im eigenen Privatwald oder kauften „Meterholz“ bei der Gemeinde. Viele Bauern verdienten sich im Winter ein paar zusätzliche Groschen als Böschmann (wörtlich: Waldmann, = Waldarbeiter) im Gemeinde- oder Staatswald, beispielsweise Ohm Mattes, mein Onkel, dem ich während meiner Kinderzeit im Mittchen (Henkelmann) das Mittagessen zur Arbeitsstelle trug und der mir eine Menge Nützliches über die körperlich anstrengende, trotzdem aber schöne – weil naturnahe – Arbeit vermittelte. En dr Bösch john (in den Wald gehen) war das landläufige Wort für die Waldarbeit allgemein.
Gegen Ende des Winters war das Brandholz im Gemeindewald geschlagen, die gestapelten Raummeter waren nummeriert und wurden an die Käufer verlost, um eventuelle Übervorteilungen zu vermeiden: Oft nämlich lag das Holz an schwer zugänglichen Stellen, war nicht direkt anzufahren und musste mühsam zum Fuhrwerk herangeschleppt werden. Die Zuteilung hätte in einem solchen Fall zu Beschwerden geführt, wen es dagegen per Los traf, der hatte eben Pech, da gab es nichts zu beschweren. Der Kaufpreis war in der Regel festgesetzt, mancherorts wurden aber auch die Kloofter (Klafter, Meterholz) versteigert. Dabei erreichte abfuhrgünstig gelegenes Holz nicht selten horrende Preise, in Nettersheim beispielsweise war die Versteigerung der Kloofter stets ein bedeutsames Ereignis.
Bei uns in Blankenheimerdorf verkündete der Gemeindediener Scholle Pitter (Peter Reetz) mit der großen Schelle, dass am nächsten Sonntag nach dem Hochamt die Holzbreefjer (Holzbriefchen) ausgegeben würden. Das geschah in der Schule und ging völlig neutral vonstatten. Bürgermeister Schang (Johann) Leyendecker rief die Holznummern aus der Strichliste auf, ein Helfer zog einen der vorgefertigten Blanko-Abfuhrscheine mit dem Namen des Käufers aus der Loskiste und trug die aufgerufene Nummer darauf ein, – fertig. Nachmittags setzte dann eine kleine „Völkerwanderung“ zur Einschlagstelle im Gemeindewald zwecks Standorterkundung ein, nicht selten stapfte man dabei durch fußhohen Schnee. Am nächsten Werktag war man wieder vor Ort, um die Knöppele (Knüppel, Astholz) sicherzustellen. Die nämlich konnte sich der Käufer kostenlos aufarbeiten, soweit sie im Umfeld seines Meterstapels lagen. Hier musste man rasch bei der Hand sein, denn nicht jeder beschränkte sich auf den ihm zustehenden Knüppelbereich.
Auf Längen geschnittenes Brandholz wurde und wird auch heute in der Regel nach Raummetern gehandelt. Das ist ein räumlicher Kubikmeter Rundholz, dessen tatsächlicher Inhalt aber wegen der Lücken zwischen den Hölzern nur etwa 0,7 Kubikmeter beträgt. Stammholz wird dagegen in Festmetern gemessen. Der Festmeter hat einen vollen Kubikmeter Inhalt. Die meterlangen Rundhölzer waren oft fürs Aufladen von Hand zu schwer und mussten in handlichere Stücke jeresse (gerissen, gespalten) werden. Dazu schleppte man die kiloschweren Eisenkeile und den dicken Vorschlaghammer in den Wald. Holz rieße war eine harte und mühsame Arbeit, Spaltmaschinen kannte man damals bei uns nicht
 Schnelligkeit war auch beim Holzabfahren geraten, soweit der Stapel gut zu erreichen und somit leicht abtransportierbar war. Zu Lebzeiten meines Vaters in den 1950er Jahren, wurde zweimal unser Meterholz gestohlen, weil es günstig am Abfuhrweg lag. Der Dieb blieb bis heute unerkannt. Holzdiebstahl gab es zu allen Zeiten. Annette von Droste-Hülshoff beschrieb beispielsweise in ihrer „Judenbuche“ die Bande der „Blaukittel,“ die im 18. Jahrhundert im Westfälischen ihr Unwesen trieb. Der Nonnenbacher Heimatdichter Johann Ehlen (Klooße Hann) berichtete um 1900 in seinem Gedicht „Der Gespensterhund in Olbrück“ von einem Fabelwesen mit glühenden Augen, das sich auf die Traglasten der Holzdiebe hockte und die Forstfrevler in die Flucht trieb. Holzdiebstahl ist auch heute noch nicht aus der Mode, der Käufer tut gut daran, handgerecht geschnittene Brennholzstücke nicht über Nacht am Waldweg liegen zu lassen. Das empfehlen auch die Forstleute. Schnelligkeit war auch beim Holzabfahren geraten, soweit der Stapel gut zu erreichen und somit leicht abtransportierbar war. Zu Lebzeiten meines Vaters in den 1950er Jahren, wurde zweimal unser Meterholz gestohlen, weil es günstig am Abfuhrweg lag. Der Dieb blieb bis heute unerkannt. Holzdiebstahl gab es zu allen Zeiten. Annette von Droste-Hülshoff beschrieb beispielsweise in ihrer „Judenbuche“ die Bande der „Blaukittel,“ die im 18. Jahrhundert im Westfälischen ihr Unwesen trieb. Der Nonnenbacher Heimatdichter Johann Ehlen (Klooße Hann) berichtete um 1900 in seinem Gedicht „Der Gespensterhund in Olbrück“ von einem Fabelwesen mit glühenden Augen, das sich auf die Traglasten der Holzdiebe hockte und die Forstfrevler in die Flucht trieb. Holzdiebstahl ist auch heute noch nicht aus der Mode, der Käufer tut gut daran, handgerecht geschnittene Brennholzstücke nicht über Nacht am Waldweg liegen zu lassen. Das empfehlen auch die Forstleute.
Im Vergleich zu früher ist die Böschärbed heute dank moderner Maschinen und Werkzeuge geradezu eine Spielerei geworden. Allein die Motorsäge ersetzt drei Böschmänn, und was die supermoderne Holzerntemaschine an einem Tag leistet, hätten drei Mann früher in einem halben Winter kaum geschafft. Vor 70 Jahren war die Waldarbeit eine Knochenschinderei, weil sie von A bis Z von Hand getan werden musste. Heute bedient sich selbst der Hobby-Böschmann der Kettensäge, muss allerdings inzwischen für die Selbstwerbung von Brennholz einen erfolgreich absolvierten Motorsägenlehrgang nachweisen. Das ist gut und richtig so, die Waldarbeit nämlich ist eine gefährliche Tätigkeit. Das Baumfällen sollte der Laie in jedem Fall den Fachleuten überlassen, ein gar nicht so seltener „Hänger“ (am Fallen gehinderter Baum) nämlich ist immer eine bedrohliche Angelegenheit, und selbst das so einfach scheinende Aufarbeiten von liegendem Holz birgt noch eine ganze Reihe von Gefahren in sich. Das behaupte ich, obwohl – oder gerade weil – ich 30 Jahre lang ohne „Führerschein“ mit der Motorsäge gearbeitet habe.
Mit Stumpf und Stiel
Wenn es die Schulaufgaben erlaubten, blieb ich oft nach dem Essentragen bis zum Feierabend bei den Männern im Wald. Aus Sicherheitsgründen (Unfall) waren immer wenigstens zwei Personen am Arbeitsplatz, außerdem erforderte die Handhabung der langen Trommsääch (Schrotsäge, Zugsäge) zwei Mann. Als ich 11 oder 12 Jahre alt war, nahm mich der Onkel zum Brandholzschlagen mit in den Wald. Dabei lernte ich unter anderem den Umgang mit Trommsääch und Axt und war nicht wenig stolz darauf. Ich lernte, dass man die Fichtenäste tief am Stamm abschlagen musste, damit nicht etwa Aststümpfe das spätere Entrinden mit dem Schällmetz (Schäleisen) behinderten. Ich lernte nicht zuletzt, wie man einen Baum, etwa eine Buche, sozusagen „mit Stumpf und Stiel“ verwerten konnte.
 Die zu fällenden Bäume hatte der Förster vorab mit dem Krätzer (Ritzwerkzeug zum Anreißen der Rinde) gekennzeichnet. Der Forstmann und auch der qualitätsbewußte Waldarbeiter legten Wert auf möglichst niedrige Fällstümpfe. So wurden also zunächst Schnee und Geäst um den Stamm herum entfernt, so tief wie möglich et Fallkerf ( die Fallkerbe) geschlagen und dem Baum die Fallrichtung vorgegeben. Das geschah in mühsamer Arbeit mit der Axt, heute erledigt es die Motorsäge im Handumdrehen. Für den Fällschnitt wurde die Zugsäge entsprechend der Bruchleiste höher angesetzt. Beim Sägen kniete man auf dem Boden, dabei zog man die Säge auf sich zu. Hilfreich waren Kneeschoh (Knieschuhe, Knieschutz) aus dickem Schwammgummi. Der Fällschnitt war eine Schinderei: kniend, dabei gebückt, musste die Säge waagerecht geführt werden. Bald schmerzten Rücken und Arme, ich musste häufig puëse (pausieren), sehr zum Ärger von Ohm Mattes. Sobald der Baum zu fallen begann, mußte ich weit genug schräg nach hinten weglaufen, den „Fluchtweg“ hatten wir zuvor bestimmt und von Geäst gesäubert. Die zu fällenden Bäume hatte der Förster vorab mit dem Krätzer (Ritzwerkzeug zum Anreißen der Rinde) gekennzeichnet. Der Forstmann und auch der qualitätsbewußte Waldarbeiter legten Wert auf möglichst niedrige Fällstümpfe. So wurden also zunächst Schnee und Geäst um den Stamm herum entfernt, so tief wie möglich et Fallkerf ( die Fallkerbe) geschlagen und dem Baum die Fallrichtung vorgegeben. Das geschah in mühsamer Arbeit mit der Axt, heute erledigt es die Motorsäge im Handumdrehen. Für den Fällschnitt wurde die Zugsäge entsprechend der Bruchleiste höher angesetzt. Beim Sägen kniete man auf dem Boden, dabei zog man die Säge auf sich zu. Hilfreich waren Kneeschoh (Knieschuhe, Knieschutz) aus dickem Schwammgummi. Der Fällschnitt war eine Schinderei: kniend, dabei gebückt, musste die Säge waagerecht geführt werden. Bald schmerzten Rücken und Arme, ich musste häufig puëse (pausieren), sehr zum Ärger von Ohm Mattes. Sobald der Baum zu fallen begann, mußte ich weit genug schräg nach hinten weglaufen, den „Fluchtweg“ hatten wir zuvor bestimmt und von Geäst gesäubert.
In Gefahr sind wir bei unserer Waldarbeit eigentlich nie geraten, einmal aber haben wir trotzdem im Sinne des Wortes die Flucht ergriffen. Nicht weit von daheim, in der oberen „Welters Dell“ (Flurname), hatten wir eine halbdürre Birke gefällt und begannen mit dem Entasten, als Ohm Mattes plötzlich die Axt wegwarf, wild mit den Armen ruderte und in den Wald stürmte. Dabei schrie er mir zu, ich solle ebenfalls weglaufen. Atemlos machten wir in sicherer Entfernung Halt und ich erfuhr, was nun eigentlich geschehen war. In halber Höhe der Birke war in einer morschen Asthöhle ein Hornissennest, dessen Bewohner sich wütend auf uns stürzten. Gestochen wurde niemand von uns, ich selber hatte die Gefahr nicht einmal bemerkt und war nur blindlings dem Onkel nachgerannt. Wir gingen zunächst einmal nach Hause, erst Stunden später wagten wir uns vorsichtig an den gefällten Baum heran, denn immerhin musste ja unser kostbares Werkzeug geborgen werden. Das Hornissennest war verlassen, beim Fallen hatte sich ein Ast in die Höhle gebohrt. Wir fanden zwei tote Tiere und bestaunten ihre Größe. In der Schule hatte uns Lehrer Gottschalk von Riesenwespen erzählt und uns Bilder gezeigt, echte Hornissen hatte ich aber noch nie gesehen.
Entastet wurde ein gefällter Baum mit der Axt, die daheim auf dem mächtigen Wellstejn (Rundstein zum Nassschleifen von Werkzeugen) fast messerscharf geschliffen wurde. Die Böschax (Waldaxt) war das Heiligtum ihres Besitzers und für jeden Außenstehenden tabu. Ähnliches galt auch für das Schäleisen und für den Sänßelshamer (Sensenhammer), das spezielle Werkzeug fürs Sensedengeln. Je nach Beschaffenheit und Wuchs war der Baumstamm als Nutzholz verwendbar und blieb „am Stück,“ ansonsten wurde er in Meterabschnitte jetrömp (zerteilt) und zusammen mit den starken Ästen zu Einzel- oder Doppelraummetern aufgeschichtet. „Trömpe“ ist ein Eifeler Wort für das Zerteilen einer Einheit in bestimmte Abschnitte, beim Brennholz für das „Ablängen“ von Meterstücken. Ein solches Stück ist ein „Trumm,“ davon abgeleitet ist „Trommsääch.“
 Schanzen und Rievkoocheholz Schanzen und Rievkoocheholz
Die schwächeren Äste kamen, wie bereits erwähnt, als „Knöppele“ zum Brandholz. Aus dem übrig gebliebenen schwachen Geäst sortierten sich die Leute Äezerieser (Erbsenreisig) aus. Diese „Kletterstützen“ der Erbsen sah man früher in jedem Garten, heute sind sie aus der Mode gekommen. Was zuletzt noch vom Buchenbaum an Reisig übrig war, wurde zu Schanzen zurecht gehackt. Das waren armlange handliche Bündel zum Beheizen des häuslichen Backofens, die bequem durch die niedrige Ofentür passten. Bindemittel waren Weiden- oder Haselnussruten. Trockene Schanzen entfachten im Handumdrehen im Backofen ein Höllenfeuer, sie verbrannten allerdings auch rasch, es musste häufig nachgelegt werden. Ihren Na-men verdankten die Schanzen den früheren Befestigungsanlagen von Feldstellungen und Schützengräben, die ja auch aus solchen Bündeln bestanden. Das Werkzeug für das Zurechthacken von Schanzen war die Hääp, eine Art Beil mit langer schmaler Klinge und kurzem Handstiel, im Werkzeugkatalog heute als „Heppe“ aufgeführt.
Schanzen wurden auch fürs Feueranmachen im Eifelhaus gebraucht, ein kleiner Vorrat lagerte auf den Steinplatten unter dem Küchenherd. Zerkleinert wurde auch hier mit der Hääp, wobei als Haustock (Hackklotz) nicht selten der dicke Eichenbalken diente, der unter der niedrigen Küchendecke verlief und das Obergeschoß trug. Das Schanzenhacken „über Kopf“ war umständlich, wurde aber praktiziert. Einen solchen Eichenbalken, etwa 30 mal 40 Zentimeter dick, gab es nach dem Krieg noch in unserem Haus in Blankenheimerdorf. Tiefe Kätschen (Kerben, Schadstellen) zeugten vom häufigen Schanzenhacken in früheren Jahren.
Mancher kennt noch den Ausdruck Rievkoocheholz (Reibekuchenholz), das speziell zum Herdheizen beim Reibekuchenbacken gebraucht wurde. Rievkoocheholz war dürres, stammtrockenes Buchenholz, das sich in der Regel in jungen Läuterungsbeständen fand. Aus seiner Waldarbeit kannte Ohm Mattes die Stellen, wo düer Staale (dürre Stangen) standen. Die gab der Forstmann meistens unentgeltlich her, weil sie ja ohnehin verfaulen würden. Rievkoocheholz wurde daheim gesondert aufbewahrt, es war auch als „Holzbrikett“ verwendbar: Ein entsprechend dickes Stück konnte eine Nacht hindurch die Herdglut erhalten. Ein anderes Rievkoocheholz waren trockene Fichtenzapfen, die uns daheim die Hardt in unerschöpflichen Mengen lieferte. Diese Dännebetze (Tannenzapfen) verbrannten zwar rasch, erzeugten aber in kürzester Zeit eine enorme Hitze, die ja fürs Reibekuchenbacken erforderlich war.
Beim Einschlag von Nadelholz kam zusätzlich zum Fällen das Entrinden von Hand hinzu, ebenfalls eine schweißtreibende Knochenarbeit, die besonders sorgfältiges Entasten erforder-lich machte. Dabei wurde auch zusätzliches Werkzeug gebraucht, das Schäleisen beispielsweise und der gewichtige Wendehaken zum Drehen der halb entrindeten Stämme, sowie der „Sappie,“ das massive Zieheisen mit meterlangem Stiel. Axt, Trommsääch und bei schwachem Holz auch die Rahmsääch (Rahmen-, Bügelsäge) gehörten in jedem Fall zur Ausrüstung, – der Böschmann hatte oft ein beachtlich Gewicht zu schleppen, nicht selten kilometerweit bis zur Einsatzstelle. Die Werkzeuge blieben an Ort und Stelle, bis die gesamte Arbeit abgeschlossen war, und niemandem fiel es ein, etwas zu stehlen oder zu beschädigen. Wenn in jungen Fichtenbeständen „Stangen“ geschlagen werden mussten, fertigten sich die Böschmänn vor Ort besondere „Schälböcke,“ dreibeinige Gestelle als Auflage für die Stangen. Das erleichterte das Entrinden deutlich, weil man nicht dauernd in gebückter Stellung arbeiten musste. Im Fichteneinschlag duftete es stets köstlich nach frischem Harz. Die Kleidung der Waldarbeiter war abends klebrig und die Hände schwarz vom Harz, dass sich nur schwer mit dem Naturbimsstein und Schmierseife entfernen ließ. Lösungsmittel kannte man bei uns damals noch nicht.
 Mit Säge und Axt Mit Säge und Axt
Wenn das gefällte Brandholz für den Eigenbedarf bestimmt war, wurde es auf etwa vier Meter Länge geschnitten. Dann passten die Stücke auf den Ackerwagen, den man durch Entfernen des Kastenaufbaues zum Langholzwagen umfunktioniert hatte. Die Stämme durften nicht allzu „mächtig“ sein, weil sie von Hand auf- und abgeladen werden mussten. Solch ein Holztransport war für die Zugtiere – oft ein Kuhgespann – Schwerarbeit. Wo in unwegsamem Gelände mit dem Wagen nicht heranzukommen war, holte man das Holz erst im Winter mit dem schweren Gespannschlitten aus dem Wald. Mit diesem Gerät waren bei hartgefrorenem Waldboden auch die sonst unzugänglichen Sumpfstellen erreichbar. Der Schlitten war eigentlich ein Wagen, dessen Räder durch Kufen ersetzt waren. Neben dem Schuppen daheim war unser „Holzplatz,“ hier wurde zunächst das Material aus dem Wald gelagert und wenn alles beieinander war, ging es ans Sägen. Tagelang stand dann Ohm Mattes am Sägebock, Stunde um Stunde knirschte und schrappte die Rahmsääch durchs Holz und zum Feierabend waren nicht selten zwei Raummeter geschafft. In Abständen musste die Säge geschärft werden. Hierfür wurde das Blatt mit den Zähnen nach oben in zwei Einschnitte an den Seitenstützen des Sägebocks eingeklemmt. Es gab eine einzige, uralte Dreikantfeile im Haus, die so gut wie gar keinen „Hieb“ mehr aufwies. Das Kreischen beim Sägeschärfen war nicht auszuhalten, ich ging regelmäßig „stiften.“ Vater hatte für mich eine kleine Schreinersäge mit verstellbarem Blatt besorgt und einen passenden Sägebock gebaut. So konnte ich fleißig mit Holzsägen, für mich waren die Knöppele reserviert.
 Nach dem Sägen war Holzhaue (Hacken) angesagt und da war ich selbstredend auch mit dabei. Onkel Schäng (Johann) aus Blankenheimerdorf, der Bruder von Ohm Mattes, hatte mir ein handliches kleines Beil geschenkt, mit dem ich rasch umzugehen lernte. Dazu gehörte noch ein auf Kindergröße zugeschnittener Haustock, – ich war komplett für die Holzarbeit ausgerüstet, sie hat mir auch immer Freude gemacht. Wenn ich beim Holzhacken war und ein Erwachsener kam vorbei, hieß es meistens etwas hinterhältig: Paß op, hau dech net op de Zong (Paß auf, hau dich nicht auf die Zunge). Das war ein damals allgemein übliches Wort, mich aber ärgerte es gewaltig, ich fühlte mich in meiner Holzhackerehre gekränkt. Das Beil besitze ich heute noch. Onkel Schäng war übrigens auch ein Holzfreund, er hat noch mit über 80 Jahren Brandholz von Hand gesägt und sich damit fit gehalten, obwohl es bei ihm längst eine Kreissäge gab. Nach dem Sägen war Holzhaue (Hacken) angesagt und da war ich selbstredend auch mit dabei. Onkel Schäng (Johann) aus Blankenheimerdorf, der Bruder von Ohm Mattes, hatte mir ein handliches kleines Beil geschenkt, mit dem ich rasch umzugehen lernte. Dazu gehörte noch ein auf Kindergröße zugeschnittener Haustock, – ich war komplett für die Holzarbeit ausgerüstet, sie hat mir auch immer Freude gemacht. Wenn ich beim Holzhacken war und ein Erwachsener kam vorbei, hieß es meistens etwas hinterhältig: Paß op, hau dech net op de Zong (Paß auf, hau dich nicht auf die Zunge). Das war ein damals allgemein übliches Wort, mich aber ärgerte es gewaltig, ich fühlte mich in meiner Holzhackerehre gekränkt. Das Beil besitze ich heute noch. Onkel Schäng war übrigens auch ein Holzfreund, er hat noch mit über 80 Jahren Brandholz von Hand gesägt und sich damit fit gehalten, obwohl es bei ihm längst eine Kreissäge gab.

Brandholz musste im Frühjahr bereitet werden, damit es im Sommer trocknen konnte. Wenn einmal witterungsbedingt die Zeit nicht reichte – die Feldbestellung hatte in jedem Fall Vorrang – gab Ohm Mattes das Holzsägen in Auftrag. Dann erschien bei uns eine mobile elektrische Bandsäge. Unser Haus besaß keinen Kraftstromanschluss, die Metallschuhe des Motorkabels wurden mittels einer isolierten Stange in die Drähte der Freileitung eingehängt, ein besonderer Zähler registrierte den Stromverbrauch. Ich meine, dass es sich bei dem Sägeunternehmen um die Helejesch Männ (Hilgers-Leute) aus Blankenheim handelte. In Blankenheimerdorf hat noch lange nach dem Krieg Hötter Schäng (Johann Kaufmann) mit seiner fahrbaren Kreissäge Brandholz geschnitten. Der Antrieb war hier ein Verbrennungsmotor.
 Bei jedem Haus gab es damals ganze Berge von gehacktem Brandholz, das im Lauf des Sommers je nach Trocknungsgrad nach und nach önner Daach (unter Dach) gestapelt und im Winter verheizt wurde. Die heute angeratene dreijährige Ablagerzeit für Brennholz kannte man früher nicht, sie war auch gar nicht so wichtig. Der Kamin im Bauernhaus nämlich war derart bemessen, dass der Schornsteinfeger zum Reinigen bis zur halben Höhe hinein steigen konnte. Ein Verschluss durch Verrußen war praktisch unmöglich. Das Ablagern ist im Übrigen nur sinnvoll, wenn das Holz lufttrocken ist und nicht in geschlossenen Räumen gelagert wird. Mindestens ebenso wichtig ist das zügige Verbrennen in Herd und Ofen, langsames Verkohlen erzeugt Ruß und der verstopft den Kamin. Das hat mir kürzlich unser zuständiger Schornsteinfegermeister erklärt. Bei jedem Haus gab es damals ganze Berge von gehacktem Brandholz, das im Lauf des Sommers je nach Trocknungsgrad nach und nach önner Daach (unter Dach) gestapelt und im Winter verheizt wurde. Die heute angeratene dreijährige Ablagerzeit für Brennholz kannte man früher nicht, sie war auch gar nicht so wichtig. Der Kamin im Bauernhaus nämlich war derart bemessen, dass der Schornsteinfeger zum Reinigen bis zur halben Höhe hinein steigen konnte. Ein Verschluss durch Verrußen war praktisch unmöglich. Das Ablagern ist im Übrigen nur sinnvoll, wenn das Holz lufttrocken ist und nicht in geschlossenen Räumen gelagert wird. Mindestens ebenso wichtig ist das zügige Verbrennen in Herd und Ofen, langsames Verkohlen erzeugt Ruß und der verstopft den Kamin. Das hat mir kürzlich unser zuständiger Schornsteinfegermeister erklärt.
Ein Nachwort
Waldarbeit, Holzmachen wie vor 100 Jahren, das kann man heute noch im Museum erleben, im Freilichtmuseum Kommern beispielsweise, ganz in unserer Nähe. Da werden Erinnerungen an die vergessen geglaubte Kinderzeit wach, der Besucher gewinnt einen Einblick in das Leben und den Alltag unserer Vorfahren, – und erlebt beschämende Reaktionen einer „kultivierten“ Gesellschaft. Vor etlichen Jahren war´s, über die Schwelle des „Eifelhauses“ stakelte am muskelstrotzenden Arm ihres Begleiters mit „huch“ und „hach“ eine aufgetakelte Touristenfregatte. Beim Anblick der Eifeler Küche war sie entsetzt: „Huch, Egon, das waren ja Wilde, die hier gehaust haben!“ Und an der Tür zum winzigen Schlafgemach fiel sie beinahe in Ohnmacht: „Nein, Schatz, stell dir vor, wie die hier…“ Leise und eilig schlich ich hinaus, um nicht „explodieren“ zu müssen.

Waldarbeit, Schwerarbeit, – im Krieg hat unsere Mutter sie auf sich nehmen müssen, wie ungezählte andere Frauen. Vater und Ohm Mattes waren nicht daheim, die kleine Landwirtschaft musste aber fortgeführt werden, die Tiere mussten versorgt, die Felder bestellt, Heu und Getreide eingefahren, Kartoffeln und Rüben geerntet werden. Der Schornstein musste am Dämpe (am Rauchen) bleiben, das nötige Brandholz wurde in den beiden weitab gelegenen eigenen Waldparzellen geschlagen. Dabei musste ich, noch nicht zehn Jahre alt, unserer Mutter „helfen,“ und diese Art Hilfe kann man sich leicht ausmalen. Ohm Mattes schrieb uns aus Norwegen, dass wir einfach in der nahen Hardt ein paar Bäume fällen sollten, auch wenn es nicht unser Wald sei, das sei im Krieg kein Verbrechen. Wir taten es trotzdem nicht. Bis eines Tages die Soldaten mit einer Zweimann-Motorsäge erschienen und den halben Fichtenbestand am Fuß der Hardt umsägten, um aus den Stämmen einen Knüppeldamm zu bauen. Da wurde nicht nach dem Waldbesitzer gefragt, da wurde einfach gefällt. Danach haben wir uns ein einziges Mal Holz in der Hardt geholt: Zwei dürre Bäume, die der Sturm umgeworfen hatte. Das wird wohl kein großartiger Diebstahl gewesen sein. Unsere Mutter starb am 29. Juni 2008, am 25. August wäre sie 101 Jahre alt geworden.
|